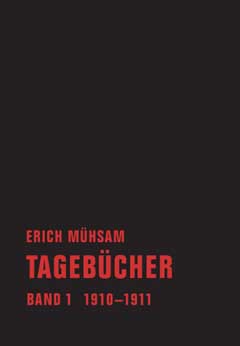VI.
29. Juli – 17. Oktober 1911.
S. 724 – 867
München, Sonnabend, d. 29. Juli 1911.
Strich reist Montag, spätestens Dienstag ab, und am nächsten, spätestens übernächsten Tage werde ich glücklich sein und Lotte, ein paar Tage lang, unbestritten mein Weib nennen. Es ist ergreifend, wie herzlich und schön auch sie mir fühlbar macht, daß zwischen uns beiden ein tieferes Einverständnis ist, als die sonstige Kameradschaft, als dies sonstige in spitzbübischen Eroticis neckende Komplot. Manchmal ist sie gegen mich gereizt, wird sie dann grob, dann sehe ich nachher doch in ihren Augen das gute Wort, die liebende Gebärde. Ach, ich liebe Lotte so fest und rein, wie ich nicht mehr glaubte, daß ich noch einmal werde lieben können. – Gestern abend waren wir – Lotte, Strich und ich – in der Ausstellung draußen. Es wollte Gewitter werden, nach der schwelenden Hitze, bei der dumpfen Schwüle die tiefste Sehnsucht eines jeden Menschen. Ein scharfer Wind kam auf, Gewölk zog sich zusammen, der Himmel blitzte an allen Enden. Das dauerte etwa eine Stunde lang. Endlich folgten einige schwache Donnerschläge, und nach langer Zeit ein wenig Regen. Heut ist’s wieder heiß, trocken und wolkenlos ringsum. Es scheint, die unerträgliche Glut wird nie aufhören. Schon melden die Blätter aus manchen Städten Wassersnot, hier und anderwärts häufen sich die Hitzschläge und Sonnenstiche. Immerhin: ein wenig kühlte sich die Luft von dem Gewitteranfall ab, und wir fuhren dann in die Torggelstube, wo an einem Tisch Wedekind mit Frau in kleiner Gesellschaft, am Haupttisch Rößler im Kreise der Pokerasten und die Vallière mit Anhang saßen. Der Bruder Strich kam, und der greuliche Sörgel, und ich ging bald, da ich noch zu arbeiten hatte. Bis nach 4 Uhr schrieb ich dann, splitternackt an meinem Schreibtisch, einen Theaterartikel für Nr. 5 des „Kain“. Heut früh telefonierte mich Albert R. an. Ich möchte ihn mittags im Matthäser suchen. Ich fuhr also erst zur Druckerei, dann dorthin. Er war mit seiner Frau und einem Kameraden da, der in Zürich einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht hatte. R. erzählte mir Trauriges von Otto Gross, der dadurch, daß Frieda Mallaschitz ihm über Frick geschimpft hat – er habe das Verhältnis mit Frieda nur aus Geldinteressen – in einen Zustand völligen Wahnsinns verfallen sei. Er halluziniere wieder sehr viel, zertrümmere im Halbschlaf Spiegel, Lampen und sonstige Dinge, wische die kranke Nase an allen erreichbaren Geräten, wie Milchtöpfen etc. ab und sei ganz irr und krank. Seit 8 Tagen aber ist er verschwunden. Inzwischen sei Johannes einmal von Bern nach Zürich gefahren, und vielleicht habe der ihn mitgenommen. Vielleicht sei er auch in Ascona. Mich beunruhigen diese Berichte sehr, und jedenfalls soll ich sofort, wenn R. in Zürich ist, Bescheid haben. Es ist mir sehr leid um Otto, er ist trotz allem einer der feinsten und großartigsten Menschen, die ich kenne. Als ich ihn jetzt in Zürich sprach, machte er einmal eine Bemerkung, die ihn mir ungeheuer lieb machte. Wir hatten sehr viel über Frick gesprochen und waren zu einer entschiedenen Ablehnung seiner Menschlichkeit gekommen. Ich meinte, es sei ja alles recht, wenn Frieda nur nicht, wie mir sicher ahnt, an seiner Seite sich unglücklich fühlte. Da sagte Gross: „Möchtest du etwa, daß sie mit diesem Mann glücklich wäre?“ – Mein Wunsch für Otto Gross ist, er soll sterben, ehe es Nacht wird.
München, Sonntag, d. 30. Juli 1911.
Immer noch, immer wieder die unnatürlichste Hitze. Man wagt sich kaum mehr auf die Straße, aber im Zimmer ist’s auch kaum besser. Daß nur bis zur Dresdner Reise eine Abkühlung einträte! Es wäre ja scheußlich, wenn wir die ganze Reise unter Stöhnen machen und gegenseitig Krankenwärter spielen müßten. – Gestern sah ich mein Puma weniger als in den letzten Tagen. Wir waren im Hofgarten beisammen, ich begleitete sie in die Türkenstrasse und fuhr dann zum Ungererbad. Nachher traf ich sie noch einmal auf der Straße und erläuterte ihr ihren Weg, indem ich sie in ein Auto setzte. Abends hatte sie mit den Strich-Brüdern etwas ausgemacht, und Strich telefonierte mich erst spät in der Torggelstube an, ich möchte in die Odeon-Bar kommen. Ich war aber in einer Gesellschaft, die mich schlecht abkommen ließ, und blieb deshalb, so sehr ich mich auch nach Lotte sehnte. Julius Muhr aus Wien war nämlich da, und hatte extra für mich Mumm anbringen lassen. Ich poussierte dabei heftig mit der kleinen Tänzerin, die ich neulich schon geküßt hatte. Sie war grade unwohl, sonst hätte ich das gute Puma wahrscheinlich heute nacht betrogen. Als die andern gegangen waren, ging ich noch zum andern Tisch hinüber, wo Wedekind mit dem eben von der Reise zurückgekehrten Steinrück, Arthur Fleischer und noch 2 Mitglieder des Hoftheaters saßen. Ich sprach mit Wedekind über Hardekopf, der mir jetzt ernstlich verfeindet zu sein scheint, da ich Emmys katholische Hysterien nicht feierlich genug nehmen konnte. Wedekind verglich ihn mit Recht mit seinem Bruder Donald Wedekind, der auch bei guten Anlagen niemals zur eigentlichen Produktivität kommen konnte. – Nachher war ich noch mit einem Teil der Gesellschaft, zu denen noch Geyer, Molnár, Polgar und Egon Friedell kamen – mit dem ich mich, wie einst in Wien, immer noch sehr amüsant herumfrozzele, im Café Orlando di Lasso. – Jetzt sitze ich (12 Uhr mittags) vor dem Tagebuch und warte, ob das Puma nicht vielleicht kommt. Es wäre schmerzlich, wenn ich bis nachmittags warten müßte, wo ich sie ja jedenfalls im Hofgarten sehn werde. – Aber Dresden! Da werde ich nicht zu warten brauchen: kommt sie – kommt sie nicht? Da wird sie gleich morgens an meiner Seite erwachen, da werden wir tagaus tagein beisammen sein – und da werden wir gemeinsam das Szenarium für die Detektiv-Operette entwerfen. Denn das Puma will mir helfen und hat schon jetzt recht hübsche Einfälle dazu geäußert. Das wird eine fröhliche Arbeit werden! Puma, geliebtes, süßes, himmlisches Puma!
München, Montag, d. 31. Juli 1911.
Wenn der Tag so weiter geht, wie er bis jetzt – es ist ¾8 Uhr abends – verlaufen ist, dann werde ich ihn als einen der guten Tage meines Lebens buchen können. Morgens holte mich Rößler zum Baden ab. Vorher gingen wir noch ins Café Stefanie. Vor der Tür begegneten wir Emmy. Wir grüßten beide, und Emmy dankte still, sodaß ich mich freute, daß sie kein Krampftheater aufführte. Als ich zwei Schritte gegangen war, fühlte ich mich plötzlich von hinten umgefaßt. Emmys Kopf lag an meiner Schulter, und auf der Straße gaben wir uns den Versöhnungskuß. Im Café erzählte sie mir dann, ihr habe geträumt, ich sei gestorben, und als ich dann in meinem grauen Anzug so vor ihr lag, sei es ihr schrecklich gewesen, daß sie sich nicht mit mir ausgesöhnt habe. Übrigens seltsam: Ich habe in der letzten Zeit – wohl, weil ich an das Glück mit dem Puma nicht glauben kann – so oft Todesgedanken gehabt, daß ich gestern für alle Fälle mein Testament gemacht habe. So habe ich doch die Sicherheit, daß mein literarischer Nachlaß nicht einmal in die Fänge meiner Mischboche fällt. – Nach dem Baden Mittagessen in der Torggelstube. Die Vallière war reizend, ich durfte graziös mit ihr zoten. Nachher saßen wir miteinander auf dem Sofa in der Nische des Cafés Orlando und spielten mit einem entzückenden weißen Zwergboxl. Ob Zufall, ob Absicht – ich weiß es nicht, bin aber eitel genug, eher an Absicht zu glauben: ihre Hand fuhr mir dabei in einer Weise zwischen die Schenkel, und blieb solange dort, daß ich meinte, mir müßten alle Hosenknöpfe abspringen. Als ich dann – wie unwillkürlich – mit meiner Hand in die Gegend ihrer engeren Weiblichkeit kam, fühlte ich deutlich die korrespondierende Bewegung ihres Unterleibs. – Trotzdem: daß aus uns zweien einmal – wenn auch nur ein einziges Mal – ein Paar würde, glaube ich nicht. Um die Frau zu kriegen, muß man Gelegenheiten schaffen, die sehr viel Geld kosten. – Im Hofgarten wartete ich vergeblich aufs Puma und ging dann zur Druckerei, wo ich Korrekturen und Revisionen der Nr. 5 las. Steinebach übergab mir einen Brief des Verlags Eckert, der bereit ist, mein „Glaube, Liebe, Hoffnung“ zu verlegen und als Subskriptionswerk herauszubringen. Ich soll ihm meine Bedingungen mitteilen. Ich werde, denke ich, ein für alle Mal 500 Mk fordern. Ferner teilt mir der Verlag mit, daß er geneigt sei, den Rest des „Kraters“ vom Morgen-Verlag zu übernehmen. Den hat leider schon Leon Hirsch über meinen Kopf weg erworben. Ich will das Eckert mitteilen und ihm die Neuherausgabe einer ausgewählten Sammlung meiner Gedichte vorschlagen. So käme ich vielleicht zu einem recht guten Lyrikband.
Ach ja, in der Torggelstube hatte ich den Direktor v. Rehlen von der Wiener Residenzbühne getroffen, der von den „Freivermählten“ gehört hat und mir Vorwürfe machte, daß ich ihm das Stück nicht eingereicht habe. Gewiß ein Unikum: ein Theaterdirektor, der den unaufgeführten Autor um ein Stück mahnt, statt sich einzukapseln, wenn es ihm gebracht wird. Ich habe das Stück gleich von Strauß geholt, zu dem ich sowieso mußte. Denn Rudolf Grossmann schrieb mir, daß ein österreichischer Genosse hier verhaftet sei, um den ich mich kümmern möchte. Dann brachte ich Rehlen das Stück ins Hotel. Er will es in der denkbar kürzesten Zeit lesen. Also vielleicht wird es noch in diesem Jahr mit meiner alten Berliner Freundin Käte Richter in der Hauptrolle der Alma aufgeführt. – Strauß regte mich außerdem noch an, einen größeren Wucherpump auf dem Wege der Lebensversicherung zu machen. Ich werde es wohl tun – da es 10–12000 Mk werden können. Also Glück über Glück! Aussicht über Aussicht! – und als ich nach Haus fuhr, vermißte ich nur noch eins: das Puma. Aber in der Elektrischen traf ich Strich, der mir erzählte, sie sitze im Stefanie. Dort telefonierte ich sie gleich an, erfuhr aber zu meinem Schmerz, daß sie nicht mehr dort sei. Fünf Minuten später kam sie, um ein paar Sachen zu holen, die sie bei mir eingestellt hatte. Ich trug sie ihr nach Hause, und bei ihr küßte sie mich herzlich und fest auf den Mund. Das war die Krönung des Tages – wie wird er ausgehen?
München, Mittwoch, d. 2. August 1911.
Ich fühle mich wie ein Bräutigam am Tage vor der Hochzeit. Ich lebe in ständiger Erwartung eines unerhörten Glücks. Das Puma tut dabei alles, diese Stimmung in mir zu erhalten und zu erhöhen. Als sie heut früh – ich war noch nicht aufgestanden – kam, um mich zu wecken, setzte sie sich auf mein Bett, küßte mich und schmiegte sich an mich wie ein kleines verliebtes Mädelchen, während sie doch sonst nie – selbst in den zärtlichsten Stunden kaum – ihre frivole Ironie verliert. – Strich ist heute früh – endlich! – abgereist. Nun ist die Gegenwart mein. Morgen geht die Reise los, – zunächst nach Nürnberg, dann wahrscheinlich nach Dresden, und schließlich wohl auch noch nach Berlin. Ich habe dem Puma noch allerlei schöne Sachen – fast eine ganze Aussteuer – geschenkt: das bischen Berner Geld giebt doch kolossal viel aus –, und nun bin ich in einem Taumel von Verliebtheit und närrischer Vorfreude. Die Brieftasche ist mit 400 Mk gefüllt, alle Vorbereitungen sind fertig, was sollte diesmal wohl feindliches sich ereignen können? – Zu allem Überfluß gewann ich gestern abend noch über 60 Mk beim Pokern, sodaß die Auslagen, die ich gestern auf der Dult für allerlei Schmuck hatte, reichlichst gedeckt sind. – Merkwürdig ist, wie mir stets, wenn es mir erotisch gut geht, das Glück auch bei andern Frauen winkt. Vorgestern lernte ich in der Torggelstube die allerliebste Maria Marlow vom Wiener Bürgertheater kennen. Ich freundete mich gleich mit ihr an, und wir vertrugen uns unter anzüglichen Witzen ausgezeichnet. Die Vallière küßte mich gestern abend auf den Mund. Lina Woiwode ist wieder da, und war nett zu mir. Käte Richter von der Wiener Residenzbühne, mein alter Berliner Schwarm, tauchte gestern auf. Sie ist das Verhältnis des Herrn v. Rehlen, der mein Stück leider abgelehnt hat. Er könne es zur Zeit nicht brauchen, vielleicht später, denn er finde es gut. Ich saß – das Puma, das sich gestern noch Strich widmen mußte, war nicht gekommen – zwischen Käte und der Vallière, meine Hände spannten sich jede über einen Frauenschenkel. Nachher wurde gepokert. Frau v. Hagen erschien mit Waldau. Ich saß neben Mimi Marlow, was mir wohltat, sodaß ich überlegt und sicher spielte. – Der Ton in der Torggelstube ist neuerdings ganz toll. Julius Muhr bemerkte neulich ganz zutreffend: „In diesem Lokal muß man, um sich beliebt zu machen, am Eingang gleich dreimal: Ficken! rufen.“ Ein sehr niedlicher Beleg dafür ergab sich beim Pokern. Es wurden arge Schweinereien geredet, über die sich die Frauen sehr amüsierten. Ich bekam schlechte Karten. Jemand fragte: „Mühsam, was ist?“ – Ich antworte: „Scheiße.“ – Mi v. Hagen meinte: „Na, nun fängt sogar Mühsam schon an, solche Worte zu sagen.“ – Der Nachbar fragte: „Was haben Sie denn?“ – und die Frau Baronin antwortete: „Auch Scheiße.“ – – Heut mittag aß ich mit dem Puma in der Torggelstube – auch gestern schon, wo wir mit Rößler, Eder und Elisabeth Steckelberg beisammen saßen –. Heut waren wir allein, da die Vallière anscheinend auf Lotte eifersüchtig ist und ich ihren Kreis nicht stören mochte. Dann gingen wir ins Orlando. Melanie Spielmann kam, erzählte mir von Frau Kornfeld, die sich in Berlin über mein Nichtschreiben gräme und sehr verliebt in mich sei. Ich schrieb ihr eine Ansichtskarte und stellte ihr in Berlin meinen Besuch in Aussicht. Die Spielmann war unglaublich geil auf mich und zeigte das so deutlich, daß das Puma sich kaputlachen wollte, und mich nachher beschwor, ich solle das arme Luder mit mir nehmen und vögeln. Sie werde sich so darüber freuen, daß sie schon heute nacht bei mir schlafen würde. Ich war aber zu verliebt ins Puma, als daß ich mich zu einem Piacere mit dem häßlichen Balg hätte entschließen können. Jetzt ist das Puma bei sich zuhause und packt. Abends holt sie mich ab. Und morgen, – ach, morgen!
München, Donnerstag, d. 3. August 1911.
Also heute soll die Reise losgehen – ob nachmittags oder abends steht noch nicht fest. Darüber entscheidet das Puma. – Gestern war ich sehr viel mit ihr beisammen. Abends waren wir im Cabaret Benz. Mein alter Cabaret-College von München und Wien, Karl Mersch[?] leitete die Conferenze und sang mit seiner mächtigen Baßstimme einiges. Ein paar schlechte Diseusen traten auf, eine ganz nette Ungarin sang Parodien. Mehrere Tanzstücke wurden aufgeführt, darunter sind zwei sehr schöne graziöse Engländerinnen zu erwähnen. Endlich produzierte sich ein Russe, namens Andréjé als telepathisches Medium. Die Leistungen selbst – nach dem Willen des andern handeln – waren gewiß ganz interessant, der Kerl hielt dabei aber so prätentiöse und dumme Reden, daß mir ganz schlecht wurde. Nachher fuhren wir in die Torggelstube, wo an einem Tisch die üblichen Pokerasten – mit Mimi Marlow – wirkten, am Haupttisch die Vallière mit Mann, Egon Friedell, Feuchtwanger und Weigert saßen. Friedell verliebte sich, als die Vallière gegangen war, prompt in Lotte, die schon etwas beschwipst war, und fingerte ihr mit seinen Fettpfoten fortwährend im Gesicht herum. Das Puma interessierte sich indessen mehr um den sehr pedantischen Feuchtwanger. Mir war nicht sonderlich wohl bei dem allen. Nachher waren wir alle noch im Orlando di Lasso, und dort wurde mir leider mein schöner Panamahut verwechselt – ich vermute von Friedell. Ich habe dafür einen schäbigen alten, dreckigen und fettigen Hut bekommen und bin sehr ärgerlich, da ich nun die ganze Reise in verminderter Eleganz machen muß. – Heut habe ich noch allerlei zu tun. Briefe, Zeitschriften zu erledigen (Nr 5 ist heraus und wird morgen plakatiert und vertrieben). – Und nun soll dies Tagebuch auch eine kleine Weile Ruhe haben. Ich will es nicht auf die Reise mitnehmen, damit es nicht etwa aus Versehen dem Puma in die Hände fällt. Auch hoffe ich, daß mir das Zusammensein mit Lotte nicht allzuviel Zeit zum Einschreiben lassen wird. Adjö, München!
München, Sonntag, d. 13. August 1911.
Zurück. – Und soll nun erzählen, was ich erlebte in 1½ Wochen, die zu den schönsten meines Lebens zählen? Nein! Alles beste soll bei mir bleiben, immer nur in der Verschwiegenheit meines Gedenkens, und nur Tatsachen – Gott, wie nichtig sind Tatsachen! –, nur Tatsachen will ich hier buchen.
Nach der letzten Eintragung erlebte ich noch aufgeregte Stunden in München. Lotte wollte um 3 Uhr bei mir sein. Schon vor zwei Uhr zitterte ich, sie könnte sich’s noch überlegt haben, und jede Minute erhitzte meine Angst. Sie kam gegen ½ 4 Uhr. Die Stunde vorher dauerte länger als die 10 Tage bis gestern – viel, viel länger. Abends fuhren wir – bis Nürnberg, wo wir im „Kaiserhof“ ein Doppelzimmer nahmen. Kunstmaler Walter Mühsam und Frau aus Berlin! Ehe wir schlafen gingen, suchten wir noch Bummellokale auf – und fanden den „Wintergarten“, ein elegantes Tanz-Etablissement im Pariser Monsieur-Stil, wo sich außer einigen dürftigen Sängern und Chansonetten unterschiedliche Solotänzer und Tanzpaare produzierten. – Über die Nacht und die weiteren Nächte kein Wort. Das ist mein, und um das im Gedächtnis zu halten, dazu bedarf ich keiner Notizen. Am andern Tag Rundfahrt durch Nürnberg, mit Besichtigung der S. Sebaldus-Kirche, die ganz wie eine Jahrmarktsbude Eintrittsgeld erhebt. Am Eingang stehn Tische, an denen Ansichtskarten verkauft werden. Abends gingen wir ins Stadttheater, wo wir eine Operette „Die keusche Susanne“ sahen. Kein Meisterwerk, aber lustige Stellen, die das Puma manchmal bis zum Weinen ins Lachen brachten. Ich staunte über den Prachtbau des Theaters. Danach wieder Wintergarten – und am andern vormittag Abreise nach Dresden. Im Coupé traf Lotte eine Freundin, die Lillith heißt und im Wolfskehl-Kreis verkehrt: sie sieht recht gut aus. In Bamberg verließen wir sie, da wir dort umsteigen mußten. Da beide Züge keine Speisewagen hatten, konnten wir bis abends gegen 6 Uhr nichts zu essen bekommen. Es war qualvoll. Endlich wurde bei Reichenbach ein Speisewagen angehängt, sodaß wir, als wir in Dresden ankamen, schon etwas im Leibe hatten. Wir bezogen das Hotel „New-York“, wo wir unter unsern richtigen Namen zwei Zimmer nebeneinander hatten. Am gleichen Abend noch gingen wir in die Hygiene-Ausstellung, wo ich von Lotte eine Silhouette schneiden ließ. Sie fiel reichlich schlecht aus. Als wir im Park spazieren gingen, rief uns ein junger Mensch, der mit zwei Damen ging nach: „Das ist ja die Lotte mit dem Erich Mühsam.“ – Ich kannte ihn nicht. Wir waren froh, keine Bekannten zu sehn. Es gab dort die Ausstellung eines indischen Dorfs, das wir uns ansahen. Ein kleines zartes Inderweib erregte Lottes Bewunderung in solchem Maße, daß sie ihr eine ihrer kleinen Silberdosen und ein größeres Geldstück schenkte. Wie die rührende wundervoll schlanke und grazile Inderin das Geschenk nahm, das war so ergreifend, daß Lotte in Tränen ausbrach. Ich habe sie nie mehr geliebt als in diesem Moment. – Nachher fuhr uns eine Droschke zu einem Nachtkaffee. Dann begann die dritte Nacht. Am andern Tage waren wir auf der Vogelwiese, ein köstlicher Jahrmarkt, noch ganz im alten Stil. Karusselfahren, Rutschbahnen und ähnliches macht uns beiden keinen Spaß. Aber wir verwürfelten eine Menge Geld, trugen aber auch als Ertrag mehrere Paare Manschettenknöpfe, von denen ich eins trage, eine Brosche und sonst noch Kleinigkeiten heim. Dann sahen wir uns die Siamesischen Zwillinge an, und da uns von diesem widerwärtigen Phänomen wohl noch nicht übel genug war, gingen wir auch noch in eine anatomische Bude, wo Lotte sich über die lustigen Embryonen amüsierte, dagegen die Wachsnachbildungen kranker Gliedmaßen und Eingeweide sie ebenso wie mich in einer Weise anekelten, daß sich uns fast der Magen umgedreht hätte. Als wir uns erholt hatten und wieder frisch und fidel waren – trotz der hahnebüchenen Hitze, die uns den ganzen Weg begleitete, und die nun über einen Monat ununterbrochen anhält –, ließen wir uns von einem dort postierten Photographen typen. Es ist ein köstliches Bildchen geworden, ganz primitiv, mit einem Glasrahmen darum: „Erinnerung an die Dresdener Vogelwiese“. Wir sehn aus wie ein richtiggehendes Brautpaar. Das Bild steht schon vor mir auf dem Schreibtisch. – Gegen Abend fuhren wir wieder in die Ausstellung. Diesmal sahen wir uns in einem Zelt marokkanische Bauchtänzerinnen an. Währenddem trat der Jüngling, der uns tags zuvor angerufen hatte, an uns heran, nannte seinen Namen – mir scheint Busse – behauptete, mit mir öfters Billard gespielt zu haben und auch Lotte zu kennen und setzte sich ungebeten und obgleich ich ihm gesagt hatte, daß ich mich seiner nicht erinnere, zu uns an den Tisch, wo er gleich anfing, mich unendlich viel zu fragen. Ich ließ ihn derartig abfahren, daß er seine Unerwünschtheit bald merkte und beleidigt aufstand. Ich schenkte Lotte noch einige Gebrauchsdinge, einen Hut und aller[l]ei fürs Kleid. Einen Teil des Tages und den späten Abend brachten wir im Caféhause zu, die vierte Nacht war da. Am nächsten Nachmittag war die Abreise festgesetzt. Ich hatte an Franz Diederichs geschrieben, der mich antelefonierte und mich bat, ihn von der Redaktion der „Dresdner Volkszeitung“ abzuholen. Nachdem ich Lotte in die Galerie gefahren hatte, wo ich selbst noch die Sixtinische Madonna betrachtete, die mich kalt ließ, und einige schöne Botticellis sah, ging ich zu ihm. Wir aßen zusammen Mittag. Ein sehr sympathischer Herr von etwa 50 Jahren. Wir unterhielten uns über vielerlei. Er brachte mich auf den Gedanken, einen “Kain-Kalender“ herauszugeben und erzählte, daß Glasbrenner ähnliches gemacht habe. Ich will morgen mit Steinebach drüber reden. Ferner riet er mir sehr zu einem neuen Gedichtband, einer Zusammenfassung aus der „Wüste“ und dem „Krater“ und meinte, daß nach dem „Zukunft“-Protest ein Totschweigen meiner Lyrik in der Presse nicht mehr möglich sei. Er kündigte für eine der nächsten Nummern des „Literarischen Echos“ eine Besprechung des „Kraters“ an, die schon sehr lange dort läge, und von der er jetzt die Korrektur bekommen habe. Sehr erfreulich. – Ich holte dann Lotte aus dem gewohnten Kaffee ab und wir gingen heim packen. Ich kann nicht leugnen, daß es nicht beim Einpacken blieb. Wir hatten uns noch einmal lieb, denn in Berlin – das hatte Lotte von Anfang an gesagt – werde die Hochzeitsreise zu Ende sein. Endlich fuhren wir los und kamen gegen 8 Uhr am Anhalter Bahnhof an. Ich brachte unsere Effekten ins Hotel Bismarck, da Lotte mir noch eine Nacht bewilligt hatte, und Lotte erwartete mich dann im Café des Westens. Dort trafen wir alle möglichen Bekannten wieder, vor allem Spela, die also nicht gestorben ist, sondern, da sie sich nicht mehr anmalt, viel besser aussieht als früher und René Schickele, den ich, als er vor 3 Jahren nach Paris abfuhr, zuletzt gesehn hatte. Er beschimpfte mich wegen der rumänischen Deserteure, die ich ihm kürzlich zugeschickt hatte, und durch die er sehr große Unannehmlichkeiten hatte. Hubert war da, Höxter und Brann, und schließlich gingen wir noch zu Bols. Als ich um ½ 4 Uhr nachts mit dem Puma zum Hotel am Knie fuhr, war sie totmüde und bat mich, sie die Nacht allein zu lassen, da sie zu abgespannt sei. Ich möge erst morgens zu ihr kommen. Wie sie mich beim Gute Nacht sagen küßte, das zeigte mir deutlich, daß sie andre Gründe wirklich nicht hatte. Morgens kam ich dann noch zu ihr ins Zimmer und ins Bett – und das war nun wirklich das letzte Mal, daß ich diese unendliche Süßigkeit genießen durfte.
Jetzt begann der Berliner Betrieb mit seiner Geschäftigkeit und Nervosität, erschwert immer wieder durch die bodenlose unerhörte Hitze, die uns schon ganz hat vergessen lassen, was Regen überhaupt ist. Lotte sah ich täglich im Café, und sie war nett und ungeheuer lieb mit mir, besonders wenn wir allein waren. Sonst durfte nichts Auffälliges geschehn, da Strich viele Freunde hat. – Ich war also draußen in Waidmannslust, am andern Tage suchte ich die Herren Eckert und Co (die Compagnie heißt Schwartzkopf) auf, und nun hatte ich mit der Bande genug zu tun. Es wurde geschachert und gehandelt, und das Ergebnis ist, daß ich jetzt einen Kontrakt in der Tasche habe, nach dem ich das Buch „Glaube, Liebe, Hoffnung“ an den Verlag für 500 Mk mit allen Rechten (außer dem Aufführungsrecht) abgebe. Leider erhalte ich erst 50 Mk, da die Gesellschaft einen großen Dalles zu haben scheint. Ich hörte zu, wie Schwartzkopf am Telefon einen Geldgeber bewegen wollte, für die Sache Geld zu lockern und wäre vor Lachen fast geborsten, wie er die Aussichten übertrieb, erlogene Zahlen nannte und dgl. – Ich betrachte das Geld als gefunden, da ich längst verzweifelt hatte, für die Arbeit noch mal Geld zu sehn. Von der Deutschen Montagszeitung holte ich mir 25 Mk, die, was ich garnicht wußte, für mich noch gut waren. Die 100 Mk vom alten Verlag des Blattes, hieß es, seien auch ganz sicher. Tant mieux. Bei Hans war ich erst vorgestern, spät abends. Er schimpfte über den „Kain“. Im Gefängnistagebuch kommt einmal das Wort „Pferdeärsche“ vor. Mein Bruder ist tief empört über den Ausdruck und erklärte, er könne seiner Frau das Heft deswegen nicht zeigen. Gestern war ich mit Lotte bei ihm, die sich eine Brandnarbe operieren lassen will. Er lud uns zum Kaffee ein. Das Puma machte sich nachher weidlich lustig. Zum Abendbrot hatte mich gestern Lottes Mutter, „die alte Pumerin“ eingeladen. Eine köstliche Frau, Lottes Vertraute in allen Liebesdingen. Eine so tolerante und verständige Mutter wird nicht so leicht zum zweiten Mal gefunden werden. Um 10 Uhr 30 fuhr ich ab, nachdem mich das liebe teure Puma noch an den Bahnhof begleitet und dort mit einem guten Kuß verabschiedet hatte. Ich konnte auf der Fahrt zur Bahn kaum sprechen. So nahe ging es mir, mich jetzt für 2–3 Monate von Lotte trennen zu müssen. – Ich mußte dritter Klasse fahren, weil von den 500 Mk, die ich mit dem, was ich in Berlin einnahm, die Zeit hindurch gelebt hab, nur noch 25 Mk hatte. Jetzt habe ich keine 3 mehr, kann mir aber von der Deutschen Bank noch holen, was morgen geschehn soll. – Ich bereue die Ausgaben nicht. Davon hatte ich wirklich etwas, und das Puma brauchte nichts zu entbehren. Wie bin ich dem lieben starken schönen klugen feinen Mädchen dankbar! Wie hat sie mich bereichert und beglückt! – Gestern abend erzählte sie mir noch ganz stolz, daß sie mir, seit sie in Berlin sei, noch immer treu sei. Ob es jetzt noch stimmt, da ich dies schreibe? – Sie soll leben; ich will es auch!
Vieles glaube ich, habe ich noch einzutragen vergessen. Es wird nach und nach noch manches folgen müssen. Nur ein Name sei schnell notiert, der wohl noch häufiger von jetzt ab ins Tagebuch geschrieben werden wird: Ella Bardt.
München, Montag, d. 14. August 1911.
Ella Bardt kenne ich schon seit Jahren. Sie war Schauspielerin bei Reinhardt, und ich habe sie in „Frühlingserwachen“ und in andern Stücken manchmal spielen sehn und stets für eine entschiedene Begabung gehalten. Jetzt traf ich sie im C. d. W. wieder. Sie kam in Begleitung der reizenden blonden Anny Rawenitz und sah mit Schnecken vor den Ohrmuscheln besser aus, als ich sie früher je fand. Zum ersten Mal fiel mir auf, daß sie keineswegs das häßliche Mädchen ist, als das man sie verschreit, und daß ihr Gesicht trotz der etwas dicken Nase ganz reizenden Ausdruck hat. Ihr Mund und ihre Augen sind überaus anziehend, kurzum ich interessierte mich für sie und ging ein längeres Gespräch mit ihr ein, in dessen Vorlauf uns beiden warm wurde. Mir stieg der Wunsch auf: die müßte nach München, und als ich es ihr sagte, war sie Feuer und Flamme, kurzum: ich gab ihr das gleiche Versprechen, wie bei meinem letzten Berliner Besuch der schönen Krissa v. Siewers (die ich nicht sah und von der ich mit Entsetzen hörte, daß sie engstens mit Harry Kahn liiert sei). Ich werde mich bei Steinrück und Basil sehr ernsthaft für Ella Bardt ins Zeug legen und wäre glücklich, wenn es mir gelänge, ihr hier ein Engagement zu verschaffen. Das arme Mädel hat nämlich Pech gehabt. Sie war zuletzt bei Karlheinz Martin am Frankfurter Komödientheater engagiert, wo sie große Rollen spielte und gute Erfolge hatte. Das Theater ging pleite, da die Frau des Direktors (die Carlsen) mit dem ersten Liebhaber durchbrannte und ihr vom Gericht das Kapital, das sie in die Ehe gebracht und ins Theater gesteckt hatte zugesprochen wurde. Nun ist Ella Bardt ohne Engagement und grämt sich im Caféhause. Kommt sie nach München, ist ihr geholfen und die Freundschaft, die wir jetzt geschlossen haben, könnte leicht die Formen einer Liebe annehmen, die – das übersehe ich völlig – keine leere Spielerei bleiben würde. – Eines Abends fuhren wir alle – Lotte war dabei und der Chefredakteur des „Berliner Börsen-Couriers“, Dr. Haas, in die Nollendorf-Bar. Lotte und Ella verliebten sich prompt ineinander und küßten sich im Auto, daß es eine Freude war zuzusehn. Die Gefahr dabei ist nur, daß Lotte das als ganz harmloses kleines Intermezzo nimmt, während es bei Ella alle Anzeichen einer großen tiefen Liebe trug. Nachher begleitete ich sie heim. Wir gingen eng umschlungen durch die Straßen, nachdem wir Lotte in der Marburgerstrasse, wo sie ein Zimmer gemietet hatte, und Anny Rawenitz in der Kantstrasse abgesetzt hatten. Küssen ließ sich Ella nicht von mir, aber sie zeigte deutlich Zärtlichkeit für mich, und das „Du“, in dem wir miteinander sprachen, war Notwendigkeit und wird sicher als Zeichen unserer neuen Freundschaft beibleiben. – Noch heute will ich versuchen, Steinrück zu erreichen.
Hier in München scheint alles beim Alten. Im Café sah ich gestern nur Bing mit der Huber. In der Torggelstube Feuchtwanger und Hartmann. Als ich fortging, mahnte mich Rauschenbusch um die 25 Mk, die er mir vor gut einem Jahr geliehen hat. Ich werde sie ihm demnächst zurückgeben. – Heut früh holte ich mir 150 Mk von der Deutschen Bank, da ich garnichts mehr hatte und Lotte 25 Mk schicken will. Dann ging ich ins Luitpold. Dort traf ich die beiden Wiener Tänzerinnen vom Künstlertheater, deren eine ich kürzlich in der Torggelstube so intensiv geküßt hatte. Ich lud sie zum Essen zu mir ein und es war sehr lustig. Beide – sie heißen Sonja Palm und Anny Remeau – wollen ans Cabaret. Ich versprach ihnen Chansons, die sie sich einzeln abholen sollen. Daß sie mir meine Mühe in recht süßer Weise honorieren werden, scheint mir sehr wahrscheinlich. Hoffentlich macht mir mein Magen keinen Strich durch die Rechnung. Ich entdeckte nämlich beim Stuhlgang heute zu meinem Entsetzen, daß ich einen richtigen Bandwurm habe. Herrgott, wie widerlich alle solche Störungen sind – und wie unappetitlich diese speziell. – Nachdem wir oben in Rößlers Stube allerlei Unfug verübt hatten – die Mädels brachten sein Bett in Unordnung, sodaß es stark nach Orgien aussah, und nachdem ich speziell die hübsche schlanke, englisch aussehende Anny mächtig abgeküßt hatte, fuhren wir ins Orlando di Lasso.
Von da aus ging ich zu Steinebach. Soviel ist sicher: er wird den „Kain“ vorerst nicht eingehn lassen. Auch ist er mit der Idee des „Kain-Kalenders“ einverstanden. Jetzt will ich an die Arbeit. Ich muß noch heut für den „Sozialist“ einen Artikel schreiben und abschicken, dann an das Libretto fürs Künstlertheater gehn, das ich doch allein machen muß. Ich habe die Absicht, von jetzt ab jeden Tag einige Stunden regulär zu arbeiten. Ob ich es durchführen werde?
München, Dienstag, d. 15. August 1911.
In Berlin erhielt ich einen nachgesandten Brief von Wedekind. Darin beglückwünscht er mich zur Entwicklung des „Kain“, den er speziell stilistisch außerordentlich gut findet und schickt mir ein „Memorandum“, betitelt als „Zensurbeirat“, das ich als Material für mein Blatt verarbeiten soll. Es greift zwei Professoren wegen ihrer Gutachten über seinen „Totentanz“ an. Ich habe ihm geschrieben, daß ich das Manuskript am liebsten in seiner eignen Fassung brächte und erwarte nun seine Einladung zum Rendezvous. – In der Torggelstube war es sehr lustig gestern. Egon Friedell war ganz auf der Höhe, und wir amüsierten uns – auch Rößler und Feuchtwanger nahmen daran teil, indem wir Dramentitel erfanden und den Autor dafür ermittelten, bzw. für gewisse Autoren Titel ersannen. Nachher deklamierte Friedell den Tasso, wie er lauten würde, wenn er von Shakespeare wäre. Seine Fähigkeit, die Shakespearesche Sprache aus dem Stegreif auf bekannte Verse zu okulieren, ist fabelhaft. Ich erinnere mich aus der Wiener Zeit, wie er alle möglichen Zitate und lange Dramenstellen variierte, indem er die Sprache andrer Dichter darauf anwandte. Später kam Weigert und Frau, dann – an einem andern Tisch – die beiden Damen, die mittags bei mir gewesen waren, in Begleitung einer schauderhaft häßlichen Person, namens Trenk, die Friedell zu poussieren begann. Nachdem sie gegangen waren, drückte ich mich auch bald und ging zeitig schlafen.
München, Mittwoch, d. 16. August 1911.
Ein bösartiger Schnupfen, dessen ärgste Schrecknisse jetzt überwunden scheinen, vergällt mir ein wenig das Leben, das jetzt recht arbeitsam werden muß, will ich alles recht machen, was ich mir vorgenommen habe, und will ich das Wohlleben, an das mich das Berner Geld gewöhnt hat, zu einer dauernden Institution meines Wandels machen. Von dem Rest verlor ich gestern zu allem Überfluß 60 Mk beim Vingt-et-un, zu dem mich abends im Stefanie Feuchtwanger verleitete. Ein paar fade Spießer, die an den Tisch kamen und sich am Spiel beteiligten, schnappten das köstliche Metall.
Nachmittags war ich heimgekommen – nachdem ich mit dem plötzlich hier aufgetauchten Polen Justmann – den ich in Berlin kennengelernt hatte –, ein öder Geselle –, Schach gespielt hatte. Auf der Straße begegnete mir Hanns Fuchs, ein Bekannter aus dem Hirschfeldkreis in Berlin, ein tuntiges Rindvieh, der berichtete, daß er eben Wedekind vor meine Haustür begleitet habe. Als ich die Treppe hinaufkam, stand Wedekind vor der Wohnungstür. Wir besprachen dann in meinem Zimmer sein Memorandum, das, wie er erzählte, später als Vorwort zu seinem nächsten Buch Verwendung finden soll. Es ist aber hübsch von ihm, daß er es mir zur Veröffentlichung überläßt. Ich glaube, es wird dem „Kain“ sehr nützen, und die Presse wird ihre Taktik, das Blatt totzuschweigen, diesem Beitrag gegenüber kaum fortsetzen können. – Wedekinds Frau ist in diesen Tagen von einem Mädchen entbunden worden, das, wie mir Wedekind erzählte, die Namen Fanny Kadidja führen soll, die Frauennamen aus „Hidalla“ und „Zensur“. – Abends war ich in der Torggelstube mit Wedekind, Weigert und Freundin, Fuchs und Feuchtwanger. Es wurde lebhaft geredet. Weigert erzählte folgende hübsche Anekdote (ein komischer Mensch, dessen ganzer Wert in der Beherbergung unzähliger Anekdoten besteht, und der sonst von ungeheurer Blödheit ist): Als Richard Strauß hier mit dem Hoftheater-Orchester die „Salome“ studierte, wollte eine Stelle absolut nicht so klappen, wie der Komponist sie wollte. Er ließ sie immer wieder repetieren, bis schließlich ein Mitglied des Orchesters aufstand und sagte: „Geben Sie sich keine Mühe, Herr Doktor. Die Stelle ist schon im „Tristan“ nicht gegangen.“
Ich ging nachher noch mit Fuchs in ein Caféhaus, der mir, da ich durch den Spielverlust ganz blank war, 3 Mark pumpte. Heut vormittag traf ich ihn und lud ihn zum Essen zu mir ein. Er redet – wie vor Jahren schon – ausschließlich vom Hause Wahnfried (ich nenne es gern „Größenwahnfried“) und renommiert damit, daß er mit Siegfried Wagner ein homosexuelles Verhältnis hatte.
Johannes schreibt eine Karte aus Senniswald-Grünen im Emmenthal. Ich habe keinen Dunst, was er und Iza weiter beabsichtigen. Papa schickt eine Ansichtskarte. Er ist wieder in Lübeck. Ein Leipziger Verleger macht mir den Vorschlag, ich soll (für sehr billiges Geld) einer Berliner Zeitschrift regelmäßig satirische Gedichte schicken. Er verlangt für seine Vermittlung die Kleinigkeit von 25%. Unverschämtheit! – Mit Steinebach beredete ich heute ausführlicher die Kalender-Idee. Ich muß sehr bald an die Arbeit. Inzwischen habe ich gestern den ersten Akt des Operetten-Librettos im Szenarium entworfen. Sobald ich den Entwurf fertig habe, und er angenommen wird, hoffe ich auf tausend Mark Vorschuß. Dann kann wieder eine kurze Zeit festlichen Schlemmerlebens beginnen!
Eine Karte von Beatrice Pallon wurde mir im Stefanie übergeben. Ich soll sie an Ernst Frick weiterbefördern. Ein willkommener Vorwand, an Frieda zu schreiben, was jetzt gleich geschehen soll.
München, Donnerstag, d. 17. August 1911.
Mit dem Schnupfen geht es besser. Dagegen macht sich der Bandwurm in recht peinlicher Weise bemerkbar. Er verlegt mir den Appetit, verursacht Kopfschmerzen, treibt mir den Schweiß aus den Poren und hält fortwährend das Gedächtnis am Mastdarm fest, in dem es peinlich genug hergeht. – Da mir ein Apotheker erklärte, die eigentlich wirksamen Mittel gegen Bandwurm gebe es nur auf ärztliche Verordnung, werde ich wohl morgen wieder mal Hauschild aufsuchen. – Das lästigste ist, daß mich das widerliche Vieh vom Arbeiten fernhält. Ich fühle mich so benommen, daß es mich nie lange am Schreibtisch hält.
Gestern nachmittag traf ich im Stefanie den Maler Hollitzer, der mich zum Abendbrot ins Hoftheater-Restaurant einlud. Dann waren wir in der Torggelstube: Weigert, Friedell, Fuchs, Polgar, Dr. Brecher. – Fuchs ist ein übler Geselle. Seine homosexuellen Renommistereien machen auf alle einen sehr üblen Eindruck. Heut war ich nach Tisch im Orlando di Lasso: Meßthaler, Weigert, Steinrück, Rosenthal, Strauß, Dr. Gotthelf, Polgar. Ich spielte mit Gotthelf Schach.
Die „Münchener Illustrierte Zeitung“ bringt das Bild der Kegelgesellschaft mit einem recht dummen Text. Ich muß mir um den Anarchisten mal wieder Anführungsstriche gefallen lassen. Lotte fand mich auf der Photographie seinerzeit „leicht bedeutend“ aussehend.
Mit Steinrück sprach ich über Ella Barth (sic). Leider macht er garkeine Hoffnung, daß sie hier ans Hoftheater engagiert werden könnte. Grade für ihr Fach sei die Michalek gewonnen. Er bedauerte es selbst, da er niemand lieber als sie hierher empfohlen hätte. Schade.
Von Margrit Faas ein Brief. Sie will im Oktober herkommen und hier sprechen.
München, Freitag, d. 18. August 1911.
Ich muß meine Zeit anders einteilen. Vor allem muß ich mich an früheres Aufstehn gewöhnen. Sonst kann ich mit den vielen Aufgaben, die ich mir gestellt habe, nicht fertig werden. Jetzt ist es schon wieder 4 Uhr nachmittags, und ich habe heut noch nichts getan. Zwar fühle ich mich sehr erfrischt durch das Bad, zu dem mich Rößler mittags verleitete. Es war ungemein wohltuend, in den herrlichen Bassins des Ungererbades herumzuschwimmen, und grade jetzt, wo die Hitze vorbei ist und das wundervollste frische Wetter im Sonnenschein schwelgt, ist der Genuß, nackt im Freien zu sein, doppelt groß. – Es war nicht übermäßig voll im Bad. An Bekannten traf ich nur den jungen Robert Halbe und Olaf Gulbransson. Nach Tisch ging ich in den Hofgarten, wo ich mit Hertzog und Heinrich Mann zusammen war. Mann hat ein neues Stück geschrieben, das er dem Hoftheater eingereicht hat. Jetzt fällt mir die angenehme Aufgabe zu, bei Steinrück anzuklopfen, wie es mit der Annahme steht. Dann traf ich Ludwig Thoma, der mich herzlich nach Tegernsee einlud. Ich will demnächst mal wieder hinausfahren. Vormittags telefonierte ich mit dem Moggerl. Sie erzählte, daß Moissi hier sei und an den Proben zur „Orestie“, die am 27ten, in der Musikfesthalle in Szene gehn soll, teilnimmt. Ich versprach ihr, in diesen Tagen mal zu einer der Proben zu kommen, wo man sie täglich finden kann.
Eine Karte von Lotte und Ella Barth, an der auch Dr. Haas und Spela angeschrieben haben, macht mir Freude. Das gute Puma hat so eine entzückende Art, mir zu verstehen zu geben, daß sie mich gern hat. „Wenn Du jetzt hier wärst, würde ich vielleicht liebenswürdig zu Dir sein.“ Ella Barth schreibt u. a.: „Tu alles für mich, denn ich möchte zu gern mit Dir – –“ Zum Schluß: „Ich küsse Dich, wohin Du willst.“ Das ist ja wohl ironisch gemeint, aber ich bin so eitel, ein Spürchen Ehrlichkeit dahinter zu vermuten. Unendlich schade, daß ich sie nicht gleich herbeordern kann.
Nun muß ich an die Arbeit, zuerst aber mal eine Menge Korrespondenzen erledigen. Der Genosse Müller schickt mir den Bürstenabzug eines Artikels „Autorität“, den ich für den „Sozialist“ geschrieben habe. Ich muß gleich Korrektur lesen. Dazu ein längerer Brief, in dem er sich über das Verhalten der Münchner Genossen, besonders Kindlers und Zenkers beschwert, die noch Schulden beim S. B. haben. Ach, daß ich ihm so garnicht tröstlich antworten kann! Die Bewegung ruht hier völlig. Seit auch Morax nicht mehr mittun will, bin ich ganz entmutigt. Aber ich will mich wegen der Margrit-Versammlung mit Ertl in Verbindung setzen. Es ist kläglich, wie wenig Idealismus in den Menschen ist! – – Dann muß ich an Johannes schreiben, der schon böse auf mich sein wird. Und dann weiter an dem Libretto-Entwurf arbeiten, dessen erste zwei Akte ich heut abend Rößler vorlesen soll. Ich bin sehr neugierig auf sein Urteil. Ich hoffe, er wird das, was bis jetzt da ist, billigen. Ist dann auch Sobotka einverstanden, so will ich den Drei-Masken-Verlag um einen ordentlichen Vorschuß prellen.
München, Sonnabend, d. 19. August 1911.
Die Arbeit ist noch immer nicht weiter gediehen. Denn als ich gestern anfangen wollte, begrüßte ich vom Fenster aus Rößlers Freundin, Frl. Consuela Diekmann, den „Consul“. Ich lud sie zum Kaffee ein und sie blieb längere Zeit bei mir. Ein allerliebstes Geschöpf. Sehr groß, schlank, sehr großer Kopf, weiße Haut, sehr volles weiches dunkelblondes Haar, schöner Mund mit prächtigen weißen Zähnen, und große ausdrucksvolle, ins Grünliche schillernde Augen. Starke, aber gut geformte Hände und recht sympathisches Benehmen. Rößler schimpft auf sie, weil sie so anständig sei, er brauche eine „Toppsau“: „Bei der würde ich ewig bleiben.“ – Mir gefällt aber grade des Consuls zurückhaltende Art, sich frei zu benehmen. Abends aß ich mit ihr und Rößler oben bei Rößler Abendbrot, und erst jetzt wagte ich, mich dem Mädchen erotisch zu nähern. Das geschah in der Form, daß ich mit ihr Ehemann-Betrügen spielte. Ich nahm sie um die Hüfte, küßte sie auf Stirn und Wangen – den Mund gab sie noch nicht her dazu und sagte ihr, während Rößler einmal hinausgegangen war, sehr viele werbende Artigkeiten. Heut will sie mich zum Hofgarten abholen. Ob es mir gelingen wird, sie zu verführen, ist sehr fraglich, Rößlers wegen brauchte ich mich nicht zu besinnen. Dem wäre es nur recht, wenn der Consul ein wenig vom Pfad ihrer tugendlichen Treue abgebracht werden könnte. Außerdem – armer Strich! – bin ich in dieser Hinsicht ja auch sonst nicht bedenklich. – Um 4 Uhr soll ich dann ins Orlando, wo ich mit Lulu Strauß über die Lebensversicherungs-Geldgeschichte reden soll. Nachher zur Druckerei, um Wedekinds Memorandum, das er mir jetzt in der endgültigen Form gesandt hat, abzuliefern. Da ich auch noch Correspondenz zu erledigen habe – von Kätchen Brauer kam eine Karte aus Ilmenau, wo sie am Kurtheater spielt; die muß beantwortet werden – sehe ich auch heute wieder die eigentliche Arbeit in den Hintergrund geraten. – Von Mimi Marlow erhielt ich gestern nacht den Auftrag, ihr einen Vortrag zu dichten, da sie in einigen Tagen in Franzensbad auftreten soll. Ich habe es, da ich auf 100 Mk hoffe, übernommen, weiß aber bis jetzt nur den Refrain: „Jedoch er dachte nicht daran.“
Heut vormittag telefonierte mich Emmy aus dem Café Stefanie an, ich möchte hinkommen. Sie wollte mich blos mal wiedersehn und war sehr nett. Ihr religiöser Wahnsinn scheint ganz vorbei zu sein, sie spricht und tut wieder ebenso frivol wie früher. Mich beschäftigt, was sie über Uli sagte. Die ist mit Seewald nach Hiddensee gereist. Wie Emmy behauptet, ist der Maler Thesing mitgefahren, mit dem sich Uli zu unser aller Befremden sehr angefreundet hatte. Emmy fürchtet, daß der, der garkein Geld hat und auch keins verdient, ganz auf Seewalds Kosten lebt, und meint, daß Uli völlig in seinem Bann sei. Uli und Thesing beabsichtigen, ohne Seewald, aber auf seine Kosten nach Paris zu reisen, und da Thesing ganz gewissenlos sei, sehe sie Schlimmes für Uli daraus erwachsen. Sie hat ihre Kenntnisse von Bolz, der Thesings Intimus ist. – Natürlich sieht Emmy Gespenster, aber gefallen will auch mir die ganze Sache garnicht, und ich fürchte, daß das Verhältnis mit Seewald, durch das Uli zum ersten Mal eine gesicherte Existenz hat, arg gefährdet ist. Daß sie sich mit dem Klotz Thesing eingelassen hat, gehört schon in ihre absonderliche Art hinein. Wenn sie nur nicht wieder zu dem verdammten Morfium zurückgreift! Mir schien in der letzten Zeit vor meiner Reise, daß ihr Nervenzustand wieder sehr derangiert und also für das Gift prädestiniert war. – Aber Emmy erzählt von Hardekopf, dessen Menschenscheu mir auffiel, als ich ihn neulich in der Torggelstube kurz sprach, – er fange an, Morfium zu spritzen. Das fehlte dem armen Jungen blos noch. Dann ist es ganz aus mit ihm. Er ist ein Opfer dessen, was er seinen Stil nennt. Ich nenne es Pose.
München, Sonntag, d. 20. August 1911.
Ich bin sehr in Sorge um Johannes. Er hat lange nicht geschrieben, und ein Brief, den ich an die letzte Adresse, die er angab, in Senniswald richtete, kam zurück mit dem Vermerk: „Abgereist“. Was mag das sein? Hoffentlich braucht er bald Geld und schreibt. Jedenfalls will ich morgen bei den Züricher Freunden anfragen. Inzwischen laufen allerhand Briefe für ihn ein, da er meine Adresse zur Nachsendung seiner Post angegeben hat. Vielleicht trifft er eines Tages persönlich bei mir ein. Das wäre eine Freude! Sonst aber ist es unverzeihlich, daß er mich so im Ungewissen läßt ... Von Landauer ist ein Brief an ihn dabei, der wohl die Versöhnung betreibt.
Gestern war ich mit Consul, der indischen Braut, im Hofgarten. Ein wirklich nettes Mädel. Ich unterhielt sie mit meinen Theorien über sexuelle Treue. Ein bewährtes Anknüpfungsthema. Sie war sehr interessiert. Nachher Café Orlando di Lasso. Nachmittags machte ich das Vortragsgedicht für die Marlow. Abends: Torggelstube. Auf dem Weg dorthin traf ich Gerta Fehl, die schon wieder vor Pech und Tragik schwitzt. Ihr Mann ist vor der Familie von den Toten wieder aufgestanden. Sie hat ihm eine Schußwunde in die Stirn geschnitten, ihn verbunden und nach Wien geschickt unter dem Vorgeben, sie habe ihn im Spital aufgefunden. Natürlich ist seine Hoffnung, dort das nötigste Geld aufzutreiben, irrig. Er faselt von einem Millionengeschäft, ich habe ihn aber im Verdacht, daß er seiner Ehefrau, bei deren Schwester er zurzeit wieder Bräutigam spielt, Märchen vorschwindelt. Sie hatte nichts zu essen. Ich ging mit ihr ins Café Odeon und gab ihr 1 Mark. – In der Torggelstube war die Halbe-Gesellschaft versammelt, ein riesiger Tisch voll Leuten. Ich holte mir die Marlow und Lulu Strauß, die mich nachmittags im Orlando versetzt hatten, jetzt hinüber, da ich mich nicht zu den vielen, teilweise fremden Leuten setzen mochte, auch von Halbe, der schlecht aufgelegt schien, nicht dazu aufgefordert wurde. Der Marlow gefiel das Gedicht gut. Sie will mir 60 Mk dafür zahlen und häufig etwas bei mir bestellen. Vorläufig habe ich ihr das Gedicht „Baccarat“, mit dem ich seit gut einem Jahr hausiere, abgeschrieben. Vielleicht ist es was für sie. Heut sollte ich das Geld im Orlando kriegen. Sie versetzte mich aber wieder. Ich habe mich gewöhnt, nicht eher an Geld zu glauben, bis ich es nicht bar habe. – Von der Halbe-Gemeinde splitterten sich dann noch allerlei Leute ab, die ins Orlando hinüber kamen: Mi v. Hagen, Lina Woiwode, Dr. Mannheimer und Elisabeth Steckelberg, Dr. Gotthelf u.s.w. Dazu kamen noch Sobotka und der Musikverleger Jadassohn aus Berlin. Ferner lernte ich bei dieser Gelegenheit den Komponisten Leo Fall kennen, einen dicken, sehr semitischen Wiener, der unausgesetzt jüdische Witze erzählt. Die ganze Gesellschaft ging zu Frau v. Hagen pokern, nur Sobotka, Jadassohn, Lina Woiwode und ich bleiben zurück. Linerl zeigte mir eine neue Photographie von sich, auf der sie zum Entzücken aussieht. Sie versprach mir, sobald sie mehr habe davon ein Bild. „Du kannst’s dir über dein Bett hängen“, meinte sie, „und machst’s dir dann davor.“ Danke. Die reelle Vergnügung mit ihr selbst wäre mir lieber. Nachher begleitete ich sie in die Kanalstrasse vor ihre Haustür. Küssen durfte ich sie leider nicht, da sie Zuschauer fürchtete. – Nach einem Schwarzen im Stefanie ging ich heim.
Heut früh kam die Fehl schon wieder angesetzt mit einem verzweiflungsvollen Brief von dem rumänischen Gatten. Ich schickte sie zu Rößler hinauf und wir gaben ihr je eine Mark. Man muß sehn, sie zu versorgen. Heut abend soll ich mit ihr zu Kati Kobus, die sie anpumpen möchte. Außerdem wollen wir sie an José Benz empfehlen. – Eine liebe Karte von Ella Barth kam an, in der sie sehr herzlich schreibt, und mich bittet, mich bei Stolberg für sie zu verwenden. Große Hoffnungen habe ich nicht, aber ich will alles versuchen. Ich möchte sie zu gern hier haben. Vielleicht kann sie mich wirklich lieben. Ein festes Verhältnis wäre unermeßliches Glück für mich. Kätchen Brauer, die mir jüngst aus Ilmenau schrieb, wo sie am Kurtheater spielt, habe ich aufgefordert, herzukommen. Wäre sie nur am Tage genießbarer! Nachts ist sie einzig. – Lotte giebt mir allerlei Aufträge an ihre Wirtin, die ich morgen erledigen werde. – Heut mittag ging ich mit Rößler baden. Wir trafen draußen Gänschen-Eyssler, Robert Halbe und Gulbransson. – Dann ins Torggelhaus essen und ins Orlando Café trinken. Dort war – die Marlow leider nicht, wohl aber Meßthaler, der ein neues intimes Theater im Hotel Roth aufmachen will. Er sucht nach einem Titel dafür. Ich riet: „Der Fasan“, oder „Opal“. Ich bin neugierig, ob er eins davon wählen wird. – Nachher fuhren wir per Auto in den Hofgarten, wo wir mit Dr. Blei zusammen saßen. Er erzählte, daß sich Victor Mannheimer demnächst mit Fritz Behn wegen einer dummen Lappalie schießen werde. Torggelstuben-Gespräch für die nächsten vier Wochen. – Ich ging dann noch zu Heinrich Mann an den Tisch, der mit Oppenheimer und Rechtsanwalt Brantl beim Kaffee saß. Den Oppenheimer ärgerte ich, indem ich seine sehr boshafte Karrikatur, die mir Hollitzer vor einigen Tagen im Hoftheater-Restaurant aufzeichnete, herumzeigte.
Eine Kindlichkeit von Rößler: Wir gingen an einer Anschlagtafel vorbei. Für heut abend kündigt das Schauspielhaus die hundertste Aufführung seines Feldherrnhügels an. Er blieb vor dem Plakat stehn, schüttelte den Kopf und sagte: „Unglaublich! Dieser öde Dreck!“
München, Montag, d. 21. August 1911.
Es ist wieder 6 Uhr abend, und ich habe heut noch keinen Strich für die Unsterblichkeit geschrieben. Dabei muß die Nr 6 des „Kain“ schnellstens fertig werden – noch habe ich kaum angefangen. Sobotka wartet auf das Szenarium, dem noch der dritte Akt fehlt. Der Kalender soll im Oktober heraus, und ich bin mir noch nicht einmal klar, was hinein kommt. Der „Komet“ mahnt alle Augenblicke um Beiträge, die Marlow, die Wiener Girls und der indische Consul wollen Vorträge von mir, und einige ganz wichtige Briefe – an das Puma, an Ella Barth und an die Schweizer wegen Johannes, der sich immer noch nicht gemeldet hat, gehn allem vor.
Gleichwohl will ich das Tagebuch nicht im Stich lassen. Es giebt doch täglich wieder Lustiges zum Notieren. Gestern begann ich mit dem Leitartikel für den „Kain“, aber nach kurzer Zeit verließ mich die Lust zum Schreiben und ich ging zu Rößler hinauf, um mit ihm, wie verabredet, ins Orlando zu gehn. Consul machte mir die Tür auf und lud mich, da Rößler nicht zuhause war, in ihr Zimmer. Ich blieb wohl anderthalb Stunden in angeregter Unterhaltung bei ihr, und das Resultat war, daß ich nun weiß, wie reizend sie küssen kann. Trotzdem ist es mir noch sehr zweifelhaft, ob ich bei ihr zum Ziele kommen werde. Aber küssen ist auch sehr schön – und jemand im Hause zu wissen, der schöne Lippen spitzt, wenn man kommt, ist wundervoll. – Ich ging dann ins Orlando, wo ich Rößler, Gotthelf, Eyssler, den jungen Dannegger und nachher Strauß mit der Marlow traf. Ich spielte mit Dannegger Billard und Ecarté, dann übergab ich der Marlow das Baccarat-Gedicht. Strauß nahm mich beiseite, und erklärte, daß ihr das andre Gedicht zu teuer sei. Ich ließ es ihr also für die gebotenen 30 Mk, die ich gleich erhielt. Besser als mit der Gabel in den Samenstrang – pflegt Wilm zu sagen. – Inzwischen gab es langes Hin und Her, da Eyssler für uns alle Abendbrot bestellt hatte, das die Torggelstube in seine Wohnung (Widenmeyerstrasse) liefern sollte. Dort wollten wir pokern. Es gab ein groteskes Herumzappeln voll Unschlüssigkeit und Nervosität, schließlich fuhren wir: Rößler, die Marlow, Strauß und ich im Auto los, während Eyssler in einer Droschke mit dem Essen nachkam. Er ist wundervoll eingerichtet, und hat ein paar Bilder und Gobelins, die viele Tausende wert sind. Die Marlow war totmüde, weil sie tags vorher bei Mi v. Hagen von 10 Uhr abends bis gestern mittag um 1 Uhr Poker gespielt hatte. Wir spielten nur kurze Zeit zu niedrigem Satz. Ich verlor aber doch 11 Mark. Nachher ging eine große Filzerei mit der Marlow an. Rößler ging fort, und Eyssler, Strauß und ich saßen abwechselnd bei ihr auf dem Divan. Zum Schluß zog sie die Schuhe aus, legte die Füße mir auf den Schoß und ließ sich von mir unter den Sohlen kitzeln. Ließ ich aus, bat sie ganz verschlafen: „Krabbeln!“ ... – Gegen ½ 2 Uhr holte uns ein Auto ab, in dem Strauß mit Mimi Marlow heimfuhr. Mich setzten sie erst bei der Torggelstube ab. Dort traf ich einen riesigen Kreis um den großen Tisch herum sitzen: Friedell, Ergas, die Schaffer, Weigert, Lux mit Frau, ferner eine Schwester der Schaffer, Dannegger, der große dicke Diegelmann, Friedrich Karl Peppler nebst Gattin, Gustel Waldau, und ich weiß nicht, wer noch alles. Dannegger produzierte sein einziges, aber phänomenales Talent, berühmte Schauspieler zu kopieren. Er spielte Moissi, Kainz, Sonnenthal und Baumeister, dann noch einige Theateragenten. Wedekind kam hinzu. Er setzte sich zu mir, da ich etwas beiseite saß. Wir sprachen über die Fruktizierung seines Memorandums für uns beide, und beschlossen, es dem „Berliner Börsen-Kurier“ und dem „Neuen Wiener Journal“ zum Vorabdruck anzubieten. – Inzwischen fing Dannegger wieder an. Ich meinte zu Wedekind, das sei wohl ein recht wertloses Talent, obwohl man, sähe man nicht hin, denken müßte, die Kopierten selbst zu hören. „Ein Garderobentalent“, erwiderte Wedekind. Als Dannegger dann noch anfing, unausgesetzt jüdische Witze zu erzählen – er machte auch das recht gut, aber es war peinlich – drückte sich Wedekind, indem er blos mir heimlich adjö sagte. Ich floh auch bald ins Orlando, wo ich noch mit Weigert und Lux einen Kaffee trank. Erst gegen ½ 4 hielt die Droschke, der ich mich anvertraute, in der Akademiestrasse. – Jetzt erst fiel mir ein, daß ich um ½ 11 Uhr abends mit der Fehl verabredet gewesen war und sie versetzt hatte. Natürlich meldete sie sich gleich heute früh, und nun muß ich heut abend mit ihr den aussichtslosen Bettelgang zu Kati Kobus tun. Dann bestellte mich Emmy ins Stefanie, wo sie mit Bolz saß. Sie will ihr Kind von Flensburg herholen und hat das Reisegeld nicht. Sie will es ratenweise zusammenvögeln. Mir versprach sie aber für die allernächste Zeit eine Gratisnacht. Ich besorgte dann von Lottes Pension die Photographien, die sie haben will. Zuhause sah ich sie trotz des Verbots durch. Es sind entzückende Akte von ihr dabei, die ich noch nicht kannte. Auch sonst viele Nacktbilder und sehr erotisch gestellte Szenen von verschiedenen, zum Teil bekannten Personen. Da ich ihr die Sünde meiner Indiskretion nie beichten werde, ist sie nicht geschehn. – Während ich beim Essen saß, erschien Hanns Fuchs, den ich wohl oder übel zum Essen einladen mußte. Er hat den Taler, den er mir neulich gab, somit reichlich aufgefressen. Er brachte mir zu meiner Überraschung Grüße vom Pater Expeditus Schmidt, der von meinem Artikel „Sittlichkeit“ in Nr 5 des „Kain“ begeistert sei und mich gern persönlich kennen lernen möchte. Da er nicht zu mir kommen möchte, es auch nicht für opportun hält, wenn ich ihn im Kloster aufsuche, da er ferner heute für 8 Tage verreist, wurde verabredet, daß uns in der nächsten Woche Fuchs im Ausstellungspark zusammenführen soll. Ich bin auf die Bekanntschaft mit dem katholischen Priester recht gespannt. – Nachher war ich im Hofgarten, wo ich Emmy und Hardekopf traf. Seit langer Zeit war ich mal wieder in besserem Gespräch mit Hardy beisammen, der sehr nett war. – Als ich zurückfuhr, um endlich an die Arbeit zu gehn, stieg Margarete Beutler mit ihrem Jüngsten in die Elektrische. Sie verführte mich, sie über das Siegesthor hinaus zu begleiten, und wir aßen dann in einer kleinen Conditorei in Schwabing eine Portion Eis. Sie erzählte, daß sie morgen nach Berlin müsse, da Freksa ein Bein gebrochen habe. Peter hat übermorgen Geburtstag, sie will den Tag aber ignorieren, weil der kleine Kerl sein Pensionsgeld unterschlagen hat und nicht zu bewegen war, sich deswegen zu entschuldigen. Ich werde ihm eine Karte mit meinem Bild schicken (davon habe ich genug. Denn Frowein hat mir den ganzen Schwung – etliche hundert Stück – ins Haus geschickt). Auch werde ich ihn demnächst am Ammersee besuchen. – – Vor einigen Wochen teilte mir Rudolf Grossmann aus Wien mit, ein Genosse, namens Mojzes, sei in Traunstein verhaftet und sitze hier in Neudeck. Er bat mich, für Verteidigung zu sorgen und ich übergab die Sache Lulu Strauß. Der berichtet mir nun, es handle sich um die Verbreitung aufrührerischer Schriften. Der Prozeß wird im September vor dem Schwurgericht verhandelt werden und er will mich als Sachverständigen laden lassen ...
Nun habe ich glücklich fast fünf Seiten hier vollgeschrieben. Gleich kommt das Abendbrot. Ob ich heut noch fleißig sein werde?
München, Dienstag, d. 22. August 1911.
Gestern schrieb ich noch an R. und je einen langen Brief ans Puma und an Ella. Natürlich wurde aus weiteren Arbeiten nichts mehr. Heut muß ich ran – es hilft alles nichts mehr. – Abends spielte ich mit der Ichenhäuser im Stefanie Schach, dann ging ich mit der Fehl in den „Simplizissimus“. Ich redete mit Kati, die versprach, mit Gerta selbst sprechen zu wollen. Natürlich schob sie das bis nach 3 Uhr nachts hinaus, sodaß ich dort gebunden war, in der miserablen Luft mir die miserabelsten Vorträge anzuhören. Trotzdem amüsierte ich mich ausgezeichnet. Emmy war sehr niedlich. Jenny Hummel war da, und ein sehr reizendes junges Mädchen, das anscheinend Fränze heißt – ich weiß nicht ob vorn oder hinten – trug mit zartem feinem Sopran Lieder zur Guitarre vor. Ich poussierte sämtliche Frauen nach Noten. Spät nachts erschien am Tisch ein Berliner, der mich mit der Behauptung ansprach, daß wir uns von der dortigen Neuen Gemeinschaft her kennen sollten. Er heißt Rechtsanwalt Preiß aus Berlin, und führte sich so unmöglich auf, daß ich mit der Bezeichnung „Sau-Preiß“ großen Beifall hatte. Mit heiserer besoffener Renommistenstimme pries er Berlin auf Kosten Münchens und benahm sich haarsträubend. Ungeheuer lustig wurde die Geschichte aber, als er mit Kati Kobus in einen sehr lebhaften patriotischen Wettstreit über Preußen und Bayern geriet. Kati war ihm dialektisch weit überlegen, und ich wäre bald vor Lachen geplatzt über die beiden. – Kati lud mich für morgen nachmittag zu einer Autofahrt an den Ammersee ein, und da auch die Fränze teilnehmen will, sagte ich zu. Nachher brachte ich dies junge Mädchen heim, und nun wurden wir beide plötzlich ernst. Das arme Ding fühlt sich in ihrer Lebenshaltung als Cabaretistin sehr unglücklich. Dabei hat sie stolze moralische Grundsätze, die ich ihr auszureden versuchte. Wie sinnlos solche Versuche sind! – Für mich wäre das gute – und sehr sehr hübsche Mädchen nichts. Sie würde mich elegisch machen.
Von Landauer eine Karte. Er wird Freitag in München sein und bittet mich von 2–6 Uhr um ein Rendezvous. Ich habe schon geantwortet.
München, Mittwoch, d. 23. August 1911.
Nun ist der Leitartikel für Nr 6 gottseidank geschrieben, ich glaube, er ist recht gut geworden: ein Protest gegen die marokkanische Kriegshetzerei mit stark antimilitaristischer Tendenz, aber sicher nicht konfiskabel. – Nun nur noch die paar Glossen, und die weitere Arbeit kann mit dem Kalender beginnen. – Gestern abend war ich mit Emmy im Union-Theater, da Weigert mich schon oft aufgefordert hatte, mir ihn „a. G.“ anzusehn. Es giebt dort ein Soldatenstück „Kasernenluft, militärisches Volksstück“ von Martin Stein und Ernst Söhngen. Dieser Söhngen soll Metallarbeiter in Essen sein. Das Stück ist raffiniert gemacht, besonders sind die ersten beiden Akte sehr wirksam. Darin schindet ein Unteroffizier einen Soldaten in schweinischer Weise, weil der ihm das erhoffte Mädchen wegschnappt. Man sieht, daß der Verfasser Kasernenhöfe genau kennt, und ich dachte mir, das Stück sollte man zu antimilitaristischen Zwecken ausnutzen und vor revolutionären Kreisen spielen. – Aber die beiden andern Akte wurden derartig schmalzig, daß mir dieser Plan verging. Allgemein ein gekonnter Schmarren, teilweise wirklich dramatisch, zum andern Teil unfreiwillig komisch und zum größten Teil kolportagehaft sentimental. – Gespielt wurde garnicht übel. Weigert imponierte mir nicht besonders. Er ist gewiß ein tüchtiger Schauspieler, aber manche seiner Partner waren reichlich ebenso gut.
In der Torggelstube traf ich Weigert, Feuchtwanger, Hartmann und Dr. Brecher. Ich ging mit Weigert gleich ins Orlando hinüber, nachdem ich etwas gegessen hatte, und dort unterredete ich mich mit dem Italiener Bonometti, den ich vorher im Union-Theater gesprochen hatte. Er ist Komponist und möchte gern mit mir eine Operette schreiben. Ich erzählte ihm von dem Szenarium, an dem ich arbeite, und versprach ihm, falls ich vom Drei-Masken-Verlag den Auftrag erhalte, das Libretto zu schreiben, würde ich auf ihn dort aufmerksam machen – Andernfalls werden wir einfach auf gut Glück zusammen ans Werk gehn.
Von Johannes noch immer kein Wort und keine Möglichkeit, ihn zu erreichen. Ich bin sehr beunruhigt und warte gespannt auf den Monatsersten. Da muß er sich ja melden.
München, Donnerstag d. 24. August 1911.
Der Ausflug nach Herrsching gestaltete sich recht bewegt. Um ½ 2 Uhr trat ich im „Simpl.“ an. Jenny Hummel und Fränze (mit Zunamen: Fischer) waren schon da. Kati kam bald, lud uns in ein Automobil, und wir fuhren zum Bahnhof. Die Reise verlief sehr nett. Kati erzählte manches Lustige und Jenny Hummel schwätzte über ihre alten Cabaret-Erlebnisse, bis der Zug hielt. An der Station Herrsching stand ein kleines Privat-Automobil, aus dem uns der Schauspieler Schmitz (Union-Theater) begrüßte. Wir wurden mit den Insassen bekannt gemacht und eingeladen, mit ihnen in den Ort zu fahren. Die Frauen wurden dann auch noch im Wagen verstaut. Schmitz aber und ich mußten auf den äußeren Trittbrettern rechts und links des Gefährts Platz finden. Ich saß auf dem Wellblech und hielt mich an der Inneneinrichtung fest. Außerdem hielt mich die kleine Fränze krampfhaft am Ärmel, damit ich nicht herunterfiel. So ging die Fahrt los. Ganz gemütlich war mir nicht dabei zu Sinne, aber als das Auto vor dem kleinen Café bei der Badeanstalt hielt, war ich wohlbehalten. Wir tranken Kaffee – alles auf Katis Kosten, die sehr nobel war, und wollten nun baden. Währenddem wurde es dunkel. Himmel und Wasser quollen grün und grau an, die Berge verschwanden, Wind kam auf, das Gewölk fegte wie besessen umher, der See schlug hohe Wellen, endlich platzte der Regen herunter. Aber das Gewitter beschränkte sich auf ein paar Blitze und ferne Donnerschläge. Das Wetter dauerte nur eine Viertelstunde. Es ward wieder hell und wir gingen hinunter ins Familienbad. Ich rede nicht davon, wie Kati Kobus im Badekostüm aussah – Fränze Fischer sah allerliebst aus. Sie hatte zur Vorsicht einen Korkgürtel um den Bauch gelegt, und diese Vorsicht wäre uns beiden beinahe verhängnisvoll geworden. Ich war in der ganzen Gesellschaft der einzige, der schwimmen kann, und natürlich brillierte ich vor den Weibern nach Kräften mit dieser Kunst. Fränze wünschte das Schwimmen bei mir zu lernen, und ersuchte mich, sie hinten beim Gürtel zu halten. Ich tat das, und schwamm mit ihr vorn im Bassin herum. Sie zappelte dabei auf das anmutigste mit den Armen und den etwas starken, aber wohlgeformten Beinen, die ich mit besonderem Eifer immer wieder mit meinen Arm grade reckte. Plötzlich bekam sie Angst und fing an, mich zu umklammern. Ich wollte mich auf die Füße stellen, bemerkte aber, daß ich etwas zu weit mit ihr geschwommen war, und daß wir keinen Grund mehr hatten. Indessen packte sie meine Haare, drückte ihre Hand auf meinen Mund, würgte mich vorn und hinten am Hals, sodaß ich schauderhaft Wasser schluckte und die Situation schon sehr brenzlich empfand. Die Leute am Ufer sahen zu und wußten nicht, ob unser Kampf Ernst oder Scherz war. Es dauerte eine ganze Weile, bis es mir mit ungeheurer Anstrengung gelang, dies zu Tode geängstigte Mädchen, das auch genug von dem Dreckwasser gesoffen hatte, und das ich, damit sie sich nicht überkugle, bei dem ganzen Ringen konstant am Gurt festhalten mußte, zu wenden und glücklich wieder zu landen. Ich war halb ohnmächtig, meine Lippen blau und der Rotz floß mir stromweise aus der Nase. Noch jetzt fühle ich den gesoffenen Ammersee drückend auf meiner Brust. Als wir angezogen waren, stärkte ich mich durch Schnaps und wir gingen in den „Seehof“ etwas essen. Die dumme Fränze nahm mir aber meine Schwimmlehrerei sehr übel und behauptete noch am späten Abend, ich hätte ihr die ganze Tour verdorben, weil ich sie zu weit aufs Wasser geführt hätte. – Im „Seehof“ erschien eine ganze Gesellschaft. Wilhelm Michel und Frau nebst drei Kindern wohnen in dem Haus. Sie hatten noch einen französischen Advokaten, einen Sozialisten, namens Dr. René Bloch, bei sich. Außerdem waren die Leute, die uns mit dem Auto von der Bahn abgeholt hatten, ein Herr Bernhardt mit sehr gelungener kugeliger Frau und noch mehrere andre dabei. Schmitz erwies sich als recht witziger Mensch. Ich unterhielt mich hauptsächlich mit Michel und errang mir in hervorragendem Maße die Gunst seiner dreijährigen Tochter Anny, die unentwegt auf mir herumturnte. – Um ½ 9 ging der Eilzug nach München ab. Kati und Fränze schliefen während der Fahrt. Jenny Hummel und ich zoteten. – Man setzte mich beim Stefanie ab und fuhr weiter. Ich ging dann noch zur Torggelstube, wo am Haupttisch Weigert, Diegelmann und das halbe Künstlertheater saß, an einem Seitentisch Hollitzer und Lebrun, die beiden „Nachtlicht“-Kollegen. Die luden mich zu sich ein und schwätzten entsetzlich dummes Zeug. Der dicke Lebrun ist ein Rindvieh, wie man es nicht häufig trifft. Er gab Weisheiten von sich, daß ein Schwein hätte kotzen mögen. Um ½ 3 Uhr gingen beide Tische ins Orlando hinüber, wo wir bis zur Polizeistunden-Verkündung blieben. Dann ging ich zu Fuß heim.
Johannes schweigt immer noch, und ich ängstige mich nachgrade ein wenig. Frau R. schreibt mir aus Zürich, daß nach ihrer Annahme Gross bei ihm in Bern sei, aber Sicheres wisse sie garnicht. Übrigens komme ihr Mann in diesen Tagen nach München, der vielleicht eher etwas sagen könne. Ich will nun mal die Görg anfragen. Sobald ich den Ausreißer habe, kriegt er einen Brief von mir, wie er ihn noch nicht gesehn hat. Die Nachlässigkeit ist ja unerhört!
München, Freitag, d. 25. August 1911.
Ich brachte gestern nachmittag die Manuskripte für „Kain“ Nr 6. zur Druckerei und ging dann heim (nach dem Stefanie-Aufenthalt), um zu arbeiten. Ich fand das Mädchen beim Fensterputzen beschäftigt und flüchtete sogleich zu Rößler hinauf. Er war nicht daheim. Als ich wieder hinabwollte, kam mir auf der Treppe Consul entgegen und führte mich in ihr Zimmer. Ich blieb erst eine Stunde bei ihr – und wir küßten uns, daß es eine Lust war. Dann kam sie zu mir Abendbrot essen und unter vielen weiteren Küssen auf ihren schönen weichen Mund brachte ich ihr das Pokern bei. Es ist seltsam, daß ich mich nicht getraue, sie bei den Zärtlichkeiten, zu denen sie mir willig immer wieder die Lippen überläßt, einmal richtig herzunehmen und mit ihr zu tun, was ich doch möchte. Sie hat irgendetwas Strenges in ihrem Wesen, das mir scharf bestimmte Grenzen zieht. Wir sagen uns auch beim besten Küssen immer Sie. – Um 9 Uhr kam Rößler, der sich am Spiel beteiligte, das jetzt zum Baccarat überging. Ich gewann im ganzen etwa 2 Mark.
Torggelstube – ein vollbesetzter Tisch mit seltenen Gästen: Randolf, die Swoboda (ein Stück Mist), Feuchtwanger, Weigert, Wedekind, Alten, v. Jacobi, Waldau, Mi v. Hagen, ein widerlicher Kerl mit blondem Schnauzbart, dessen Namen ich nicht weiß und noch vielleicht diese oder jener. Nachher kam Kurt Martens und Wilhelm v. Scholz, schließlich auch noch Lina Woiwode und Basil. Am oberen Ende zückte man Spielkarten, und ich sah, daß Wedekind nervös wurde. Er ging mit Martens – Scholz war fortgegangen – an einen andern Tisch und kam plötzlich zu mir: Kurt Martens habe etwas mit mir zu besprechen. An Ecktisch wurde ich dann aufgeklärt, man habe sich nur von den Kartenspielern emanzipieren wollen. Jetzt kamen sehr lebhafte Gespräche auf. Besonders wurde natürlich die Ungeheuerlichkeit des Diebstahls der Mona Lisa erörtert. Wedekind deutete an, daß er Willy Gretor in Verdacht habe, mit der Geschichte in Verbindung zu stehn. Auch mir war dieser Gedanke schon gekommen: In der Flora-Büsten-Angelegenheit war er der eigentliche Macher gewesen, – Harden hatte seine Beteiligung damals als Beweis für die Unechtheit angeführt. Ich habe Gretor leider nie kennen gelernt. Als ich nach Paris ging, hatte mir die Gräfin Grüße an ihn aufgetragen, aber ich fand ihn damals nicht. Er muß ein interessanter Kerl sein. Meine Vermutung war, daß ein Herostratenstück vorliegt. Vielleicht bringt sich demnächst irgendwer um, und man findet bei ihm die Reste der Gioconda. Daß das Bild im Auftrag eines amerikanischen Milliardärs gestohlen wurde, ist natürlich auch möglich. Schließlich könnte es auch eine chauvinistische Aktion sein: das Bild wurde nach Deutschland verschleppt, und die Gereiztheit wegen Marokko bekommt eine ethische Stütze. – Es ist ein sehr eigentümlicher und unheimlich aufregender Fall. Ich bin, seit ich es las, ganz betroffen und ärgere mich über die Schmöckereien in den Blättern, die den Vorfall schon ganz in ihren dummen Tageskram einregistriert haben. – Wir blieben sehr lange beisammen. Ein Schutzmann kam und erinnerte Rauschenbusch um ¼ 4 Uhr an die Polizeistunde. – Wir hätten alle noch gern bleiben mögen. –
Heut kam ein langer lieber Brief von Ella Barth, über die ich gestern nacht noch mit Bernhard v. Jacobi sprach. Er war derselben Meinung wie ich, daß ihr persönliches Herkommen ihr vielleicht so nutzen könnte, daß sie dort Speidel durch Steinrück vorgestellt würde. Sie schreibt nun, sie habe ein Engagement in Königsberg in Aussicht. Zerschlage sich das aber, was sie erwarte, so wolle sie kommen und meine Einladung, bei mir zu essen, annehmen. Ich glaube fast, sie ist schon entschlossen, meine Werbungen um sie anzunehmen. Es könnte, glaube ich, für uns beide daraus nur Gutes entstehn. Lotte scheint zu ihr sehr lieb über mich gesprochen zu haben. – Jetzt muß ich abbrechen. Landauer erwartet mich im Luitpold.
München, Sonnabend, d. 26. August 1911.
Johannes’ passives Verhalten macht mich allmählich schauderhaft nervös. Ich nehme, wenn ich die Sache ganz nüchtern betrachte, nicht an, daß ihm und Iza etwas zugestoßen ist. Denn, wäre das der Fall, so hätte ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Nachricht. Trotzdem ist mir die wochenlange Verschweigung seines Aufenthaltes fast unerklärlich. Frl. Görg weiß gewiß nichts, denn erst heut wieder traf ein dorthin adressiertes Buch bei mir ein. Ich könnte höchstens mal bei Frieda anfragen, wo Otto Gross steckt. Der wird noch am ehesten Bescheid wissen. – Ich bin sehr außer mir über die Sache, und manchmal krampft sich mir in wilder Angst das Herz zusammen. – Jedenfalls muß ich mich zunächst mal die 5 Tage bis zum Ersten gedulden. Ist dann, wenn er Geld braucht, auch noch kein Lebenszeichen da, dann werde ich wohl in die Schweiz müssen, um persönlich zu recherchieren. – Vorerst beherrsche ich mich so gut es geht, aber die Zerfahrenheit, in der ich mich manchmal selbst von andern ertappen lasse, zeigt mir doch, daß mich die Angelegenheit unheimlich real beschäftigt.
Landauer traf ich laut Verabredung gestern mittag um 2 im Luitpold, wo er mit Hedwig Lachmann und dem Ehepaar Croissant saß. Anna Croissant-Rust lernte ich bei dieser Gelegenheit erst kennen. Sie macht einen überaus angenehmen Eindruck und wirkt in ihrer formalen Höflichkeit doch sehr schön und anziehend. Um 3 Uhr etwa brach Herr Croissant mit den beiden Damen auf, um in die alte Pinakothek zu gehn. Landauer und ich folgten nach einiger Zeit im Auto. Wir sahen die Grecos, Goyas, Tintorettos etc. der Nemeszschen Sammlung, ferner die Carstenjansche Sammlung, in der ein paar wundervolle Rembrandts sind, und gingen dann in Eile durch die kleinen Nebensäle mit ihrem unermeßlichen Reichtum. – Dann Besorgungen machen. Wie vor zwei Jahren mußte ich Landauer wieder zu einem Goldschmied begleiten, da er für seine Frau ein Geburtstagsgeschenk aussuchen wollte. Schließlich bestellte er eine Mondsteinkette, die nach seiner Angabe hergestellt werden soll. Dann gingen wir in den Hofgarten. Unsere Gespräche waren freundschaftlich und gut, und wir beide fanden, daß die Begegnung fruchtbar und reinigend war, obwohl der Mangel an Zeit lange Erörterungen nicht zuließ. Jedenfalls bin ich sehr bestärkt worden in meiner Erwartung, daß die jüngsten Mißhelligkeiten auf Landauers Nervosität zurückzuführen waren, und daß er zu allen sachliche und menschlich anständige Beziehungen will. – Um ½ 7 Uhr ging sein Zug. Ich begleitete ihn zur Bahn. Vor demselben Zuge sah ich ein junges Mädchen stehn, das ich im ersten Moment nicht erkannte. Dann fiel mir ein, das könne Betty Seipp, der "Seppel" sein, – aber ich war sehr im Zweifel. Ich grüßte zur Vorsicht und sie grüßte zweifelnd wieder. Als ich mich von Landauer verabschiedet hatte, stand sie im Gespräch mit einer älteren Dame, die im Zuge war. Ich belauschte ihre Stimme, und als ich das tiefe polternde und doch so rührende Organ hörte, war ich fast sicher. – Jetzt erwartete ich sie auf dem Bahnsteig, und als sie vorbeikam ging ich auf sie zu und fragte: „Sind Sie Frl Seipp?“ – Ihre Antwort war: „Sind Sie Herr Mühsam?“ – Wir freuten uns beide sehr des Wiedersehens. Sie hat sich kaum verändert, ich erkannte sie trotzdem nicht gleich, weil sie in den zwei Jahren, seit unserer früheren Bekanntschaft von 17 auf 19 Jahre aufgerückt ist, und nun viel erwachsener aussieht, als der Lausbub von damals. Sie schenkte mir gleich ein Bild von sich aus „Was ihr wollt“. Sie sieht ganz famos drauf aus und zeigt herrliche Beine. Wir bestellten uns für heut nachmittag in den Hofgarten.
Abends rief mich Rößler von der Straße aus an, und wir gingen in die Torggelstube, wo sich nach und nach Waldau, Gotthelf, Dr. Rosenthal, Dr. Brecher, der eine sehr nette junge Dame bei sich hatte, und schließlich auch noch Richard Weinhöppel (Hannes Ruch) mit seiner neuen (ich glaube: vierten) Frau einfanden. Die meisten gingen zu Basil pokern. Ich blieb mit Ruchs, Rosenthal, Gumppenberg, der ebenfalls noch erschien, Brecher und dem Mädel zurück. Das ist eine Schauspielerin aus Wien, die jetzt hier ans Volkstheater engagiert ist. Ich poussierte sie nach Kräften und morgen abend wollen wir zusammen ins Schauspielhaus gehn, wo Waldau zum „Anatol“ für mich einreicht. Sie heißt Frieda Münzer und ist ein Gainsborough-Typ mit Kalbsaugen. Sehr niedlich. Da Rößler vorher Pfirsichsekt spendiert hatte, war ich in sehr guter Laune und ging in meinen Liebenswürdigkeiten gegen das Mädchen recht weit. Weinhöppels gingen, und nun wurde beschlossen, zu Benz zu fahren. Im andern Raum saßen etliche Leute vom Künstlertheater: Diegelmann, Margarete Kupfer, Reissig, ferner Weigert und noch andre Leute, die ich erst kennen lernte. In zwei Autos ging es nach Schwabing hinunter, und da gab es aus mächtigen Bowleschüsseln „Kalte Ente“, ein sehr wohlschmeckendes und recht kräftiges Getränk, von dem ich Riesenmengen soff, sodaß ich hinlänglich beschwipst wurde. Mir gegenüber saß Margarete Kupfer, eine Dame von keineswegs berauschender Schönheit. Ihr geiler Mund hat etwas vom Schweinerüssel, die Augen etwas Fischartiges – und trotzdem ist die Person reizvoll. Ich hatte sie mit der Bemerkung angesprochen, wir hätten uns lange nicht gesehn, sie war darauf eingegangen, und erst als wir beide betrunken waren, uns Du sagten und einander in den Armen lagen, gestand sie mir, daß wir uns überhaupt noch nie kennen gelernt hätten. Der kleinen Münzer habe ich wahrscheinlich im Suff Ungezogenheiten gesagt, jedenfalls behandelte sie mich sehr schlecht, nachdem sie vorher äußerst nett zu mir gewesen war. – Man war sehr fidel, der unglückliche Dannegger mußte wieder kopieren und jüdische Witze erzählen – und erst um vier Uhr brachen wir auf und fuhren – nicht heim, sondern zum Café Flora, wenigstens ein Teil der Gesellschaft. Ich mußte der Kupfer einen Brief versprechen, in dem ich sie einladen soll – heut wird er geschrieben werden, und ich kam erst nach 5 Uhr nach Hause.
Während der Eintragung in dies Heft wurde ich heut mittag durch Consul abgerufen, die irgendein Anliegen hatte. Ich holte sie zum Kaffee herunter, und ich bekam so gute warme Küsse, daß ich doch wieder größere Hoffnungen habe. Im Hofgarten sollte ich Seppel treffen. Sie blieb aber aus, und als ich nach Hause gehn wollte, hielt mich ein alter Genosse in der Ludwigstrasse fest, der mich vor einem Herrn Pfeiffer warnen wollte. Nun scheint das derselbe Pfeiffer zu sein, der mir nach Nr 1 des „Kain“ einen so liebenswürdigen Brief geschrieben hatte, und von dem merkwürdigerweise grade heut wieder ein Brief kam, in dem er mich anregt, gegen die sogenannte „Mazdaznan“-Bewegung loszugehn, die ein aufgelegter Schwindel sei. Der alte Genosse, der ein sehr aufgeregter Mensch ist, behauptete, der Pfeiffer sei Spitzel. Er tobte und raste, daß ihm der Schaum vor dem Mund stand und führte mich in eine zur Kaulbachstrasse führende Seitenstrasse. Während wir dort promenierten, sah ich plötzlich am Fenster eines Schneiderateliers Moissi sitzen. Als ich den Anarchisten endlich los war, kehrte ich dorthin um, und nun kam mir Moissi und Berneis entgegen. Da Berneis sich gleich verabschiedete, blieb ich mit Moissi jetzt noch ein wenig im Hofgarten zusammen, und eben brachte er mich per Auto bis zur Ecke Akademiestrasse. Er selbst fuhr zu Fritz Behn weiter.
Heut abend gehe ich zur Ausstellung hinunter. Ich bin dort mit Lina Woiwode verabredet. Wir wollen uns die Probe zur „Orestie“ ansehn.
München, Sonntag, d. 27. August 1911.
Auf der hübschen kleinen Stahluhr, die ich mir gestern für 10 Mark kaufte (die silberne Zürcher mit dem Spinatstecher auf dem Deckel bettelte mir in Berlin das Puma ab) ist es schon wieder 3¼ Uhr – und ich habe bis jetzt noch nichts getan und muß, muß, muß durchaus heute noch den Artikel für den „Sozialist“ schreiben, den ich vorgestern schon wieder in schwachem Moment Landauer versprach. Aber dieser verdammte Herr Fuchs nahm die letzten Stunden schon wieder in Anspruch, sodaß mir der halbe Tag verkorkst ist. Doch davon später.
Die Orestie-Probe war überaus lohnend zu sehn. Ich bin glücklich, dortgewesen zu sein. Vorher wartete ich lange vor dem Eingang auf Lina Woiwode, die mit dem Moggerl zusammen kommen wollte. Natürlich verspäteten sie sich um eine ganze Stunde. Ich unterhielt mich mit Diegelmann, Frau Feldhammer kam hinzu – und dann hielt ein Auto, dem Gertrud Eysoldt entstieg. Sie kam gleich auf mich zu, begrüßte mich sehr lebhaft und rühmte den „Kain“ so aufrichtig und warm, daß ich wirklich vor Freude bald errötet wäre. Herrgott, wie ich diese himmlische Frau liebe! – Ist sie schön? Ist sie häßlich? Was geht’s mich an! Sie hat einen Ausdruck im Gesicht, daß ich vor ihr knieen möchte, ihre Augen sind rein und stark und so lebendig wie Himmel und Welt. Ihre Stimme ist Engelsmusik, ihre Hände – so stark, ja männlich sie sind – vibrieren von aller Kunst und Schönheit. Ich weiß nicht, ob die Eysoldt ein greiser Philosoph ist oder ein kleines spielendes Kind, – für mich ist sie ewige Jugend und strahlende Ewigkeit. Ich glaube nicht einmal, daß ich sie erotisch liebe – ich liebe sie, ich bete sie an, ganz unpersönlich wie die Natur selbst, und wenn ich sie einmal umarmen dürfte, geschähe es in der absoluten Verklärung, in der ich Verse mache ... Wie herrlich, wie wunderbar war sie gestern wieder! – Sie hatte sich einen großen weichen Strohhut über den Kopf gestülpt, ein bräunlicher Mantel war schlampig um ihren kleinen Leib gehängt, und ein graublaues Tuch flatterte von ihrem Halse. Und dann redete sie von ihrem Haß gegen Staat, Zwang, Behörden, Kontrolle. Sie pries meinen freien festen Ton und bekannte sich zu der wilden anarchistischen Freiheit, die sie in mir vertreten sieht. Diegelmann und die Feldhammer hörten ganz geängstigt zu. Ich konnte kaum ein Wort sagen, so ergriff mich die Kraft, die Leidenschaftlichkeit und die seltsam unirdische Schönheit der Frau. So groß, so nah und so fern und fremd zugleich sah ich sie nie. – Wir gingen in die Halle hinein. Ich setzte mich auf eine Zuschauerbank. Die Arena der Musikfesthalle war voll Menschen – es mögen 2–300 Personen gewesen sein. Ein Herr Prager übte mit den Chören. Ich sah nur ein Durcheinander, aus dem ich nicht klug wurde. Die Feldhammer sprach auf der großen Treppe, die die Bühne bildet, ein paar Verse, ein Chor rückte an, dem Posaunenbläser voranschritten – mit langen Tuben, die jede vorn von einem Mann gehalten werden mußten. – Plötzlich kam Schmiß in die Menge. Ich sah, wie jeder mit einem Schlage wußte, wohin er gehört, wie er sich zu bewegen, was zu tun hätte. Das Geheimnis war: Max Reinhardt war gekommen und hatte die Regie übernommen. – Er stand in der Mitte des Saals auf einem Podium, das zur Szene gehört und kommandierte – zumeist blos mit Handbewegungen, die alles ringsum dirigierten. Nur manchmal hörte man ihn: „Weiter! – Noch einmal! – Unmöglich: noch einmal! – Lauter! – Schneller!“ oder ähnliches sagte er. Man fühlte, wie er alle beherrschte. – Es wurde mit den Chören geübt. Die Schauspieler hatten blos die Stichworte zu geben. Die Terwin, die dann mit der Woiwode kam und sich neben mich setzte, kam garnicht dran. Moissi begrüßte mich, dann Vollmöller, dessen Übersetzung als Text verwendet wird. Es wird eine wunderbare Aufführung werden. Reinhardt – soviel sehe ich, obwohl gestern nur markiert wurde – leistet wieder einmal sehr Großes. – Ich blieb bis gegen 11 Uhr und fuhr dann in die Torggelstube, wo das Ehepaar Halbe, das Ehepaar Weinhöppel, Gustel Waldau, Dr. Brecher (ein feuchter Wichtigtuer) und Weigert saßen. Dann kam Wedekind. Da ich von der Sauferei bei Benz noch angegriffen war, fuhr ich frühzeitig heim.
Heut vormittag lockte mich Rößler ins Stefanie. Als er gegangen war, erschien also Hanns Fuchs. Er berichtete, daß ein Kölner Theaterdirektor in München sei, der von meinen „Freivermählten“ gehört habe und mich kennen lernen will. Haas heißt der Mann. Wir verabredeten uns für Dienstag nachmittag im Stefanie. Dann lud sich Fuchs bei mir zu Tisch ein. Ich konnte nicht nein sagen, und mußte ihn mit seinem urnischen Geschwätz über mich ergehn lassen. – Ich muß sehn, möglichst noch ein Geschäft durch ihn zu machen. Seine Gesellschaft muß mir doch irgendwie bezahlt werden. Er meint, er werde mich demnächst zu einer Autofahrt nach Passau einladen können. Dabei soll ich dann einen Vetter von ihm kennen lernen, der Geld habe und mir vielleicht ein paar Tausende pumpen würde. Wollen sehn. Den Pater Expeditus Schmidt werde ich noch eine Woche entbehren müssen. Er ist verreist. – Herr Fuchs kam auch noch in den Hofgarten mit und begleitete mich von da zurück. Erst als ich ihm vor der Haustür sagte, ich müsse jetzt notwendig arbeiten, wurde ich ihn los. Eine scheußliche Klette.
Steinebach übersandte mir einen Brief des Herr Kloss, der kürzlich – vor meiner Berliner Reise – bei mir war (ich weiß nicht genau, ob ich hier davon Notiz nahm). Ein Freund des Krinz, der auf Naturbursche posiert, und vor dem ich schon lange gewarnt worden war, er sei Polizeispitzel. Ich ließ ihn deshalb gründlich abgleiten. Nun erzählte mir neulich Steinebach, der Mann habe sich wegen Verlagsgeschäften mit geheimnisvoller Bedeutung an ihn gewandt. Ich warnte ihn. Jetzt schreibt der Kloss, es solle eine Zeitschrift gegründet werden, Steinebach möchte mir auf den Zahn fühlen, ob ich mit einer Verschmelzung mit „Kain“ einverstanden wäre, da gleiche Tendenzen verfolgt werden sollen. Ich werde so deutlich abwinken, daß diese Belästigung dauernd abgeschafft wird. Ob Bittinger dahinter steckt? – Auch den Herrn Pfeiffer werde ich mal zu mir bestellen. Vielleicht hat der alte Kerl von gestern wirklich recht. Es wäre ja auch absurd, wenn die Polizei ihre schmierigen Finger nicht in meine reinlichen Angelegenheiten zu stecken wünschte. Wartet, Burschen!
München, Montag, d. 28. August 1911.
Ich bin ein schändlich leichtsinniges Luder. Nichts habe ich gearbeitet, nicht für Landauer, nicht für mich noch für sonst jemand, und jetzt abends um ½ 7 Uhr komme ich von Tutzing zurück. Aber nacheinander.
Ich war gestern abend laut Verabredung mit Frl. Frieda Münzer aus Wien im Schauspielhaus, wo es Schnitzlers „Anatol“ gab. Waldau war reizend als Anatol, ganz prächtig, Randolf als Max plump und ekelhaft, von den Weibern war die Gerhäuser sehr tüchtig, die Landing allenfalls passabel, die Nicoletti recht mäßig, die Schaffer unter allem Luder und die Woiwode ganz entzückend, lebendig, forsch, hübsch und ruppig. Sie hatte noch einen besonderen Erfolg dadurch, daß das Publikum, als der Vorhang auf den kräftigen Applaus noch einmal hochging, sie überraschte, wie sie grade noch einen Schluck von dem Sekt trank, der zu ihrer Rolle gehörte. – Meine Begleiterin ist ein langweiliges anständiges Mädchen, das sich sogar entsetzte, weil ich ihre Garderobe mitbezahlte. Als ich es heute erzählte, meinte Gotthelf (ein Mann, der trotz seiner Nasenlosigkeit bei näherer Bekanntschaft gewinnt – leider auch im Poker): „Was muß die erst im Bett anstellen!“ – Ich brachte sie heim und ging ins Torggelhaus.
Dort traf ich Gustel Waldau, Mi, die Woiwode, Feuchtwanger, Gotthelf, Rößler – vielleicht auch sonst noch wen. Waldaus wohnen in Tutzing und hatten die Woiwode eingeladen, mit hinauszukommen. Plötzlich fragte mich Mi, ob ich auch mitwolle – und ich sagte kurzerhand ja. Wir pokerten. Ich verlor etwas, Feuchtwanger begleitete uns zur Bahn. Rößler und Gotthelf versprachen, heute nachzukommen. In der Bahn wurde weiter gepokert, und ich verlor wieder – alles in allem 18 Mark. In Tutzing ging es gleich ins Hotel Simson und zu Bett. Ich schlief ausgezeichnet. Heut früh tranken wir – Gustel, Mi, Linerl, deren kleine Nichte (14jährig) und ich Kaffee, dann ging ich mit Waldau zur Bahn, Rößler und Gotthelf abholen. Wir machten sofort einen Frühpoker auf, und ich gewann 30 Mark. Dann gingen wir baden. Es war herrlich. Draußen im Starnberger See trafen wir Mi, die auch hinausgeschwommen war (sie hat etwas zu dicke Beine). Schon auf dem Steg, der zur Badeanstalt führt, wurden die Karten wieder vorgeholt, bis die Damen mit der Toilette fertig waren. Ich gewann dabei 7 Mark. Wir aßen im Freien Mittag und pokerten weiter bis zur Abfahrt. Ich gewann weitere 17 Mark, die ich auf der Rückfahrt nach München wieder verlor. Meine beste Absicht, Liesel Steinrück, die ich seit zwei Jahren nicht sah, und die ich wirklich gern habe, zu besuchen, blieb unausgeführt. Jetzt komme ich grade zurück. – Briefe finde ich nicht vor, natürlich auch von Johannes keinerlei Nachricht. Ich habe gestern an Fried
München, Dienstag, d. 29. August 1911.
Mitten im Wort mußte ich abbrechen, mitten in dem Namen, der mir der heiligste und schmerzlichste ist. Consuela Diekmann kam nämlich, um mich zu bitten, für Rößler, der große Schmerzen habe, ein Haemorrhoiden-Mittel zu besorgen. Natürlich benutzte ich die Gelegenheit, den Consul tüchtig abzuküssen. Dann wurde es Zeit, ins Theater zu gehn, da Gustel Waldau mir sein Billet für die Clavigo-Premiere im Hoftheater geben wollte. – Die Aufführung war nicht begeisternd, es war die unerfreulichste, die ich in Steinrücks Inszenierung bis jetzt gesehn habe. Die Regie war ja nicht schlecht, einzelne schauspielerische Leistungen waren sogar gut, – aber andre sind so unter dem Hund, das man weinen könnte. v. Jacobis Clavigo war eine recht interessante Leistung – ein wenig zu jung, aber sehr durchdacht, aber, Jacobis alter Fehler: man sieht die Intelligenz, wo sie Darstellung werden soll versagt oft die Fähigkeit, und es giebt Übertreibungen und Peinlichkeiten. Glänzend war Steinrücks Carlos, da er ganz vermied, aus der Rolle einen schleichenden Intriganten zu machen; er war einfach der ehrliche starke temperamentvolle und entschlossene Freund. Ulmer gab den Beaumarchais, wie man ihn von ihm erwarten konnte. Konventionell, älteste Schule, rührend und urdeutsch, was, da Beaumarchais Franzose ist, komisch wirkte. Frau von Hagen (die gute Mi sah von der Pokerei noch etwas angegriffen aus) spielte die Frau Guilbert recht tüchtig, – sie ist eine der ganz wenigen Frauen am Hoftheater, die nie peinlich wirken. Dagegen war die Neuhoff als Marie so ekelhaft, wie ich selten etwas sah. Soll die jetzt alle jugendlichen Liebhaberinnen spielen, wenn das Moggerl fort ist? Fürchterliche Aussicht. Und da heißt es, für Ella Barth sei kein Platz! Oh Himmel, welcher Unverstand – Gura als Gilbert, Alten als Buenco, Nadler als Saint-George waren Katastrophen. Der ganze letzte Akt – trotz Goethe: warum wagt kein Mensch, das Warten Clavigos auf den Leichenzug und die Frage: wen begräbt man? – als glattes Plagiat nach dem Hamlet zu bezeichnen? – der letzte Akt also wirkte schimpflich. Ich war doch etwas böse auf Steinrück. Gewiß hat er schlechte Kräfte, mit denen er arbeiten muß. Aber er hätte diese ganze Clavigo-Aufführung nicht übernehmen sollen. Wozu ist denn der Oberlehrer Kilian da?
In der Torggelstube saßen Steiner, Weigert, Theaterdirektor Haas aus Köln, der im Union-Theater gastiert. Er spielt dort den soldatenschinderischen Unteroffizier in der „Kasernenluft“ – , ferner kamen vom Theater Rosenthal, Feuchtwanger und der weiche Mayer. Heftige Gespräche zwischen Rosenthal, Mayer, Feuchtwanger und mir über Reinhardts Volksfestspiel-Pläne, die Feuchtwanger bekämpfte, Rosenthal und ich aus total verschiedenen Gründen verteidigten – Mayer lag wie ein pflaumweiches Ei klebrig dazwischen. – Draußen saß Steinrück mit der Schaffer, Ergas und einer kleinen Gesellschaft, in einer andern Ecke Diegelmann mit vielen Leuten des Künstlertheaters und dicht neben uns an einem Tisch Stollberg mit Damen und Herr Alfred Holzbock, der berühmteste aller Schmöcke, den ich flüchtig kennen lernte, da er an unsern Tisch kam. – Ich ging dann mit Steiner Billard spielen ins Orlando. Haas und Weigert kibitzten. Dann kam Wedekind mit Hannes Ruch und dessen Frau ins Café. Gleichgiltige Gespräche. Auf dem Heimweg begleitete mich Direktor Haas. Wir sprachen viel über Theaterdinge. Ich empfahl ihm Ella Barth, die er zurzeit nicht einstellen kann. Aber die „Freivermählten“ soll ich ihm vorlegen. Damit wird es dieses Mal ebenso Schmuß sein wie immer.
Gestern sprang aus dem Silberring mit dem Mondstein, den ich seit einigen Jahren ständig trage, der mein liebstes Geschenk von Johannes ist, und mit dem noch nie etwas geschehen ist, ein Stückchen heraus. Ich bin sonst nicht sehr abergläubisch. Aber unter den augenblicklichen Verhältnissen macht mir der Zufall doch viel zu schaffen. Johannes! Johannes! Du spielst ein sträfliches Spiel mit mir!
München, Mittwoch, d. 30. August 1911.
Die Sorge um Johannes, die mich immer nervöser macht, verursacht mir Dummheiten, die recht bitter wirken und lähmt meinen Fleiß, daß ich schaudernd vor den drängenden Arbeiten stehe. Gestern habe ich nun wieder 60 Mark verspielt – und nun stehe ich vor der peinlichen Notwendigkeit, den Rest meines Berner Geldes abzuheben. Dann geht der Jammer der letzten 11 Jahre von vorn wieder an. – Ein gewisser Trost in diesen Tagen ist mir der Konsul, dessen Küsse immer süßer und immer mehr werden. Gestern und auch schon heute wieder konnte ich mich an ihrem Munde recht satt küssen. Es ist merkwürdig, daß ich mich unter diesen Umständen nicht heftiger in sie verliebe. Ich glaube fast, so ganz aussichtslos wäre ein Versuch, auch die beste Gunst von ihr zu erreichen, doch nicht mehr. Aber es gehörte dazu ein wildes Begehren, ein Nichtmehranderskönnen, ein Losgehn ohne Hemmung und ohne Zweifel – das ist alles noch nicht da, und es zu markieren, liegt mir garnicht. Seit gestern sagen wir uns Du. – Rößler ist bei diesem Techtelmechtel sehr komisch. Gestern fuhren wir drei über Schwabing, Englischen Garten, und Bogenhausen zur Torggelstube. Im Auto küßte ich das Mädel weidlich ab, und Rößler, der sonst tut, als protegiere er alles, was des Konsuls Anständigkeit korrumpieren könnte, litt sichtlich Eifersuchtsqualen. Ich mußte die Fahrt teuer bezahlen. Denn ich ließ mich zu einer Pokerpartie beschwatzen und verlor alles was ich hatte, in knapp zehn Minuten. Ich kannte die meisten Mitspieler nicht – und das Spielen mit Fremden bringt mir von jeher Pech. Außerdem läßt mich die ständige Unruhe wegen Johannes keinen Augenblick mehr zu der ruhigen Sicherheit kommen, die beim Pokern erste Bedingung ist.
Gestern war ich bei Steinebach. Ich habe noch immer keinen Korrekturabzug zu sehn bekommen. Es wird sehr gebummelt auf der Druckerei. Heut soll aber wenigstens die Wedekind-Sache soweit sein. – Nachher schickte mir Steinebach einen Brief aus Düsseldorf, in dem mich ein Herr Thomas für eine „Schande“ und mein Blatt für das allein würdige erklärt, einen Artikel von ihm zu drucken, der sich bei näherem Hinsehn als der letzte Dilettanten-Dreck erwies. Ich heckte eine Gemeinheit aus, um den Kerl zu strafen und zugleich noch jemand eins auszuwischen. Ich schickte es ihm nämlich mit einem liebenswürdigen Brief zurück und empfahl ihm, es an Karl Kraus zu schicken unter Berufung auf mich und auf Rößler, der sich über den Brief kaput lachen wollte. Kraus wird vor Wut zerspringen. Ungeheuer lustig wäre es, wenn er in der „Fackel“ die Sache publizierte. Da er garkeinen Humor hat, wäre es ihm zuzutrauen.
München, Freitag, d. 1. September 1911.
Von Johannes kein Wort, keine Nachricht über ihn, keine aufklärende Tatsache. Ich weiß nicht mehr, was ich davon denken soll. Ich mag und kann nicht an ein Unglück glauben, weil ich mir keines vorstellen kann, von dem mir keine Mitteilung geworden wäre. Handelte es sich um eine Verhaftung – und warum sollte er verhaftet sein? –, so wüßte er doch, mir aus dem Gefängnis Bescheid zu schicken. Ein Selbstmord scheint mir ganz ausgeschlossen, da er ja grade jetzt anfing, das Leben zu lieben und ihm zu vertrauen. – Ich muß immer noch denken, daß er sich ein paar Wochen mal ohne Zusammenhang mit außen wissen wollte, immer noch hoffen, daß plötzlich von irgendwoher ein Telegramm oder ein Brief eintrifft, in dem er Geld verlangt, oder daß er eines Tages plötzlich selbst bei mir eintritt. – Aber Iza? Gross? – Es ist alles sehr rätselhaft und beängstigend. Heut will ich an Margrit schreiben. Vielleicht weiß sie, vielleicht ahnt sie wenigstens etwas. Am meisten regt mich der Ring auf. Dies plötzliche Zerbrechen, und nun, da er gelötet ist, hat der Stein seinen Glanz verloren und ist dumpf und rauchig geworden. Ich bin sehr nervös und verzagt und weiß mir garnicht zu helfen.
Zu alledem noch andre Sorgen. Gestern holte ich mir den Rest des Berner Geldes von der Bank. Höchstens noch 14 Tage werde ich haben, was ich gebrauche. Dann geht das alte trübe Lied von Not und Entbehrung und Kränkungen wieder an. – Und nun erwarte ich Ella Barth, der ich versprochen habe, sie könne bei mir essen, und heut kam ein Brief vom Kätchen aus Ilmenau. Sie bittet mich um das Reisegeld hierher und will 14 Tage bei mir bleiben. Ich werde es ihr natürlich schicken, da ich sie nicht im Elend lassen will. Auch freue ich mich auf die Nächte mit ihr, der einzigen, die mich liebt. Nur weiß ich so genau, was bevorsteht. Sie ist am Tage oft unverträglich und wird mich nervös machen. Dann werde ich sie schlecht behandeln, sie nicht mitnehmen wollen, wohin ich gehe. Es wird Unerquicklichkeiten geben, und wenn sie gar mit Ella Barth zusammentrifft – Kätchen ist etwas eifersüchtig –, so wird mir daran womöglich meine Hoffnung, Ella für mich zu gewinnen – und das wäre bleibender Gewinn, ich fühle es deutlich – scheitern. Trotzdem: ich muß nun alles dem Verhängnis überlassen. Käme blos bald von Johannes Nachricht! Diese Geschichte verwirrt alles ins Unauflösliche.
Ich will aber über aller Wirrnis nichts versäumen hier einzuschreiben, was mir des dauernden Gedächtnisses wert scheint. Gestern war die Premiere der „Orestie“ in der Musikfesthalle der Ausstellung. Mir wurde dabei klar, daß das Werk des Aeschylos uns nicht mehr viel angeht. Das ist kein geschlossenes Drama wie Sophokles’ „Ödipus“, sondern ein schwerfälliger Aufmarsch von Geschehnissen, dessen polemische Strecken mich fast komisch anmuten. Im letzten Teil die Auseinandersetzungen, ob in Athen die Schwurgerichte zu empfehlen sind – was geht's uns an? – Und gar die rabulistische Entschuldigung des Muttermordes. Pallas Athene, die dem Hirn des Zeus entstammte, beweise, daß es nur eines Vaters bedarf, aber keiner Mutter! Man sollte die Orestie schlummern lassen! – Aber Reinhardts Tat war groß. Da fällt eine gewisse Sorte prinzipieller Gegner regelmäßig über ihn her, wirft ihm Mache und Sensation vor, und beweist damit die Kleinheit der Empfindung, die sich in niemand klarer dokumentiert, als in dem, der nicht anerkennen kann. Gewiß: Einzelheiten giebt es immer, die zu tadeln sind. Daß der Chor der Greise zum Beispiel lauter Glatzköpfe zeigt, wirkte auf mich etwas lächerlich, – aber was tut das gegenüber der Riesenleistung des Ganzen. Der Einzug des Agamemnon (Diegelmann) war gewaltig und erhebend. Die große Szene zwischen Orest (Moissi) und Elektra (Terwin) mit dem Chor der trauernden Weiber ganz erhebend, und wiederum der schleichende Lärm der Erinnyen ganz gewaltig (das „Festvolk“ grinste dabei). Total verfehlt war der Schluß des ganzen, eine Art Polonnaise, bei der sämtliche – gegen tausend – Mitwirkende noch einmal auftreten und abtreten. Störend wirkte auf mich auch die Ermordung der Klytemnästra (Feldhammer), die Orest erst über die Arena schleift, bis sich beide doch wieder die hohe Freitreppe hinauf in den Palast zurückziehen, wo der Mord geschieht. – An Einzelleistungen war die Moissis sehr bedeutend. Sein wundervolles Organ ergriff wohl jeden. Besondere Charakteristik war bei der Mächtigkeit des Raumes nicht gut möglich. Die gelang nur Einer, der Einzigen, Größten, Edelsten, Genialsten: Gertrud Eysoldt. Wie mich diese Frau (die Kassandra) wieder packte, kann ich nicht aussprechen. Regungslos saß sie zuerst und gekrümmt auf dem Wagen des Agamemnon, bis die sich aufreckte und ihre schrecklichen Seherin-Visionen herausjammerte. Diese Stimme! Diese Bewegungen! – Alle schauspielerische Genialität, die letzte Größe dieser obersten Kunst ist in ihr vereinigt. Sie ist mir der Inbegriff aller Kunst überhaupt. Die Terwin versagte leider. Ich fürchte nun doch sehr für das Moggerl, daß es ein schwerer Fehler war, zu Reinhardt zu gehn. Sie ist die Elektra nicht, die Aeschylos braucht. Sie hätte eher für die Kassandra getaugt. Aber da stand Gertrud Eysoldt! Und der Vergleich ist nicht möglich. Josef Klein (Aigysthos) war widerlich, ein Dutzendkomödiant mit Knödeln im Schlund. Dannegger in mehreren Nebenrollen bewies auch beim Tragödienspielen sein Kopiertalent, die Feldhammer war mir etwas zu laut, hatte aber Momente von wirklicher Größe. Diegelmann wirkte gut, ohne genial zu sein. – – Das Publikum – 3000 Plätze, dicht besetzt – war das vornehmste, das in Europa zu finden ist. Von allen Enden waren die Besten aus allen Künsten dabei. Ich traf viele alte Bekannte, die ich zum Teil jahrelang nicht gesehn hatte. Ich will nur einige Namen festzuhalten versuchen, mit denen ich mich persönlich begrüßte: Wedekind, Halbe Vollmöller, Kahane, Fritz Behn, Max Kruse, Bogumil Zepler (der Komponist), Waldau, v. Jacobi, Fritzi Schaffer mit Mann u.s.w., u.s.w. – Nachher war die Torggelstube gesteckt voll Menschen. Ich kam um ½ 3 Uhr nach Hause. – – Heut früh trank ich meinen Kakao oben bei Rößler. Die Küsse des Konsuls, von denen ich auch gestern schon Dutzende trinken konnte, sind jetzt anscheinend zu einer ständigen süßen Einrichtung meines Lebens geworden. Aber es scheint dabei bleiben zu wollen, es sei denn, daß sich ein freundlicher Zufall meiner erbarmt und die Situation schafft, die mir den Schlüssel zu höherem Glück in die Hand giebt.
München, Sonnabend, d. 2. September 1911.
Die Dinge komplizieren sich immer ärger. Von Johannes wieder nichts. Ich habe gestern an Margrit einen Allarm-Brief geschrieben. Kommt darauf keine Aufklärung, so schreibe ich an Dr. Hermann Nohl in Jena, – und suche dann eventuell persönlich die Schweiz ab. Das Furchtbare ist, daß ich nicht einmal eine Ahnung habe, was des Rätsels Lösung sein könnte. Denn gegen alle tragischen Vermutungen ebenso wie gegen alle freundlichen sprechen tausend logische Gründe. Es ist ein vollkommenes Rätsel, das meine Ruhe ganz verwirrt hat. – Gestern war Strich hier, – er kam von der Reise mit seinen Eltern zurück und fuhr abends nach Köln weiter, wo er Lotte trifft. Ich brachte ihn zur Bahn. Das war endlich ein Mensch, mit dem ich über das was mich quält, sprechen konnte. Aber auch da mußte ich zurückhalten, er hätte Ausbrüche nicht verstanden, auch nicht, daß ich, da es in mir so verworren aussieht, nicht sogleich abreise, den Freund zu suchen. Zu allem Überfluß kam gestern, als ich das Geld an Kätchen abgeschickt hatte, eine Postkarte von Ella Barth, die sich gleichfalls für Anfang der nächsten Woche anmeldet. Eine Kollision der beiden wird sich also wohl nicht vermeiden lassen. Ella bleibt nur 3–4 Tage, und ich soll inzwischen Steinrück bewegen, daß er sie Speidel vorstellt und sie vor dem Intendanten vorsprechen läßt. Hoffentlich kann ich was ausrichten. – In meiner Zerfahrenheit treibe ich inzwischen die albernsten Späße. Gestern trat ein neues Dienstmädchen ein. Kaum hatte ich das frühere, das jung und einigermaßen hübsch, jedenfalls aber gefällig und angenehm war, unter Küssen verabschiedet, begrüßte ich die neue, die weder jung, noch hübsch, noch nach irgendwelcher Richtung begehrenswert ist, mit Küssen und bestellte sie für die Nacht. Gottseidank kam sie nicht, – aber ich war blöd genug, mich drüber zu ärgern. Nun bleibt das Mädel monatelang hier in meiner nächsten Nähe – und ich weiß nicht, wie ich mich zu ihr zu verhalten habe. – Mir ist im Kopf, als müßte ich überschnappen.
München, Sonntag, d. 3. September 1911.
Noch immer kein Wort, keine Ahnung, kein Zeichen. Noch hoffe ich ja – noch kann vielleicht plötzlich ein Telegramm kommen: „Wo bleibt das Geld?!“ – Aber meine Hoffnung fängt an, schwach zu werden. – Hätte ich nur Vermutungen! – oder wenigstens – wenn es denn schon etwas furchtbares sein sollte: Gewißheit! – Morgen beginne ich, überall, wohin meine Stimme reicht und woher Aufschluß kommen könnte, Allarm zu schlagen. Seit dem 10ten August keine Nachricht. Ich wundre mich über meine äußerliche Ruhe, über den Gleichmut, mit dem ich alle Möglichkeiten, auch die entsetzlichsten, erwäge. Noch bringe ich es über mich, Vergnügungen, Zerstreuungen aller Art aufzusuchen, und solange ich es kann, will ich das betäuben, was in mir an grauenvoller Angst sich regt, und mir minutenweise wie aufsteigender Wahnsinn vorkommt. Ich trinke bedeutend mehr als gewöhnlich, bin faunisch geil, was sich in wüstem Onanieren lähmend geltend macht, in Gesellschaft forciert lustig und dabei unglaublich zappelig, was ich selbst nicht einmal merken würde, wenn mich nicht fortwährend andre darauf aufmerksam machten.
Die beste Ablenkung ist immer noch das Theater, wenn auch, wie gestern, das künstlerische Verlangen dabei arg zu kurz kommt. Es gab im Schauspielhause eine Première von Otto Gysae „Höhere Menschen“, Komödie in 3 Akten. Ein dummes albernes Stück Schwabing aus der Zigarrenhändler-Perspektive. Der Aesthetizismus wird mit wenigen seichten Personen, die dem Philister süffig eingehn, erledigt, die freie Ehe von der bürgerlichen Konvention her verspottet. Im Aufbau, in den dramatischen Effekten, im Dialog ein durchaus unzulänglicher Schmarrn. Aber so etwas wird aufgeführt, und meine „Freivermählten“, ein in jedem Betracht wertvolleres Stück bleibt liegen! – In der Hauptrolle zeigte sich zum ersten Mal der Nachfolger Waldaus, Herr Dumke, der den Schwabinger Aestheten genau nach dem Vorbild des frisierten Affen Waldemar Bonsels recht gut spielte. Einen leichten Zug von Rührung hätte die Figur noch brauchen können. Die Schaffer ging an. Ihre Art, in jedem Schwank die elegische Tragödin herauszustellen, paßte hier ganz gut her, wo es galt, in großer Pose sehr normal zu sein. Herr Jessen, der Vertreter der Autormoral war, wie immer, unmöglich. Randolf ist und bleibt eine Katastrophe. Recht nett war die Nicoletti, aber nicht aufregend. – In der Torggelstube war „heiliger Abend“ wie Gustel Waldau die Halbe-Gesellschaften nennt, infolgedessen großes Gewühl und viele Berühmtheiten. Ich begrüßte Consuela Nicoletti, die mit ihrem Geliebten, dem Regensburger Theaterdirektor abseits saß, und die im privaten Leben eine entzückende Person ist. Dann fuhr ich mit Gotthelf bummeln, erst in ein neu aufgemachtes Schwoflokal, „zum bunten Vogel“, wo die frühere „Dichtelei“-Wirtin die Honneurs machte, indem sie sich uns gegenübersetzte, und begann, mit ihrem Schuh meine Hoden zu kitzeln. Nachher noch „Simplizissimus“. Fränze war sehr nett. Ich ging die meiste Zeit mit Michel auf der Straße spazieren. – Ich muß abbrechen, da ich im Orlando-Café erwartet werde.
München, Montag, d. 4. September 1911.
Ich lebe in diesen schrecklichen Tagen wie ein Irrsinniger. Als ich gestern zum Orlando kam, stand ein Auto davor, in dem Consul saß. Drinnen trank Rößler mit Tilly Meißner (Jolly Jollanda) Kaffee. Ich setzte mich zum Consul ins Auto, und als Rößler kam, wurde lange debattiert, ob wir nach Puchheim zum Fliegen oder nach Daglfing zum Rennen fahren sollten. Da Rößler durchaus wetten wollte, während die Damen das Fliegen mehr interessierte, kam es schließlich so, daß Rößler allein nach Daglfing fuhr, ich mit den beiden Weibern nach Puchheim. Natürlich mußte ich die ganzen Kosten tragen. Die Autofahrt hinaus kostete allein 15 Mk. Dann natürlich Startplatz à 3 Mk für 3 Personen, und mit allem, was drum und dranhing, gab ich da draußen noch einmal etwa 20 Mk aus. – Aber es reut mich nicht. Ich hatte noch nie ein Flugmeeting gesehn, und ich hatte einen sehr starken Eindruck. Die Sicherheit, die Eleganz, mit der die Menschen ihre Apparate in den Lüften bewegten, imponierte mir mächtig, und ich kann wohl sagen, daß ich fürs Leben gern einmal mit hochgeflogen wäre. Durch den Consul lernte ich da draußen einen 22jährigen Flieger, namens Zillger kennen, der hier in der gleichen Pension wohnt wie wir. Als wir am Abend gemeinsam zurückfuhren, versprach er mir, mich im Winter mal mit auf einen Flug zu nehmen. Wir fuhren dann noch zum Franziskaner-Keller oberhalb Münchens, wo wir unter vielen braven Bürgern auf einer Terrasse saßen und schlecht aßen. Dann setzte man mich bei der Torggelstube ab. Dort lernte ich Herrn Dumke und Frau Carlssen kennen, die beiden, denen ich eigentlich den bevorstehenden Besuch Ella Barths zu danken habe. Die Carlssen war mit dem Direktor Karlheinz Martin vom Frankfurter Komödienhaus verheiratet, und hatte das Theater – ich glaube mit 400000 Mk – finanziert. Eines Tages ging sie mit dem ersten Liebhaber der Bühne, Dumke, durch und zog das Vermögen aus dem Unternehmen heraus. Martin verlor den Prozeß gegen sie und mußte die Bude zumachen. Damit war Ella, die dort sehr herausgestellt wurde, aufgeschmissen, und heute habe ich ihretwegen noch einmal an Steinrück und an Jacobi geschrieben. Übrigens ist die Carlssen wirklich sehr reizvoll und gefällt mir ausnehmend. Da mir die Gespräche mit der Schaffer, Ergas, Dr. Quincke und seiner literarischen Ehehälfte, Diegelmann, Feuchtwanger und einem der Herren, die mir neulich beim Pokern das Geld herausrissen, nicht zusagten, folgte ich der Aufforderung Gotthelfs, mich ihm, Strauß und dem Ehepaar Grünbaum anzuschließen und noch ins Café Orlando hinüberzugehn. Dort emanzipierte ich mich wieder bald und spielte mit Bonometti Billard. Da ich in seiner Gesellschaft Ludl traf, fiel mir ein, wie verwirrt ich in der letzten Zeit bin. Theatererlebnisse habe ich doch das ganze Jahr hindurch getreulich hier aufgezeichnet. Nun war ich vor einigen Tagen mit Consul im Gärtnerplatztheater bei der Léharschen Operette, „der Graf von Luxemburg“, wo Ludl sein großes Komikertalent sehr wirkungsvoll zeigte, – ich habe bei den Eintragungen hier völlig vergessen, davon Notiz zu nehmen. – Als alle aus dem Café fortwaren, und ich schon gezahlt hatte, um auch heimzugehn, sah ich meine kleine Hure von neulich dort bei einer Tasse Kaffee sitzen. Ich ging auf sie zu, um sie zu begrüßen. Aber Gott weiß, welcher Nerventeufel mich wieder kitzelte: ich forderte sie auch schon auf, mit mir zu kommen, zahlte ihre Konsumation, setzte sie in ein Auto und behielt sie bis früh um 8 Uhr bei mir im Bett. Ihre Sexualkünste sind erheblich, und ich leugne nicht, daß mir die Nacht wohlgetan hat. – Aber ist all das nicht irrsinnig, wo ich doch vor Angst und Aufregung fast berste? – Heut sandte ich ein Telegramm an Margrit ab. Denn, was mich am meisten irritiert, ist, daß mir auf meine Fragen kein Mensch antwortet. In Zürich und Bern weiß man offenbar nichts. Aber Frieda hätte aus meiner letzten Karte wohl ersehn können, daß sie aus bitterer Herzensangst heraus geschrieben war. Daß sie kein Wort der Aufklärung für nötig hält, da sie doch gewiß weiß, wo Otto ist, das kränkt mich arg. – Als Lotte vor Jahren unter Lycks Einfluß alles tat, was mich kränken konnte, liebte ich sie wie immer, aber gegen Lyck faßte ich einen Haß, der mich bis an den Tod nicht verlassen wird. Ich fange an, auch Frick zu hassen. Wehe ihm, wenn ich einmal sein Feind bin! – Lyck hat es büßen müssen.
München, Dienstag, d. 5. September 1911.
Nachricht von Johannes! – Ein Telegramm aus Doussard, Savoien, das so lautet: „Aufgeregt erwarten Monatsgeld mit Gratificat. Brief unterwegs. Herzlichst dein Johannes.“ – Natürlich habe ich gestern grade noch mal an Margrit telegrafiert (Es kam die Antwort: „Ich suche.“) und an Johannes‘ Bruder, den Privatdozenten in Jena geschrieben. – Das Geld habe ich telegrafisch losgeschickt, 50 Franken. Mit dem „Gratifikat" tut es mir leid. Ich habe in der Aufgeregtheit der letzten Tage soviel Geld hinausgeschmissen, daß der ganze Rest des Berner Riesenpumps noch 30 Mk beträgt. Freilich habe ich noch den Scheck über 100 Franken, den ich für Otto Gross ausstellen ließ, damit er seine Zeitschrift gründen könnte. Ich beabsichtige aber, das Geld nun doch lieber für mich selbst zu beheben. Ella und Kätchen sollen mich nicht als Bettelmann antreffen. Auch habe ich eben an Herrn Josef Kahn, Frühlingstrasse 13, geschrieben, den mir Lulu Strauß als Geldmann für Versicherungsgeschäfte nannte. Hoffentlich springen bei der Geschichte etliche Tausender heraus. Ich habe mich jetzt verflucht daran gewöhnt, mit großem Geld umzugehn. Wann der alte Herr im Himmel den alten Herrn auf Erden zu sich rufen wird, ist ja noch garnicht abzusehn. Vor 3 Tagen ist er 73 Jahre alt geworden. Ich hatte ihm einen zärtlichen Glückwunschbrief geschrieben und erhielt heute die Antwort auf einer Ansichtskarte in auffallend sicherer fester Schrift. Eine neue Einladung zu dem Familienklimbim und Mitteilungen über die Familie Wichmann. Daß Dr. Wichmann, unser aller Hausarzt, von Lübeck fortgezogen ist, interessierte mich immerhin.
Von gestern ist zu berichten, daß meine Erregung wegen Johannes allmählich Grade angenommen hatte, daß ich kaum mehr wußte, was ich tat. Ich habe merkwürdigerweise blos schwache Erinnerungen an den gestrigen Tag. Ich erinnere mich, daß ich mittags im Orlando mit Dr. Gotthelf Schach spielte, daß ich im Stefanie war, und abends in der Torggelstube. Details verwischen sich, und klären sich erst, während ich hier schreibe, wieder. Dr. Vahlen war da und Kutscher. Wir machten in hoher Politik. Herr Schmidt vom Künstlertheater hörte mit Staunen meine Weisheiten. Nachher ging ich mit Steiner Billard spielen ins Orlando. Die Marie holte uns indessen wieder hinüber, da Wedekind gekommen war, für den Steiner in Zürich war, um dort ein Gastspiel abzuschließen. Dort soll u. a. auch der „Totentanz“ gegeben werden. Hoffentlich kann ich es sehn. Es wäre ein netter Zufall, der aber möglich wäre, da heute von den Züricher Freidenkern die Aufforderung an mich kam, am 13. Oktober dort bei einer Ferrer-Gedenkfeier die Rede zu halten. Ich werde billigen Kostenersatz fordern und zusagen. – Und nachher wird ein Brief an meinen Johannes geschrieben, über den er sich wundern soll.
München, Mittwoch, d. 6. September 1911
Als ich gestern nachmittag nach Hause kam, mit der Absicht zu arbeiten – fand ich zu meiner freudigen Überraschung eine Visitenkarte von Ella Barth vor, auf der sie mich zu ½ 7 Uhr ins Stefanie bestellte und mir noch eine Überraschung in Aussicht stellte. „Viele Küsse“ kam dann. Ich freute mich so, daß der Brief an Johannes ganz sanft und zärtlich ausfiel. Dem kam allerdings auch noch zu Hilfe, daß Konsul nach mir sah und mir gute Küsse gab. Zum Arbeiten kam ich natürlich nicht. Schon um 6 Uhr saß ich im Stefanie und wartete. Ella kam – nett und elegant –, die Überraschung war Bubi Wolff, den sie von Berlin mitgebracht hatte – blos als zufällige Reisebegleitung, nicht wie ich zuerst annahm, in erotischen Eigenschaften. – Um ½ 8 Uhr sollte die Premiere von „Orpheus in der Unterwelt“ in der Musikfesthalle beginnen, und ich mußte hin. Rößler kam ins Café und Halbe holte uns per Auto dort ab. Ella fuhr auf gut Glück mit. Es gelang mir, Sobotka zu bewegen, ihr den Eintritt zu ermöglichen, freilich nur dadurch, daß ich ihr mein Billet geben mußte, und mich dafür den ersten Akt hindurch unter den Männergesangschor stellen mußte, wo ich durchaus nicht alles sah. Zum zweiten Teil fand sich, zwei Plätze von Ella entfernt, ein freier Sitz, den ich einnahm. – Mein Eindruck war kein besonders großer. Vor fünf, sechs Jahren sah ich die Operette schon einmal im Deutschen Theater in Berlin. Damals gefiel es mir besser. Die Reize der Offenbachschen Musik, der köstliche Gegenstand selbst sind so intim, daß sie nicht in die große Arena gehören. Gleichwohl war manches ganz außerordentlich schön und gelungen. Pallenberg als Jupiter war eine durchaus geniale Leistung – ungleich bedeutender als seinerzeit die von Engels. Die Jeritza (Eurydice) hat eine süße Stimme, Ritters Pluto war auch stimmlich bedeutungsvoller als schauspielerisch. Von den übrigen waren viele recht schwach, besonders die Werkmeister, die die Juno zu spielen hatte. Zettl wirkte als Styx hauptsächlich durch seine groteske Figur. Die Ausstattung von Stern war sehr nett, Reinhardts Regieleistung sehr bedeutend, das Publikum etwas weniger distinguiert als bei der Orestie. – Ich fuhr mit Ella per Auto in die Torggelstube, nachdem wir im Theater eine Reihe Freunde begrüßt hatten, darunter ich Frau Liesel Steinrück, die zarte kranke liebe Schönheit. Hatte ich mich auf Ellas Zärtlichkeiten gespitzt, so sah ich mich leider getäuscht. Sie schmiegte sich nah an mich an, ließ sich aber nicht küssen. Das kränkte mich umso mehr, als sie nachher in der Torggelstube ihre früheren Kollegen vom Deutschen Theater, Jacobi und Diegelmann coram publico abküßte. Bei mir scheint wieder der Bart schuld zu sein, daß ich die Barth nicht kriege. Um 2 Uhr brachte ich sie zum Hotel Schottenhammel und fuhr dann heim.
Eben wurde ich durch den Besuch des Herrn Kahn unterbrochen, der mir Geld verschaffen soll. Er meint, es wird gehn. Hoffentlich kommt dabei nicht wieder eine so verrückte Nervenkiste heraus wie seinerzeit auf dem Büro Caro, der mir eine Bank besorgte, die pumpen wollte aber kein Geld hatte.
Aus meiner Korrespondenz erwähne ich einen Herrn v. Krobshofer, der schon kürzlich an den Verlag schrieb, seine Zustimmung zum „Kain“ ausdrückte und eine lange Adressenliste für Probenummern angab. Das machte mir den Mann sympathisch, daß er sein Interesse nicht durch schleimige Begeisterungsbriefe an mich, sondern durch praktische Förderung betätigte. Dann schrieb er mir von Leoni aus, und bat um Aufklärung über den „Sozialistischen Bund“. Ich schrieb ihm ausführlich, sandte ihm „Sozialisten“ und sonstiges Material und bat um seinen Besuch, damit wir gemeinsam versuchen könnten, eine Bewegung à la Gruppe Tat von neuem in die Wege zu leiten. Ich würde es mit Studenten und Künstlern versuchen. Heut kam seine zustimmende Antwort. Leider kann ich ihn nicht am Donnerstag abend, für wann er sich anmeldete, empfangen, da ich dann mit Ella ins Lustspielhaus gehn soll. Aber ich hoffe, an dem Mann, der Kunstmaler ist, einen willigen Verbündeten zu finden. Es wäre prächtig, wenn in München wieder revolutionäres Leben entstände.
An Kätchen telegrafierte ich gestern abend noch, sie möchte nicht vor Sonnabend kommen. Die Karambolage mit Ella wäre doch lästig.
München, Donnerstag, d. 7. September 1911.
Ella ist ein sehr merkwürdiges Mädchen. Garnicht schön. Wahrscheinlich nicht aufregend geistreich – wiewohl klug und unterhaltsam. Klein und unscheinbar gewachsen, – und doch von einem Charme, einer bestrickenden Anmut, einer einschmeichelnden Zierlichkeit, daß ich allen Ernstes von ihr bezaubert bin. Das geht bis zur Lyrik, denn gestern ist – Herrgott, wie dürftig sickert meine Poesie seit langer Zeit! – ein Gedicht entstanden, das ich ohne Ella nicht hätte machen können („Du bist nicht schön, und dennoch lieb ich dich“ –). – Natürlich – ich habe jetzt keinen Zweifel mehr daran – hat sie doch mit Bubi Wolff ein Verhältnis. Ich bin sogar überzeugt, daß sie mit ihm zusammen im Hotel wohnt. Daraus mag sich Ihre Zurückhaltung mir gegen über erklären. – Dies schrieb ich vormittags. Herr Kahn unterbrach mich. Er blieb lange, und Rößler mußte mir 20 M. pumpen, die jener als Kostenvorschuß für seine Informationen bekam. Ich werde peinliche Dinge tun müssen: notarielle Erbschafts-Zedierung u. s. w. – außerdem wird die Geschichte höllisch teuer werden, – aber ich habe gute Chancen, in 4 Wochen 10000 Mark zu haben. Dann wäre für ein Jahr mindestens ausgesorgt. – Unmittelbar nach Kahn kam Ella; sie blieb zu Tisch, und wir gingen in die Maximilianstrasse, um Steinrück abzupassen. Er kam mit Adolf Paul, von dem im Hoftheater „Die Sprache der Vögel“ gegeben werden soll, von der Probe. Steinrück giebt sehr wenig Aussicht. Aber wir erreichten doch, daß Ella mit ihm ins Theater genommen wurde, um Speidel vorgestellt zu werden. Jetzt erwarte ich sie hier, nachdem ich erst beim Drucker, dann bei der Deutschen Bank war, wo ich den Scheck für Otto Gross gegen 80 Mk 50 Pfg. eintauschte. Gottseidank, die nächsten Tage gerettet! – Wie alles immer möglichst ungeschickt kollidiert, so fand ich eine Briefkarte von meinen Vettern Martin und Walter Mühsam vor. Die Wirtin berichtete, es seien drei Vettern dagewesen (es scheint also auch noch das Rindvieh Kurt dabei zu sein), und erwarten mich nun im Stefanie. Mögen sie warten! Ella ist mir wichtiger, und mit der gehe ich abends ins Lustspielhaus zu Batailles „Skandal“. Weigert hat eingereicht.
Heut kam ein langer und sehr lieber Brief von Johannes. Er ist mit Gross und Iza in Doussard und fährt heut nach Bern zurück. Was er über Gross berichtet, ist hocherfreulich. Seine Gesundheit soll bestens beschaffen sein, und er will jetzt freiwillig in eine Anstalt gehn, um sie völlig reparieren zu lassen. Seine infamen Eltern haben ihn inzwischen heimlich in der Schweiz observieren lassen, um ihn mit Gewalt zu internieren. Er erhielt durch die bodenlose Dummheit der Polizei zufällig Kenntnis davon und floh nach Frankreich. Er schreibt selbst ein paar Worte. Er habe auf Landauers Angriff geantwortet und lege den Antwortbrief von Landauer bei. Darin schreibt Landauer, er müsse den Artikel erst einem andern, der über die Annahme allein entscheiden könne, schicken, und der sei jetzt auf Fußwanderungen. Natürlich ist dieser andre nicht, wie Johannes empört meint, Berndl, sondern Buber. Gross bittet mich schließlich, im Falle der Ablehnung von Landauers Seite, den Artikel im „Kain“ zu drucken. Ich müßte das natürlich tun – so schwer es mir um Landauers Freundschaft willen wäre, und so schwierig ich es bei meinen begrenzten Raumverhältnissen könnte. Der Schlußsatz von Ottos Brief lautet: „Zu Frieda habe ich mündlich sprechen können – war eingedenk!“ – Ach, wer weiß, wie Frieda mir jetzt gesinnt ist. Heute zeigte ich Ella ihr Bild, und als sie es wunderschön fand, ohne zu wissen, wer mir Frieda war und ist, da kamen mir Tränen und ich sah zum Fenster hinaus.
München, Freitag, d. 8. September 1911
Es ist abends ½ 8 Uhr. Eigentlich sollte jetzt Ella zu mir kommen, sie wollte dann bis zum Zuge bei mir bleiben, da sie 10h 10 fährt, und diesen Moment klingelt Wolff an, sie sei müde und erwarte mich um 9 Uhr im Café Karlsthor. Das verpatzte mir die ganze gute Stimmung, in der ich bis jetzt war. Damit ist meine Hoffnung, sie noch einmal tüchtig küssen zu können, beim Teufel. Ein einziger Kuß, zu dem sie mir gestern den Mund hinhielt, muß jetzt die Träume an dies – sag’ ich’s nur: geliebte Mädchen ausfüllen, das mir schon jetzt Erlebnis ist und alles hat, um mir für das Leben gute Werte und Gefühle zu geben. – Als sie gestern bei mir war, da waren wir uns wirklich nahe. Sie weinte über ihr Mißgeschick, und ich redete ihr mit aller Freundesliebe zu. So saßen wir lange Hand in Hand, Schulter an Schulter. – Wir wurden durch den Besuch der Vettern gestört. Martin Mühsam kam mit einem Neffen meiner Kusine Laura, einem Herrn Rosenthal aus Argentinien. Ella saß während des Besuches stumm im Lehnstuhl und beobachtete. Martin und ich führten die Gespräche. Er ist ein feiner stiller Mensch, nur sehr jüdisch im Aussehn und sehr österreichisch im Gehaben. Der andre machte mir einen reichlich törichten Eindruck. Ich bestellte sie, da ich mir den letzten Tag, wo Ella hier ist, nicht zerreißen lassen wollte, für heut abend um 11 Uhr ins Stefanie. Dort wird dann auch Vetter Walter Mühsam dabei sein. – Als sie fort waren, war die ganze Stimmung umgeschlagen. Ella erzählte mir sehr lustige Dinge aus ihrem erotischen Leben, sodaß ich über ihre Offenherzigkeit erstaunt war. Sie erklärte mir, ich solle mich nicht um sie bemühen, sondern nur ruhig alles ihr überlassen. Eines Tages könne es sein, daß sie mir plötzlich sagen würde: „Mühsam, heute geh ich mit dir schlafen.“ Nachher war sie furchtbar lieb zu mir, und nannte mich – das will viel sagen, da sie Lotte sehr liebt: Mein Pumabub! – Lotte hat ihr von unsern Beziehungen erzählt, so freute ich mich, einmal ohne Hinterhalt und Befürchtung frei vom Herzen weg das Puma preisen zu können. Nach dem Abendbrot gingen wir ins Lustspielhaus, wo wir in der vordersten Orchester-Fauteuil-Reihe, also unmittelbar vor der Rampe saßen. „Skandal“ von Bataille ist ein ganz niedriges Dreckstück. Allerplumpste Effekte, der Handlungsaufbau noch nicht einmal geschickt, und alles von einer ekelhaften Bürgermoral aus gesehn. „Die törichte Jungfrau“, die auch ein Reißer ist, ist immerhin noch ein weit besseres Stück als diese Scheußlichkeit. Die Roland war aber sehr gut, besser als ich sie bis jetzt jemals sah: ihre angeborene Indezenz kam ihr bei dem Spektakel zu statten, und ihre große Routine und starke Begabung kamen vorteilhaft zur Geltung. Die männliche Hauptrolle spielte ein Herr Feist, der mit den aufgetragensten Schmierenmätzchen arbeitete, in jeder Minute wie ein andres Tier aussah, fauchte, schnaubte, die Augen rollte, die Backen blähte und sich unsagbar lächerlich aufführte. Ein Kulissenreißer ärgster Sorte. Weigert war mäßig. Ich begreife nicht, woher er immer noch diese glänzenden Gastspiel-Einladungen und die hohen Gagen hat. Ein mittelmäßiger Schauspieler, ohne jede starke eigne Note. Im Foyer hatten wir Bubi Wolff getroffen, der sich neben uns eine Karte nahm. Ella mußte während der tragischsten Szenen über die grotesken Verrenkungen des Herrn Feist dermaßen lachen, daß ich jeden Moment fürchtete, wir würden hinausgeschmissen werden. Aber das Schauerstück ging vorüber, ohne daß der „Skandal“ sich ins Publikum verpflanzt hätte. Nachher gingen wir noch mit Wolff und Gottowt, der auch zu dem Mist mitgewirkt hatte – ein begabter Mensch, der nur immer den gleichen Juden hinstellt – ins Stefanie. Wolff fuhr mit Ella heim, die mir gestanden hatte, daß sie als Frau Wolff im Hotel vermerkt ist, und ich ging zur Torggelstube. Dort setzte ich mich, da am Haupttisch u. a. der ekelhafte Dr. Brecher saß zu Seppel und ihrem Herrn Schmitz, bis plötzlich eine Menge Menschen hereinkamen, darunter der Verleger Müller, Hanns Heinz Ewers, Adolf Paul und noch etliche. Die Gesellschaft war mir zu groß, und ich setzte mich jetzt an den Tisch, an dem Waldau, Mia, Strauß, Rößler und Schmidt beim Poker saßen. Zuerst verlor ich fast alles was ich hatte, erholte mich aber immer wieder einigermaßen, und gewann durch ein paar günstige Konstellationen zum Schluß ein paar große Pötte, sodaß mein Gewinn endlich, obwohl ich noch einige Male ziemlich fühlbar verlor, 70 Mark betrug. Ein Blatt wird mir in Erinnerung bleiben. Ich behielt, da ich schon etwa 10 Mark im Pott hatte, die ich nicht ohne Kampf verlieren wollte, von fünf ganz unbrauchbaren Karten drei von der gleichen Farbe in der Hand: Herz 4, Herz 5 und Herz 7, und kaufte zwei in der sehr vagen Hoffnung, entweder Flush oder Street zu bekommen, andernfalls aber auf Drilling zu bluffen. Ich kriegte Herz 3 und Herz 6, sodaß – ein wohl ganz einziger Fall – auf zwei auseinanderliegenden Karten ein Street-Flush herauskam. – Um ½ 4 Uhr erst brachen wir, da Rauschenbusch Energie zeigte, auf.
Heute früh sollte ich Ellas Anruf erwarten. Statt ihrer klingelte aus dem Stefanie Emmy an, sie sei von Flensburg zurück und habe ihr Kind bei sich, das sie mir zeigen möchte. Ich ging hin und lernte die kleine Anne-Marie, die 5 Jahre alt ist, kennen. Ein reizendes Mädelchen, das sich gleich sehr mit mir befreundete. Heut hat Emmy es ins Kloster gebracht, wo es gratis verpflegt und erzogen wird. Hoffentlich paßt Emmy den richtigen Moment ab, wo sie das Kind da herausnimmt und vor dem Pfaffeneinfluß schützt, ehe er verwüstend wirkt. – Ich ging dann heim und ging hinauf zu Rößler und Konsul, die mich mit Küssen geholt hatte. Bald wurde ich wieder heruntergerufen. Emmy war da und pumpte mich um 15 M. für das Kind an, da sie diese Summe für Wäsche und Kleidung brauchte. Ich gab sie ihr natürlich. Emmy war sehr zärtlich, schob mir die Zunge tief in den Mund und fingerte aufgeregt an meinen Hoden herum. Ich entließ sie bald und holte Konsul zum Mittagessen herunter. Dann ging ich mit zu ihr hinauf. So zärtlich wie heute war sie noch nie, und zu meinem größten Erstaunen sagte sie mir ganz spontan, daß sie mich lieb habe, sie hoffe, bald hier bei Stollberg ins Engagement zu kommen. Dann sei sie frei und wolle mir ganz gehören. Rößler betrügen wolle sie nicht, er sei so gut zu ihr und habe sie gebeten, brav zu sein. Er sei auch sehr eifersüchtig. Die Liebe dieses schönen Mädchens zu haben, ist mir ein beglückendes Bewußtsein. Ich hörte ihr die Traute in Hartlebens „Rosenmontag" ab, und konnte dabei feststellen, daß sie sicher gutes Talent hat.
München, Sonnabend, d. 9. September 1911.
Mein ganzes Tagewerk besteht nun schon lange darin, daß ich das Tagebuch vollschreibe. Irrsinn umsomehr, als ich grad jetzt Dinge erlebe, die mir im Gedächtnis haften würden, auch wenn ich hier nur Namen und knappe Andeutungen notierte. Aber ich will die Arbeit fortsetzen, wie ich sie bisher geführt habe. – Auch gestern wieder wurde ich von Rößler beim Einschreiben in dies Heft unterbrochen, und fuhr nun mit ihm per Auto in die Stadt. Unterwegs erfuhr ich, daß er grade eben mit Konsul gebrochen habe. Seine Eifersucht scheint ihm da einen netten Streich gespielt zu haben. – Gestern wollte ich grade, als er kam, den Witz vermerken, den ich nachmittags gemacht hatte. Während ich Konsul ihre Traute-Rolle abhörte, wobei ich den Hans markierte – jede in den Regievorschriften bestimmte Umarmung dehnten wir unter zärtlichen Küssen möglichst lange aus, klopfte es, und Rößler steckte den Kopf mit der Frage zur Tür herein: „Na, was macht ihr da?“ – „Oh nichts“, antwortete ich, „wir spielen blos Traute und Hans.“ – Danach ging ich laut Verabredung mit Ella ins Café Orlando, wohin sie um 4 Uhr kommen wollte. Sie kam um 5 Uhr und traf mich mit Gotthelf beim Schachbrett. Zettel kam hinzu, und Gotthelf lud uns alle zu einer Autofahrt in den Nymphenburger Park ein. Nach einem Spaziergang durch die herrlichen Anlagen, bei dem Ella sehr lustig war, fuhren wir zurück, setzten Ella bei ihrem Hotel ab – und daß sie zum Abendbrot zu mir kommen sollte, aber nicht kam, sondern mich durch Wolff telefonisch in ein Caféhaus bestellte, berichtete ich schon. So konnte ich gestern garnicht mit ihr allein sein, denn Bubi war auch abends bei ihr, und wir setzten sie gemeinsam in den Zug. Auf dem Bahnhof, während Wolff ihr Gepäck besorgte, beklagte sie sich, daß er sie nicht losgelassen habe, und versprach auf das Festeste, sie werde, sobald sie ein Engagement habe, die Zeit bis zum Antritt in München verbringen, in dieser Pension hier wohnen, und mich ganz mit diesen enttäuschenden Tagen versöhnen. An Steinrück trug sie mir auf zu bestellen, daß er sie sehr enttäuscht habe, ebenso Jacobi. Sie glaubt, daß selbst, wenn keine Freundschaft die beiden zu Schritten für sie hätte veranlassen können, ihr Talent Anspruch darauf hätte, daß man sich dafür rührt. Wir trennten uns mit einem guten tiefen Kuß. Mir waren die Tränen sehr nahe.
Als der Zug abgegangen war, stand noch ein Sonderzug auf dem gegenüberliegenden Geleise, der ebenfalls nach Berlin ging. Ich erblickte plötzlich Moissi davor, nachdem Dworsky mich schon begrüßt hatte. Bei Moissi standen seine Schwester, das Moggerl und Professor Fritz Behn, mein alter Schulkamerad. Moissi fuhr ab, das Moggerl war von gleichem Abschiedsschmerz erfüllt wie ich und fuhr mit Behn im Automobil davon. Ich begab mich zu den Vettern ins Stefanie. Der jüngere ist nicht ein Neffe, sondern der Sohn Lauras: Erich. Walter machte mir einen ganz guten Eindruck. Ein hübscher forscher Kerl. Er hatte ein Mädel bei sich, das allerdings nicht auf einen differenzierten Geschmack des jungen Mannes schließen ließ. Wir blieben etwa eine Stunde beisammen. Dann ging ich in die Torggelstube. Muhr ist von seiner Sommerreise zurück. Später kam Lux und Gotthelf, mit dem ich dann noch bis 3 Uhr nachts im Orlando Schach spielte.
Die Reihenfolge dieser Aufzeichnungen hat leider etwas gelitten. Rößler berichtete mir auf der Fahrt im Auto, er habe zum Consul hineinwollen, die Tür sei aber verschlossen gewesen, und der Zilger sei bei ihr gewesen. Es sei eine Perfidie von ihr, ihn im Nebenzimmer zu betrügen, zumal er darmkrank im Bett gelegen hatte. Er war sehr bewegt. Ich verteidigte natürlich krampfhaft den Konsul. – Heut früh nahm ich mir aus dem Stefanie Emmy zum Essen mit. Nach Tisch knöpfte sie mir die Hose auf. Ich legte mich auf den Divan, und sie begann mir Minett zu machen. Während dieser reizvollen Beschäftigung klopfte es an die abgeschlossene Tür. Ich glaubte, es sei das Mädchen, das abräumen wollte und rief: „Bitte warten Sie noch!“ – Kurz darauf des Konsuls Stimme: „Mühsam, dauert es noch lange?“ – Ich: „Oh, ich bin grade bei der Toilette. Ich komme gleich zu dir herauf!“ – Emmy mußte über unsere Situation und das Gespräch so lachen, daß ich davon mitgefaßt wurde, und wir nicht zum Ziel kamen. Ich verabschiedete Emmy eiligst und sprang zum Consul hinauf. Zilger war bei ihr. Die beiden versicherten, daß die Tür, als Rößler hineingewollt habe, garnicht verschlossen gewesen sei, sondern sich nur geklemmt habe (ich glaube es ihnen). Der Konsul ist wütend über Rößlers Verhalten und bedauert jetzt, daß nichts zwischen ihr und Zilger passiert sei. Jetzt küßte sie ihn ostentativ und hat den jungen Kerl natürlich schon so verliebt gemacht, daß Rößler in den allernächsten Tagen sicher Grund zu seinem Argwohn haben wird. – Ich werde mal wieder meinem Strich gegenüber gewählten Pseudonym „Fischer im Trüben“ Ehre machen. Als Zilger fort war, küßte mich Konsul mit wahrhafter Leidenschaft immer wieder. Ich sagte ihr: „Solange ich dich nur küssen darf, werde ich dich betrügen.“ – „Dann aber nicht mehr!“ rief sie. – Ich antwortete: „Dann wirst du nie etwas merken“ – und sie war zufrieden.
Morgen, spätestens übermorgen erwarte ich Kätchen, von der heut ein netter Brief kam. Ich werde die Zeit ihres Aufenthalts zu intensivem Arbeiten benutzen. Vielleicht kann ich ihr dies oder jenes diktieren. Dann werden die Tage erträglich sein – und die Nächte: ach Kätchen! Da ist keine so süß, so begabt und so bei der Sache wie Du!
München, Sonntag, d. 10. September 1911.
Schon wieder sehr verzweifelt. Heut früh um ½ 6 Uhr kam ich nach Haus, ausgemistet ist kein Ausdruck. Rößler hatte mich abgeholt, und wir waren um 7 Uhr abends in die Torggelstube gegangen, um nach dem Abendbrot einen Kientopp aufzusuchen. Ich hatte es so vorgeschlagen, weil ich Rößler in gute Stimmung bringen, und ihn wieder mit Konsul versöhnen wollte. Es scheint bis jetzt mißlungen zu sein. Nach dem Essen nahmen wir beide die Karten vor und spielten Écarté und Poker zu zweien, wobei ich 4 Mk 50 verlor. Inzwischen kamen Leute: Professor Max Kruse, der „kalte Max“, wie ihn Rossius zu nennen pflegte, dann Lucie von Jacobi mit einer reizenden Freundin, die glaube ich Maja Sehring heißt, Schauspielerin ist, sehr graziös und unterhaltsam und mir recht gut gefiel. Der unmögliche Herr Brecher, den ich demnächst abschaffen werde, war mit der hübschen Frieda Münzer da, H. H. Ewers und Seppels Herr Schmitz kamen, Bernhard von Jacobi, dem ich deutlich Ellas Meinung sagte – Gegen 1 Uhr brachen wir auf und fuhren zu Gotthelf pokern, eine Gesellschaft, die sich aus dem Café Orlando einfand und so zusammensetzte: Gotthelf, Muhr, Charlé, Rößler und ich. Mein Vermögen betrug 60 Mark und 20 österreichische Kronen, die mir R., der vorgestern hier war, für abgesetzte „Kains“ ablieferte. Ich verlor zuerst alles, pumpte während des Spiels von Rößler 75 Mk und gewann dann mit dem letzten 10 Markstück soviel, daß ich hätte mit Gewinn aufstehn können. Da verlangte Rößler Geld zurück, ich gab ihm 30 Mk wieder, und von dieser Minute an verlor ich ununterbrochen, sodaß ich von Gotthelf noch 20 Mk, von Charlé 44 Mk pumpen mußte. Erst ganz zum Schluß bekam ich soviel zurück, daß ich 70 Mk bares Geld und die Schulden hatte. – Gegen 4 Uhr wurde dann noch ein Baccarat eröffnet, und nun verlor ich den ganzen Rest bis auf 4 Mk. Auf dem Heimweg pumpte mir Rößler dann noch 20 Mk, damit ich nur überhaupt etwas habe. Aber ich bin sehr traurig, denn von der Bank giebt es nichts mehr zu holen, und nun ist alles wieder so hoffnungslos, wie es war. Meine Schuhe sind durch, und ich brauche neue, die ich jetzt nicht kaufen kann. Morgen kommt Kätchen, und ich kann ihr nichts bieten. Und das Ärgste ist, daß ich die 17 Mk, die R. abgeliefert hat, nun nicht an Steinebach abführen kann. Es wird ein übler Monat werden, dieser September. Wenn nur das Wuchergeschäft mit dem Herrn Kahn zustande käme! Dann wäre wieder eine längere Weile aller Kummer abgestellt. – Ach, wie dumm, wie dumm von Papa, daß er mich so auf seinen Tod hoffen läßt!
Ich muß endlich an die Arbeit. Wie soll das nur mit dem Kalender werden, der in ein paar Wochen erscheinen soll? Und von der nächsten Kain-Nummer weiß ich noch kein Wort, das hineinkommen soll. Heinrich Mann schrieb mir von Italien aus, daß ihm bis jetzt jede Nummer vor den früheren besser scheine. Ich freue mich sehr über solche Zustimmungen. Hoffentlich flaut meine Energie nicht ab. Vielleicht ist der plötzlich wieder eingerissene Dalles dazu gut, daß ich mit umso heftigerem Fleiß wieder an die arg vernachlässigte Arbeit gehe.
München, Dienstag, d. 12. September 1911.
Um kurz nachzuholen: Sonntag traf ich nachmittags im Orlando Liesel Steinrück – mit ihrem Mann, Adolf Paul und Lina Woiwode. Ich liebe Liesel sehr.
Die arme schöne Frau ist am Erlöschen. Von ihrer Lunge kann nur noch wenig da sein, von Jahr zu Jahr schwindet mehr von ihr hin. Jetzt spricht sie nur noch ganz leise und wenig. Mir sagte sie wegen des „Kain“ Schmeichelhaftes.
Abends telefonierte mich Frieda König, das frühere Stubenmädel an. Ich versprach ihr in plötzlichem Entschluß meinen Besuch. Um 9 Uhr war ich bei ihr in der Clenzestrasse. Sie erwartete mich auf der Straße und führte mich dann heimlich ins Haus. Ich war gerührt über ihre nachhaltige tiefe Liebe zu mir. Sie wollte mich in Küssen ersticken, und versicherte mir, daß sie mich immer noch rasend liebe. Wir gingen zu Bett. Ich freute mich, wie sich ihr Körper entwickelt hat. Sie hat, wie sie mir eingestand, ein paar Liebhaber gehabt, und das ist ihr sehr gut bekommen. Ein schöner starker gesunder Frauenleib von prachtvoller Sinnlichkeit. Ich werde öfter zu ihr gehn.
Der Konflikt Rößler-Consul ist durch meine Bemühung glücklich behoben. Consul berichtete mir merkwürdige Dinge von Rößler. Sie habe ihm versprechen müssen, keinen Mann außer ihm zu küssen, – natürlich durchbrach sie den Eid ein Dutzend mal schon während ihrer Erzählung. Mir erklärte Rößler, er wäre froh, wenn ich sie ihr abnehme. Aber seine Verzweiflung in den letzten Tagen zeigt mir, daß er gegen mich nicht ehrlich ist. Ein komischer Kerl. Sollte doch froh sein, mit seinen 48 Jahren noch so ein reizendes 21jähriges Ding zu kriegen, und ihr das Leben nicht erschweren. Selbstverständlich lege ich es jetzt darauf an, ihn zu betrügen. Es wird gelingen.
Gestern abend Residenztheater: „Die Sprache der Vögel“. Komödie in 3 Akten von Adolf Paul. Inszeniert von Steinrück. Eine aesthetisch schöne Belanglosigkeit. Ein Strindbergsches Weib wickelt ihren Kerl und auch den weisen König Salomo um den Finger. Daß zum Schluß die Sprache der Vögel, die Salomo seinen Freund lehren soll, die Sprache der Natur ist, ist hinlänglich trivial. Salomo sagt als Raisonneur allerlei von hübscher Ironie. Die Sprache ist vom ganzen das beste. Wedekind saß unmittelbar vor mir. Wir unterhielten uns in der Pause über das Stück. Er meinte, es sei töricht, immer wieder den Charakter des Weibes als Gattung auf die Bühne zu bringen. Derartige Gegensätze, wie sie zwischen Mann und Frau konstruiert werden, gebe es nicht. Ich habe ähnliche Empfindungen. Ich fand es besonders falsch, die gesunden Menschen des biblischen Orients allesamt als Hysteriker aufzufassen. An dem Gespräch beteiligten sich der weiche Meyer und Eva Gräfin Baudissin. – Steinrücks Regie war wieder sehr glücklich, sein Salomo eine ganz hervorragende Leistung, wenngleich – besonders im letzten Akt – seine verfluchte Lernfaulheit wieder sehr peinlich aus dem Souffleurkasten hörbar wurde. Aber seine Gestalt, sein Gestus, sein Organ wirkten prachtvoll, die weise Majestät. Graumann als sein Vertrauter und Freund war recht mangelhaft. Die Körperlänge allein tut’s nicht. Liebhaberrollen sollte man dem Mann nicht an einem Theater geben, das Bernhard v. Jacobi hat. Zum ersten Mal trat die Nachfolgerin des Moggerls, Frl. Michalek auf – und enttäuschte. Konventionelles Spiel, ohne Persönlichkeitswerte, ohne Innerlichkeit. Man sieht ihr das Erwarten der Stichworte an und liest von ihren Gesten die Regiebemerkungen ab. Vielleicht wird unter Steinrücks Leitung noch was aus ihr. Ich dachte häufig an die Terwin, – noch häufiger an Ella Barth, die aus dieser Rolle beide etwas sehr Gutes gemacht hätten. Der Beifall am Schluß war sehr mau und galt hauptsächlich Steinrück. Ich hörte nachher vom Publikum nur abfällig über das Ganze reden. Die Schönheit der Sprache schien an den Leuten vorbeigegangen zu sein. Genügt auch nicht.
Nachher Torggelstube, wo ich ein reizendes Mädel vom Künstlertheater traf, das ich schon Sonntag, unmittelbar nachdem ich aus dem Bett des verliebten Mädels gekommen war, kennen gelernt und heftig poussiert hatte. Sie heißt Peppi Kirchhoff und reagierte auf meine Zärtlichkeiten, indem sie ihr Knie an meins preßte und vertraulich mit mir füßelte. Ein entzückendes frisches Mädel von der sympathischen Kitschigkeit der Lina Woiwode (die natürlich schöner ist) und der differenzierten Merkwürdigkeit der Tini Senders (die natürlich ungeheuer viel häßlicher ist).
Gestern kam ein zwölfseitiger Brief von Frieda aus Ascona, den ich ihrer Aufforderung entsprechend vernichtet habe. Sie teilt mir darin ausführlich die Infamien der Eltern Gross’ mit und verlangt zu wissen, was ich über Ottos und Johannes’ Aufenthalt wüßte. Die letzten 4 Seiten, die persönliches berühren, hebe ich auf. Bei aller Sachlichkeit haben sie einen so guten Unterton, daß ich sie nur mit feuchten Augen lesen kann. Ach, alle alle Frauen in Ehren: lieben, leidenschaftlich, glühend, ins Ewige hinein lieben kann und werde ich immer nur diese eine.
Heut abend kommt Kätchen. Hoffentlich wird’s nett werden. Der Dalles wird bis dahin insofern gemildert sein, als ich heut mit Herrn Diro Meier, dem Vertreter von Fuhrmann ausmachte, daß er 2 Gedichte von mir kriegen, und ich mir dafür noch heute 50 Mk Vorschuß vom „Kometen“ holen soll. Höchste Zeit.
Der „Drei Lilien-Verlag“ in Karlsruhe fragt an, ob ich ihm nicht ein Buch geben wolle, etwa ältere verstreut erschienene Aufsätze gesammelt. Ich werde natürlich zustimmend antworten. Das Buch wird heißen: „Scheinwerfer. Essays aus der Künstlerperspektive.“
München, Mittwoch, d. 13. September 1911.
Kätchen ist da. Wir haben eine prachtvolle Nacht hinter uns, von der ich mich im Ungererbad erholt habe. Sie wohnt im Nebenzimmer, und die Wirtin läßt kupplerisch an meiner Seite den Kleiderschrank, an ihrer das Sofa von der Verbindungstür entfernen. – Wie es mit der Bezahlung des Zimmers und des Essens wird, das ruht im Schoße der allmächtigen Götter. Gestern bekam ich von Velisch (Komet) 50 Mk, – aber 20 davon sind schon fort. Ob aus der Kahn-Sache was wird, ist ebenfalls noch ganz zweifelhaft. Ohne Eintragung in die Grundbücher ist sehr schwer etwas zu wollen, und daran hindert mich der Familienkontrakt und die Sentiments. Wer jetzt gottgläubig wäre und beten könnte!
München, Donnerstag, d. 14. September 1911.
Kätchen macht Besorgungen. So komme ich zur Eintragung, und später vielleicht auch noch zum Arbeiten. Meine Bedenken, das brave Mädchen kommen zu lassen, erweisen sich als ausreichend gerechtfertigt. Ihre Umständlichkeit und Langsamkeit sind kaum erträglich, und wäre sie nicht nachts so ungemein willig und temperamentvoll, würde ich sie zu allen Teufeln wünschen. Besonders ist sie mir auch pekuniär recht bedrohlich. Die Angst, wie ich ihr Zimmer und die Pension hier zahlen soll, bleibt ja noch bis zum 1. Oktober im Rückhalt, aber ihre kleinen Bedürfnisse! Zunächst mußte ich schon fast 7 Mark für ihr Gepäck zahlen, dann die Autofahrten, Caféhaus. Heute brauchte sie Strümpfe, kurzum: sie kostet mehr als ich habe und auftreiben kann. Ein kleiner Pokergewinn (20 Mk) half über heute hinweg, aber da ich mir ein Paar Schuhe (12 Mk) kaufen mußte, bin ich doch sehr in Druck. Könnte ich sie nur rasch verkuppeln! Ich denke an Gotthelf. Der jammert, daß er kein Mädchen hat, und bei seiner Nasenlosigkeit wird er schwerlich sobald ein so nettes wie das Kätchen finden. Ich könnte sie leicht verschmerzen. Erstens wäre sie mir zum Betrügen eines andern stets zur Verfügung, dann zweifle ich nicht mehr, daß mich der Besitz Consuls nur noch einen Griff kosten wird. Heut vormittag kam ich zu ihr hinauf und fand die Tür verschlossen. Sie öffnete, als sie hörte, daß ich es sei, und ich fand sie beim Anziehen, ohne Bluse, im Unterrock, den sie in meiner Gegenwart auszog. So sah ich ihre wunderschönen langen graden schlanken Beine, die von durchsichtigen schwarzen Strümpfen bis über das Knie bedeckt waren. Darunter zeigten sich mir die nackten weißen Schenkel. So küßte ich sie, und sie ließ es zu und küßte mich heiß zurück. Dann ging ich mit ihr ins Stefanie. Sie bejammerte das Ehrenwort, das sie Rößler gegeben hat, sie werde ihm „treu“ sein. Ich suchte sie zu verderben, indem ich ihr gutes Gewissen zum Wortbruch machte. Ich deduzierte so: Hat Rößler von dir das Ehrenwort verlangt, so tat er es zu seiner Beruhigung. Du hast es ihm gegeben, und also ist er beruhigt. Ist er es nicht und spricht einen Verdacht aus, so berufst du dich auf das gegebene Wort und bist beleidigt. Gleich wird er wieder beruhigt sein. So dient das Ehrenwort zu nichts anderm, als zur Bequemlichkeit für euch beide. Wer lügen will, muß so lügen, daß ihm geglaubt wird. Glaubt der Angelogene ohne Ehrenwort nicht, so giebt man eben das Ehrenwort – eine bürgerliche Phrase – und der Zweck ist erreicht. Dem Konsul leuchtete das sehr ein, und ich bin nun gespannt, ob sie ihre neue Erkenntnis zuerst bei mir oder bei dem Aviatiker anwenden wird.
Gestern mittag war ich bei Ludwig Heller, mit dem Rößler ein Stück schreibt. Außer den Autoren und mir war Heinrich Mann und Robert Eyssler dort. Heller las uns die ersten 1½ Akte vor. Wenn das Stück so weiter schreitet, wie der Anfang verspricht, so wird das ein ganz vornehmes gutes solides Lustspiel werden, wie wir heute nicht mehr viele haben. Es behandelt die Familie Rothschild und spielt 1820. Die reiche Judenfamilie wird dem Milieu dekadenter Fürstenhäuser gegenübergestellt. Die freundliche Stimmung des ersten Aktes, der in der Judengasse bei der alten Gudela Rothschild spielt, ist ungeheuer wirksam und sympathisch. Das eigentliche Problem wird werden, wie die Tochter Salomo Rothschilds in den Konflikt zwischen der Liebe zu ihrem Onkel Jacques und der Spekulation ihres Vaters, sie soll einen regierenden Fürsten heiraten, gebracht wird. Ich riet, man solle die dem Bankrott nahen Fürsten herumkriegen lassen zu der Messalliance, sie aber am Widerstand der Familie Rothschildt und des Gefühls des Mädchens scheitern lassen. Ich bin sehr begierig auf den weiteren Gang des Stücks, das nach meiner Meinung ein großer Schlager werden wird, der den Erfolg auch ganz verdient. Heller ist ein fleißiger tüchtiger routinierter Theatermann, Rößler hat sehr gute Einfälle und große Begabung. Da wird gewiß etwas Gutes zustande kommen.
Abends hatte ich Gelegenheit, mit Kätchen zusammen eine andre Arbeit der beiden im Schauspielhause zu sehn „Im Klubsessel“, 76te Aufführung. Ein lustiger Schwank voll guter Pointen. Gespielt wurde recht gut. Besonders war Gustel Waldau wieder glänzend.
Nachmittags war Herr Oswald v. Krobshofer bei mir gewesen, der mir einen angenehmen Eindruck machte. Er erinnert im Äußeren und im Gehaben an Arthur Kahane. Ein großer Idealist offenbar, der sich sehr für meine Arbeit interessiert und versuchen will, meinem „Kain“ finanzielle Hilfe zu schaffen. Er hofft da auf einen Onkel. Meine Erfahrungen sind nicht derart, daß ich seine Hoffnung teilen könnte. Ob Herr Kahn etwas ausrichten wird? Ich glaube auch nicht mehr daran – und Steinebach – der hat es deutlich zu verstehn gegeben – denkt an Abschnappen. Scheiße!
München, Freitag, d. 15. September 1911.
Der Dreililien-Verlag bietet mir 350 Mk, zahlbar am 1. Januar, für die Essaysammlung „Scheinwerfer“. Ich werde mich einverstanden erklären und mir 100 Mk schon zum 1. Oktober schicken lassen. So komme ich über die Misere des Monatswechsels halbwegs hinüber, auch wenn Margrit die 160 Mk, die sie mir schuldet, nicht schickt. – Von Direktor Haaß, Cöln, bekam ich einen sehr lustigen Brief. Er hat die ersten beiden Akte der „Freivermählten“ gelesen und das Manuskript dann, wahrscheinlich während er bei der Post ein Telegramm aufgab, verbummelt. Er bietet mir jede Sühne an. Leider konnte ich die eine nicht fordern, an der mir allein liegt: er solle das Stück aufführen. Ich sandte ihm einfach ein neues Manuskript und beruhigte ihn, es sei nicht gefährlich, was ihm passiert ist. Ich halte die Geschichte für günstig. Der Mann ist jetzt etwas in meiner Schuld, und wird viel eher geneigt sein, sich zur Annahme des Stücks zu entschließen. Dann fände ich natürlich sofort einen Verlag und wäre aus allem Schlamassel.
Kätchen ist unmöglich. Gestern abend war Consul bei uns unten. Ich schämte mich vor ihr. Diese hausfrauliche Betulichkeit, das tantige Gedalbere mit jedem vorbeilaufenden Hund ist fürchterlich. Es war Wahnsinn, sie kommen zu lassen. Daß sie mich liebt, ist gewiß hübsch von ihr, aber, um sich mit mir derartige Nerventorturen leisten zu können, dazu ist sie doch verdammt nicht schön genug!
Uli ist wieder da. Gestern traf ich sie mit Kanders im Hofgarten.
Montag, d. 18. September 1911.
Zwei Tage habe ich das Tagebuch ruhen lassen. Die Veranlassung war Kätchen, die mir stündlich mehr auf die Nerven geht und mich nicht zum Arbeiten noch zur Ruhe kommen läßt: Heut nacht passierte es mir zum ersten Mal in meinem Leben, daß ich mich einer Frau gegenüber impotent zeigte. Ein Beweis für mich, daß Kätchen sogar den sexuellen Reiz für mich verloren hat, der sie mich bisher schätzen ließ. Insofern ist dieser nervenzerrüttende und kostspielige Besuch von Nutzen, als er mich mit diesem Verhältnis, das 3 Jahre gedauert hat, endgültig zum Abschluß bringt. – Finanziell bin ich völlig am Zusammenbruch. 170 Mark Schulden in diesem Monat – und die Rechnung am ersten wird weit über 200 betragen. Johannes darf nicht zu kurz kommen, und ich muß nun alle Hoffnung auf Margrit und den Dreililien-Verlag setzen. Kahn telefonierte mir heute, daß ich einen Bürgen beschaffen müßte, der das Geld garantieren muß, wenn ich etwas kriegen soll. Laß fahren dahin! – Auch auf die „Freivermählten“ setze ich keine große Hoffnungen mehr. Mindestens der „Neue Verein“ kommt kaum mehr in Frage. Kutscher schreibt mir, daß er das Stück für „Mist“ hält! – Kommen diese Zeilen mal ans Licht, so sollen sie also für die Gehirnweichheit dieses Literaturlehrers Zeugnis ablegen. Er meint, ich werde ihn nach dieser Kritik für einen Idioten ansehn. Ich lüge nicht mit der Behauptung, daß diese Einschätzung an der bisherigen nichts ändern wird. Ella Barth schreibt, sie schätze es so sehr an München, daß man hier die Worte Arschloch und Scheiße (sie beschränkt sich auf die Anfangsbuchstaben) grad heraus sagen darf. Im Hinblick auf den Dr. Kutscher fallen mir die kräftigen Redensarten allerdings recht häufig ein ... Heut will Rößler mit S. Fischer, der zurzeit in München ist, über mich sprechen. Ob das Erfolg haben wird? Dieser Monat ist so verpecht, daß ich wenig Hoffnungen habe.
Um rasch einiges zu notieren. Gestern war ich mit Consul und Zilger im Tierpark Hellabrunn, der noch ganz unvollkommen aber in der Anlage sehr hübsch ist. Zu meiner Überraschung sprach mich Dr. Georg Hirth an, und bedankte sich noch einmal für den „Kain“-Artikel zu seinem 70ten Geburtstag.
Charlotte schickt mir aus Lübeck das halbe Dutzend Taschentücher als nachträgliches Geburtstagsgeschenk und einen Napf- nebst etlichen Schwartauer Pfefferkuchen. Sehr nett. Ich habe mich recht gefreut.
Ich habe maßlos zu tun. Noch immer nichts am Kalender, nichts an Nr. 7 des „Kain“ getan. Ich bin entschlossen, diese Blätter wieder mal zugunsten der laufenden Arbeit zu vernachlässigen. Ich schwitze Angst, denk ich an die Aufgaben der nächsten Tage.
München, Mittwoch, d. 20. September 1911.
8 Uhr abends. Noch rasch eine Eintragung, ehe ich von der Arbeit angestrengt fortgehe. Kätchen ist heut früh abgereist. Ich möchte ein Dankgebet gen Himmel schmettern. Das waren entsetzliche Tage. Daß ich sie kommen ließ war die größte Eselei, die ich im ganzen Leben geleistet habe. Das war gestern wieder eine Qual: Das Reisegeld war nicht da, und das Engagement in Colmar hing davon ab. Langheinrich, mit dem sie vor Jahren ein Verhältnis gehabt hat, beantwortete meine Bitte um Geld nicht. Rößler behauptete keins zu haben. Zum Glück hatte der Dreililien-Verlag in Karlsruhe, dem ich gestern den Kontrakt für das „Scheinwerfer“-Buch unterzeichnet habe, mir 100 Mk Vorschuß in Form eines Wechsels geschickt. Daraufhin pumpte ich die Wirtin um 40 Mk an. Diskontiert jetzt die Filiale der Dresdner Bank, an die mich der Verlag verwiesen hat, den Wechsel nicht, so gerate ich in Teufels Küche. Daß ich auch die Rückreise noch zahlen mußte, ist bitter genug. Kätchens Aufenthalt hier kostet mich insgesamt weit über 100 Mark, die ich nicht habe, und das einzig Gute daran ist, daß ich mit dem Mädel nun endgiltig fertig bin. Einen Tripper habe ich ja diesmal nicht von ihr gekriegt, aber einen Degout, der grauenhafter ist. Heut nacht mußte ich mich noch einmal bei ihr betätigen. Es wurde mir sauer genug, – aber es war zuverlässig das letzte Mal. Das arme gute Tier gehört zu einem Fabriksprokuristen, aber nicht zu mir. Ein Glück in diesen Tagen waren die Konsulschen Küsse. Nun wird es drauf ankommen, sie zu größerer Intimität zu bewegen. Aber Rößler ist irrsinnig verliebt und sehr eifersüchtig. Ich habe ihm keinen Zweifel darüber gelassen, daß mich die Freundschaft zu ihm nicht hindern wird, mein Heil zu suchen, wo ich es finde. Konsul liebt mich, aber sie hat noch Gewissen.
München, Donnerstag, d. 21. September 1911.
Gestern war ich seit langem mal wieder mit Wedekind beisammen. Ich floh vom Stammtisch der Torggelstube, wo Weigert mit allerlei Mimen, darunter eine etwas auffallende Dame, saß, ins Nebenlokal, wo Steinrück und Wedekind saßen. Steinrück ging bald, und ich unterhielt mich mit Wedekind angelegentlich über öffentliche Angelegenheiten. Auf dem Wege zur Torggelstube hatte ich Heinrich Mann getroffen, mit dem ich dann erst noch umgekehrt war, und im Café Odeon über den Parteitag in Jena und die Indifferenz der geistigen Kreise Deutschlands gesprochen hatte. Diese Unterhaltung setzte ich mit Wedekind fort, der allerlei Verschrobenes äußerte. – Nachher erzählte er, er habe Hardekopf getroffen, der ihm erzählt habe, er sei mit mir in etwas gespannter Beziehung. Emmy sei dabei gewesen, die sich recht geschickt und stilvoll gebe. – Heut erzählte mir nun Bolz, den ich im Stefanie traf, daß Emmy neuerdings täglich mit Wedekind zusammenkomme und offenbar geschlechtliche Dinge mit ihm treibe. Sehr interessant. Sie verführt die ganze Geistigkeit Münchens. Przybyszewsky hat auch schon dran glauben müssen. – Daher soll sie in den letzten Tagen – ich sah sie wohl eine Woche nicht mehr – total exaltiert sein, und obendrein so krank, daß Bolz das Äußerste für sie fürchtet. Armes liebes Ding!
München, Sonnabend, d. 23. September 1911.
Mit dem Sommer scheint es endgiltig vorbei zu sein. Seit einigen Tagen regnet es in Güssen. So ist Hoffnung, daß ich werde arbeiten können, und daß auch die Oktoberwiese, die heut anfängt, mich nicht allzusehr in Anspruch nehmen wird. Übrigens geht das Gerücht in der Stadt, im indischen Zelt seien Cholerafälle vorgekommen und die ganze Wiese deshalb militärisch abgesperrt.
Ich sehe, daß die Tage, die ich hier unausgefüllt ließ, Anlaß zu groben Unterlassungen gaben. Vor allem muß ich die Aktion vermerken, die Lulu Strauß für mich unternimmt. Die Sache mit Kahn hat sich endgiltig zerschlagen, nachdem er erklärt hat, ohne Eintragung ins Grundbuch oder Stellung eines solventen Bürgen sei nichts zu machen. Als ob ich, wenn ich diese Bedingungen erfüllen könnte, einen Wucherer nötig hätte! Dann ginge ich zur Deutschen Bank und hätte Geld, soviel ich wünschte, zu 4%. – Nun hat Strauß in meinem Auftrag hinter meinem Rücken an Onkel Leopold geschrieben und versucht, die Mischboche zur Hergabe von 5–6000 Mk für den „Kain“ zu bewegen. Ob’s Erfolg hat? Gott geb’s. Denn ich leide wieder sehr am Dalles.
Gestern war ich bei Jaffé, um ihn zu veranlassen, bei dem am 29ten stattfindenden Aufreizungsprozeß gegen Moizes als Sachverständiger zu fungieren. Er, Brentano und ich dürften nun vorgeladen werden. – Aus unsrer Unterhaltung bemerke ich nur die Jafféschen psychologischen Betrachtungen, bei denen er selbst immer am besten wegkommt. Gewöhnlich kommt es auf ein Jammern über erotische Mißerfolge heraus. Auch gestern wieder fing er an, seine Psychologie an Frieda zu betätigen. Taktgefühl hat er anscheinend garnicht. Sonst müßte er jawohl merken, daß ich bei der Erörterung dieses Themas schauderhaft leide. Ich muß mich dann immer noch an der Seelen-Untersuchung Friedas beteiligen, um meine Liebesqualen einigermaßen zu verschleiern. Ob Friedel bald kommt? Sie schrieb in ihrem langen Brief, sie wolle den Herbst noch in Ascona abwarten. Aber auch dort dürfte jetzt bald die Regenperiode einsetzen. Dann geht das Leiden wieder an, nach dem ich mich mit allen Fibern sehne. Möchte sie nur Frick nicht mit herbringen!
Ich bin neuerdings sehr viel mit Consul zusammen. Ihre Küsse werden immer begehrlicher und manchmal fühle ich dabei leicht ihre Zunge in meinem Mund tasten. Vor Rößler genieren wir uns wenig, aber er wird sehr nervös, wenn er unsre Zärtlichkeiten sieht und verbietet ihr, wenn ich nicht dabei bin, mich zu küssen. Ich gehe jetzt mit Volldampf auf die Verführung los. Sie fürchtet aber, daß es durch einen Zufall herauskommen könnte, wodurch sie ihre Existenz verlieren würde, da Rößler sie ganz und gar aushält. Dumm von Rößler, das Mädel die Abhängigkeit so fühlen zu lassen. Da er demnächst wahrscheinlich nach Berlin muß, werden wir die Gelegenheit ja doch benutzen, ihn zu betrügen.
Eben telefonierte ich mit dem Moggerl. Sie spielt in acht Tagen zum ersten Male hier die Nora – ich sah sie schon in Leipzig in der Rolle. Es wird zugleich ihre Abschiedsvorstellung sein. Schade, daß sie fortgeht. Sehr sehr schade!
München, Sonntag, d. 24. September 1911.
Ich besitze noch eine Mark und ein paar Groschen. Woher in dieser Woche bis zum 1. Oktober weiteres Geld kommen soll, ist mir ganz unklar. Ich sehe peinliche Dinge bevorstehen. – Morgen oder übermorgen wird das Manuskript der siebenten Kain-Nummer fertig sein. Dann geht es mit Hochdruck an den Kalender. – Eine Karte, die heute ankam, machte mir große Freude. Aus Erwitzen schreiben mir einige Unbekannte einen Gruß, aus Peter Hilles Geburtsort, und fragen, ob ich nicht im "Kain" einmal Erinnerungen an Peter Hille bringen möchte. Vielleicht einmal bei gegebener Gelegenheit. Jetzt gehe ich zu Consul hinauf, um mir Küsse zu holen. Dann schreibe ich um Geld an Margrit. Onkel Leopold, die Deutsche Montagszeitung, die mir immer noch 100 M. schuldet und vielleicht sonst noch wohin. – Uli, die ich heute sprach, wird mich demnächst besuchen. Auch Hardy, mit dem ich gestern in der Torggelstube freundschaftlich beisammen war, will zu mir kommen. Frl. Käte Funk aus Bremen, die kleine Sängerin aus dem Café des Westens, die hier in „Orpheus in der Unterwelt“ die Diana singt, war auch da und schenkte mir ihr Bild. Charlotte schickte die Photographie ihres Jungen. Sehr niedlich.
München, Dienstag, d. 26. September 1911.
Es ist skandalös. Die Kain-Nummer ist noch nicht fertig, und am Kalender, der in 3 Wochen fertig vorliegen soll, habe ich überhaupt noch nichts getan. Dabei drängt der „Komet“ fortwährend um Arbeiten, die ich nicht auslassen kann, weil das die einzige Geldquelle ist, die mir im Laufe des Monats fließt. – Jetzt ist Strich wieder da, leider ohne Lotte, die noch bis in den Oktober hinein in Berlin bleibt. Strich schuldet mir 70 Mk. Da er aber die Absicht geäußert hat, Johannes 20 Mk zu schicken, und selbst wenig hat, nützt mir die Forderung im Moment garnichts. Hoffentlich läßt Margrit mich mit den 200 Fr. nicht aufsitzen. Der Montagszeitung (100 Mk) habe ich mit Klage gedroht. Dann ist noch der Wechsel vom Dreililien-Verlag in den Händen der Wirtin, – so wird wohl irgend etwas gehn, daß am 1. Oktober wieder etwas Geld in meinen Händen sein wird. Freilich: die unheimliche Pensionsrechnung, die bevorsteht, die Menge Spielschulden, die bezahlt sein wollen, Johannes und allerlei Sonstiges: mir graut doch ein wenig.
Gestern lud mich Rößler zur Theresienwiese ein und holte mich und Consul per Auto dazu ab. Ein kolossaler Betrieb. Wir waren u. a. in Hagenbecks indischer Ausstellung, die weit großartiger ist als die, die ich mit Lotte in Dresden sah. Die Vorführungen der Gaukler interessierten Consul natürlich sehr. Sie schien bei den Erinnerungen an ihre Kindereindrücke recht ergriffen zu werden. Nachher verstimmte es sie aber, daß wir stundenlang in einer überfüllten Gartenkneipe (bei Schottenhammel) sitzen blieben, wo wir Max Halbe und Frau getroffen hatten. Wir aßen dort ein ganz ausgezeichnetes frisch gebratenes Huhn und tranken Bier. Nachher beschwerte sich Consul heimlich bei mir, daß sie fortwährend mit alten grauhaarigen Leuten sitzen soll. Mich liebt sie, wie es scheint, wirklich. – Nachher gingen wir zu Benz – ohne Halbes –, wo Rößler Sekt bezahlte, dann noch in den Serenissimus. Später ich allein noch zu Kati Kobus, wo ich u. a. Michel und Oppenheimer traf.
Die Zeitungen bringen eine Nachricht, die mich lebhaft an meinen Pariser Aufenthalt erinnert. Im „Lapin agile“ ist der Sohn des père Frédéric erschossen worden. Da das Cabaret dort oben auf der butte in der Dalleszeit Johannes’ und mein ständiger Aufenthalt war, weckt mir das Ereignis allerlei merkwürdige Erlebnisse an den père Frédéric, an die weißen Ratten, an den „Ratton“, den kleinen Maler, an Richmond Chandois, den famosen Charakterkerl, und an die ganze seltsame Pariser Bohême, die dort oben verkehrte. An den Erschossenen erinnere ich mich nur dunkel, eigentlich nur das Aeußere des jungen Menschen ist mir im Gedächtnis. Freundschaftliche Beziehungen hatten wir nie zu ihm. Ja, Paris! Wenn ich reichlich Geld habe, gehe ich bestimmt wieder hin. Vorher bestimmt nicht.
München, Donnerstag, d. 28. September 1911.
Vorgestern abend war ich mit Strich in der Torggelstube. Sehr angeregte Gespräche mit Wedekind, der allerdings immer schrulliger wird. Seine ethymologischen Spekulationen sind fabelhaft. „Kitsch“ leitet er kühn von Kunst ab. Ich erklärte es mit der reinen Klanglichkeit des Wortes wie Klatsch, Ramsch ... Pipifax will er mit Pontifex in Zusammenhang bringen. Meine Erklärung „pipi facere“, der Pipimacher läßt er nicht gelten. Über Wert und Wesen der Frau kämpfte ich an Wedekinds Seite gegen Strich, der alle Emanzipation perhorresziert. Wir vertraten gemeinsam die Auffassung, daß die Frauen nur deshalb nirgends produktive Werte schaffen, weil sie durch die Verbildung der Kultur als Publikum ausgeschaltet sind. Alle Kunst, alle Wissenschaft, alle Technik, alle Arbeit ist Kultur für Männer. Die Emanzipation des Weibes wird das Bedürfnis nach einer Kultur wecken, die das Wesen der Frau mitberücksichtigt. Dadurch werden die Frauen selbst produktiv werden und alle Kultur wird um eine Hälfte bereichert werden, von der wir heute noch garnichts kennen. Eine Weltgeschichte, von einer Frau geschrieben – was für Perspektiven! ... Auf dem Heimwege setzte ich mit Strich das Gespräch fort und entsetzte ihn durch mein Geständnis, daß mir bisher keine Kunst so tiefe Eindrücke gegeben hat wie die Schauspielerei, die er überhaupt nicht als produktive Kunst anerkennen will. Wo eine Eysoldt lebt!
Gestern holte ich mir vom „Komet“ Geld: 35 Mk, von denen fast die Hälfte wieder weg ist, weil ich gleich von Uli um 5 Mk angepumpt wurde und ziemlich leichtsinnig ausgab: auch die Kegelbahn, die gestern wieder eröffnet wurde, kostete einiges. – Herr P. P. Liebe, Augsburg, schrieb mir einen eigentümlichen Brief, dem er eine Art Flugblatt beilegt, überschrieben: „Ein modernes Golgatha“. Er hat wegen seiner Schönherr-Publikationen von liberalen Schmöcken allerlei Angriffe aushalten müssen, die ihn auch wohl wirtschaftlich geschädigt haben. Darüber jammert er ziemlich würdelos. Außerdem beschwert er sich beweglich, daß mein Artikel „Schönherrs Plagiat“, den er „stahlhart“ nennt und mit andern schmockfeuchten Bezeichnungen ehrt, und der doch viel heftiger sei als alles was er geschrieben habe, überall ignoriert worden sei. Ich habe ihm höflich und ziemlich ausführlich geantwortet. Dem armen Teufel scheint es übel zu gehn.
Nach der Kegelbahn Kati Kobus. Mary Irber war da. Ich fand sie in der Küche im Gespräch mit Gstaller. Sie winkte mich herbei und ich durfte zuhören, wie sie sehr umständlich und mit großer Liebe die gepfeffertsten Anekdoten erzählte. Sie ist aber ein reizender Kerl. Demnächst soll ich sie zum Kaffee besuchen. Ob wir dann endlich einmal zu dem Ziel kommen werden, das wir schon zehnmal verabredet hatten und das immer wieder durch Zufälle vereitelt wurde? Grete, ihre Zofe, hat, wie sie mir erzählte, die langgehütete Jungfernschaft, die sie nicht unter 1000 Mark hergeben wollte, inzwischen aufgegeben. „Hast du eine Ahnung!“ erzählte sie mir. „Ich ficke manchmal acht bis zehn Nummern in einer Nacht.“ Eine sehr originelle Figur. Ich möchte der Kerl nicht sein, der es ihr besorgen muß. – Nachher begleitete ich Emmy. Sie erzählte mir, wie sie mit Wedekind poussiert habe. Zu sexuellen Intimitäten ist es demnach doch bisher zwischen ihnen nicht gekommen. Emmy ist aber ganz wild drauf und verlangt von mir, ich solle sie in die Torggelstube mitnehmen, und sie insgeheim mit Wedekind zusammenführen. Reizen könnte mich die Aufgabe schon. Und daß Wedekind sich sträuben wird, glaube ich im Leben nicht. Er wird dann bewähren müssen, wie er seine Theorien praktisch anwendet. Er behauptet gerne, wenn jemand seine Frau betrüge, könne er nicht länger mit ihr zusammen sein. Denn er müsse sich sagen: läßt sich die Frau von mir betrügen, so läßt sie sich auch von jedem Marktweib betrügen. Daher ist die Ehe für den Betrügenden ein schlechtes Geschäft. Ob Tilly ebenso dächte, wenn der Fall akut wird? – Sie wird gescheit sein, und einfach auch ihn hintergehn ... Emmy war reizend. Wir setzten uns in die Leopoldstrasse auf eine Bank und küßten uns gierig. Leider mußte sie zu Hardy hinauf, der sie angstvoll betreut.
Heut früh kam ich zu Rößler herauf. Ich glaube, er ist mir jetzt sehr böse, daß ich schon wieder in seiner Gegenwart Consul küßte. Er zeigte seinen Ärger ganz unverhohlen, und als Consul ihn fragte: „Meinst du, du hättest das Privileg darauf?“ meinte er ganz naiv: „Allerdings!“ Ich ging dann und fürchte, er hat ihr noch Krach gemacht. Solche Torheit! Sie küßt mich gern und wird es gewiß nicht lassen, auch wenn er es ihr verbietet. Betrügt sie ihn aber erst mit Küssen – er zwingt sie ja, das nur noch betrügerisch zu tun –, so kann es leicht kommen, daß sie bald den Betrug auch noch auf Weiteres ausdehnen wird. Freundschaftliche Rücksichten kenne ich da nicht. Das weiß Rößler. Ich habe es ihm in der denkbar größten Offenheit gesagt.
Zu morgen früh ½ 9 Uhr habe ich Vorladung vors Schwurgericht in Sachen Moizes. Meßthaler meinte auf der Kegelbahn, als ich davon erzählte: „Hoffentlich sind Sie gut bei Schwur!“
München, Freitag, d. 29. September 1911.
Mit der Schwörerei ist es Essig geworden. Pünktlich um ½ 9 Uhr war ich zur Stelle. Brentano kam nicht, weil das Gericht die offizielle Ladung sämtlicher Sachverständiger abgelehnt hatte und Strauß nur von sich aus geladen hatte. Brentano hatte also offenbar keine Neigung gehabt. Jaffé ist gestern nach Italien abgereist. Ich stand allein auf weiter Flur, außer den 5 oder 6 Zeugen, die die Angeklagten wohl belasten sollen. Man rief uns alle in den Saal, wo im Dämmerlicht das Dutzend ausgeloster Geschworenen saß. Man sah schwachbeleuchtete wichtig-ehrpusselige Bürger-Physiognomien. Vor uns drei Richter, deren Wortführer aristokratisch-jovial aussah. Links die beiden Angeklagten, Mojzes, ein dunkelhaariger Jude mit sehr intelligenten und energischen Zügen, der andre, ein gewisser Kowatschitsch, ein blöder Bauernlackl von total stupidem Ausdruck. Feierliche Verwarnung vor dem Meineid. Die Namen der Zeugen wurden aufgerufen, darauf erhebt sich Strauß, der mit einem Traunsteiner Anwalt, Pfahler, zusammen die Verteidigung führt: Er habe die Professoren Brentano und Jaffé, die nicht gekommen sind, und den anwesenden Schriftsteller Erich Mühsam laden lassen, den er als Sachverständigen zuzulassen bitte. Wir wurden wieder hinausgeschickt. Inzwischen höre ich noch den Staatsanwalt, denselben Hierer, der meinen Geheimbundprozeß so glorreich vertreten hatte, mit dem Protest beginnen. Nach einer Weile werde ich wieder gerufen. Der Vorsitzende berichtet, daß der Staatsanwalt Einwände gegen meine Zulassung als Sachverständiger erhoben habe, ich gehöre zur „anarchistischen Partei“, sei selbst in einem Geheimbundprozeß beteiligt gewesen u.s.w. Das Gericht wolle mich selbst hören. Ich antwortete etwa so: „Ich stehe allerdings seit mehr als 10 Jahren in der anarchistischen Bewegung. Ich habe mich in dieser Zeit erheblich an der Agitation beteiligt, habe selbst theoretische Schriften verfaßt und auch viel agitatorische Kleinarbeit geleistet. Ich kenne die verschiedenen Richtungen des Anarchismus aufs Intimste und glaube daher legitimiert zu sein, objektiv über Dinge, die den Anarchismus angehn, zu urteilen.“ Ich werde wieder hinausgeschickt. Die Pause dauert beinahe eine ganze Stunde, bis der Gerichtsdiener mir den Bescheid bringt, ich sei abgelehnt und könne „abtreten“. Meine Bemühung, eine Karte für den Zuhörerraum zu kriegen, scheiterte daran, daß die Ausgabe schon geschlossen war. Übrigens wurde dann auch die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Ich aß in der Torggelstube Mittag, wo ich Strauß sprach. Er erzählte, der Staatsanwalt habe seinen Antrag, ich sei als Sachverständiger nicht zuzulassen u. a. damit begründet, daß ich in die Münchner Bombenaffaire verwickelt gewesen sei. Ich sei zwar damals freigesprochen worden, aber nur wegen Mangel an Beweisen. Ich will jetzt die Zeitungsberichte abwarten. Steht derartiges drin, so kann sich Herr Hierer auf Unannehmlichkeiten gefaßt machen. Ich beabsichtige nicht, die unverschämte Verleumdung des Herrn, dem jedes Mittel recht zu sein scheint, um arme Menschen ins Gefängnis zu bringen, protestlos hingehn zu lassen. Wozu habe ich den „Kain“? – Das Gericht, berichtete Strauß, habe meine Zulassung mit der Begründung abgelehnt, es sei Befangenheit bei mir zu besorgen. Sehr schade. Ich glaube, ich hätte den Angeklagten nützen können. Jedenfalls habe ich Strauß das, was ich vorzubringen gehabt hätte, im Orlando aufgeschrieben, damit er es in seinem Plädoyer benutzen kann. Er hofft, daß beide Angeklagte freigesprochen werden. Bei Geschworenen habe ich immer Angst. Gestern hat die Bande erst einen Brasilianer wegen Banknotenfälschung zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Grauenhaft! Als ob es einen einzigen Menschen gäbe, – es sei denn ein kompletter Kretin –, der sich über ein solches Delikt, bei dem am Ende doch nur der Staat geschädigt wird, aufrichtig ärgern könnte! Falschmünzerei und Kirchenraub sind Verbrechen, die gradezu von idealistischer Gesinnung zeugen. – Nachmittags fuhr ich mit Strauß zum Schwurgericht zurück. Auf einer Einlaßkarte hatte ich dem Vorsitzenden geschrieben, er möge mich offiziell zum Zuhören zur Verhandlung zulassen. Er ließ mir aber sagen, er bedaure. Er könne mir die Erlaubnis nicht geben. Hierauf begab ich mich auf den Lokus des Justizpalastes und schiß auf Deutschlands Rechtspflege.
München, Sonnabend, d. 30. September 1911.
Italien hat der Türkei den Krieg erklärt. Seit 3 oder 4 Tagen erst hörte man von der Tripolis-Affaire, die freilich schon seit einer Reihe von Jahren in der Luft hängt. Nun ist die ungeheure Tatsache akut. Schon liest man von zerstörten Schiffen, natürlich auch vom Jubel der italienischen Bevölkerung. Man muß es der italienischen Regierung zugestehen: sie hat unglaublich schnell gearbeitet. Die Vorbereitungen waren ganz im Stillen getroffen. So hat auch der Generalstreik, der von der revolutionären Arbeiterschaft inszeniert werden sollte, versagt. Er konnte nicht präpariert werden. Zehntausend und Aber-Zehntausende junge zeugungsfähige Menschen werden gemordet werden um kapitalistischer Spekulation willen und die Kulturwerte beider Länder werden unwiederbringlichen Schaden leiden. – Aber die Begeisterung für den Krieg, der bei aller Schauerlichkeit so sehr nach Kinderspiel aussieht, wird neu gefacht werden und das groteske Schauspiel, daß sich ganze Völkerteile zu Automaten dressieren lassen, und auf Kommando marschieren und schießen und sich totschießen lassen, wird sich immer wieder erneuern. – Dem jetzigen Krieg, ganz real betrachtet, möchte ich doch einen für die Türken günstigen Ausgang wünschen. Nur eine besiegte europäische Großmacht wäre imstande, den imperialistischen Unfug aufzuhalten. Trotz der numerischen und armatorischen Überlegenheit Italiens ist der Sieg der Türken leicht möglich, dann nämlich, wenn genügend revolutionäre Kräfte im italienischen Heer wirksam sind und ganze Truppenteile durch Desertion, Offiziersmorde und Sabotage gegen den Irrsinn ihrer Gängler vorgehn, wenn in den Großstädten Italiens energisch mit wirtschaftlichen Kämpfen gestört wird und wenn die Türken aus dem Kriege eine moslemitische Angelegenheit machen. Die Eingeborenen in Tripolis werden ohnehin auf Seiten der Türken kämpfen, sodaß die Italiener, wenigstens im Landkriege sehr großen Schwierigkeiten gegenüberstehn werden. 1877 siegte die Türkei über das große Rußland. Vielleicht gelingt’s ihr 1911, Italien zu schlagen. Den Preis ihres Sieges werden ihr die Mächte wie damals ja doch rauben, aber das geht unsereinen am Ende wenig an. Wenn nur der Horror vor dem Kriege ganz Europa ins Gebein fährt. Dann braucht uns auch die widerliche Marokko-Politisiererei nicht mehr als ewige Gefahr auf den Nerven zu liegen.
Aus meinem Privat-Erlebnissen: Ich sprach im Café Herrn Robert Heymann, der wieder künstlerischer Leiter des „Kleinen Theaters“ ist. Der Direktor ist ein gewisser Poppert, den ich durch ihn kennen lernte. Die Herren wollen mich engagieren. Wir einigten uns auf ein Gastspiel von 8 Tagen mit 25 Mk Abendgage. Ich muß es schon machen, weil ich dringlichst einen neuen Anzug brauche. Morgen ist der Erste. Mir graut vor der Rechnung.
München, Montag, d. 2. Oktober 1911.
Wieder zwei Theaterabende. Sonnabend verabschiedete sich die Terwin als Nora vom Residenztheater. Obgleich gleichzeitig die Ruederer-Premiere im Schauspielhaus war, war das Theater überfüllt. Die Aufführung war nicht ganz so gut wie damals in Leipzig. Das Moggerl hatte prachtvolle Momente, brachte aber manches doch nicht so wirkungsvoll heraus wie dort. Basil gleichfalls nicht, obwohl auch er famos war. Den Rank gab B. v. Jacobi in ganz ähnlicher Auffassung wie Monnard. Jacobi war noch besser in der Rolle, besonders hatte er eine brillante Maske.
Dagegen waren die Nebenrollen diesmal schauderhaft besetzt: die Christine des Frl. Schwarz war kläglich; wie prachtvoll dagegen damals die der Sussin. Den Günther gab der unmögliche Herr Leßmann, ausdruckslos, gradezu lachhaft und ganz jammerwürdig. Auch die Ausstattung war in Leipzig viel besser gewesen. – Aber auf all das kam es garnicht sehr an. Man wollte ja nur die Terwin noch einmal sehn – und sie war sehenswert. Die Ovationen, die man ihr zum Schluß darbrachte, waren beispiellos. Sie mußte wohl an 50 Mal auf die Bühne, die unter Blumen fast zusammenbrach. Nachher noch, als der eiserne Vorhang herunter war, klatschte, trampelte, schrie man sie unzählige Male hervor, und man sah, wie sie mit Tränen kämpfte. Ich bin nicht der Sentimentalste, aber ich mußte kämpfen, um nicht zu schluchzen. Gestern abend ist das Moggerl nun abgereist. Wir sagten uns vorgestern nur noch telefonisch adjö. Im November will ich sie in Berlin besuchen. Für das Münchner Komödienspiel ist der Fortgang der Terwin ein schwerer, sehr schwerer Verlust. Mir persönlich reißt er eine Lücke auf, die ich oft schmerzlich empfinden werde. Ich habe die Künstlerin und die Frau sehr gern. Mag sie Glück haben, mag ihr unbändiger Ehrgeiz nicht enttäuscht werden, mag sie in Hände kommen, die das künstlerische Temperament in ihr erkennen und richtig anfassen. Adjö, liebes Moggerl!
Gestern mußte ich nun Ruederers „Schmied von Kochel“ über mich ergehen lassen. Eine wirre Verstiegenheit. Ruederer wollte sehr hoch hinaus und kannte seine Grenzen nicht: der typische Fall von Dilettantismus. Der Fall, um den es geht, ist an sich nicht uninteressant und hätte wohl dramatische Möglichkeiten gehabt. Die fixe Idee des Volkes, das in Balthasar, dem Schmied von Kochel symbolisiert wird, glaubt an die Rückkehr des verjagten Landgrafen, des „silbernen Ritters“ und als der Schmied nach langer Pause zum ersten Mal wieder auf den Ambos schlägt, ist das das Zeichen zum Aufstand gegen die österreichische Herrschaft. Der Sohn des Schmiedes, Mathias, der halbtot in die Heimat zurückkehrt, geschunden und voll Haß – Symbol für das bayerische Heer – wird von der Mutter (Bayern) aufgenommen, er verrät den Vater, der ihn einst aus dem Hause fortließ, da der Landgraf ihn begehrte. Der Aufstand wird unterdrückt. München, Bayern, der Schmied und sein Sohn kommen um. Viel Gerede. Viel Getue. Keine Klarheit. Kein Drama. Allerlei komische Gestalten sind zu sehn. Eine Kamilla, ehemalige Maitresse des Landgrafen, steigt herum. Eine bayerische alte Jungfer von Orleans. Hochkomisch. Schlimmer Irrtum des Herrn Josef Ruederer. – Die Aufführung sehr mäßig. Colla Jessen als Schmied tat was er konnte, das ist nicht viel. Randolf (Mathias) wie immer ein lärmender Provinzkomödiant. Hans Raabe schrie und machte Mätzchen. Der greise Künstler wie immer ein Schmierenschauspieler wirkte kläglich. Keiner war wirklich gut. Von den Frauen ist noch das beste zu sagen. Die Prasch Grevenberg als Frau des Schmieds war recht gut; daß sie unnatürlich wirkte, lag nicht an ihr sondern an der Rolle. Die Gerhäuser tat mir leid. Diese Kamilla ist so unmöglich, daß die beste Künstlerin nichts Gescheites draus hätte machen können. Lina Woiwode sah als Frau des Stadtrats und Gastwirts Jäger (Raabe) entzückend aus. Mit ihrer Rolle war so wenig anzufangen wie mit der andern. Schon bei der Premiere soll es einen ausgesprochenen Durchfall gegeben haben. Gestern war nun das Oktoberwiesen-Sonntags-Publikum da. Das Haus war ausverkauft. Zum Schluß hörte man kräftige Zischlaute. Es rührte sich keine Hand. Verdientermaßen. – – Nachher Torggelstube. Frau Ettlinger nahm mich bei Seite, um mir zu erzählen, ihr Gatte Karlchen habe bei der „Jugend“ protestiert, daß man nichts von mir bringe. Das persönliche Verhalten eines Menschen berühre nicht sein Künstlertum. Heute sei nun Konferenz und wahrscheinlich werde ich in diesen Tagen von der „Jugend“ die offizielle Aufforderung bekommen, wieder mitzuarbeiten. Das wäre sehr erfreulich. Ich freue mich über Ettlinger.
München, d. 3. Oktober 1911.
Das Geld macht mir große Sorgen. Das Kätchen-Abenteuer ist schauderhaft fühlbar. Die Rechnung hier beträgt fast 190 Mark, wobei die bar gepumpten 40 Mk noch garnicht gerechnet sind. Das andre konnte ich durch Komet-Honorare und Spielgewinne begleichen. Aber der Rest beträgt blos noch 5 Mk und den Wechsel des Dreililien-Verlags, den die Dresdner Bank nicht vor dem 28ten Dezember diskontieren will. Nun schreibt mir heute Johannes, daß Margrit mir am 7ten die schuldigen 200 Franken schicken will. Erhalte ich evtl. morgen noch vom „Komet“ eine halbwegs mögliche Summe, so mags ja wieder mal gehn. – Aber die freundlichen Besucher, die ich jeden Tag erhalte, setzen mir wieder scheußlich zu. Bald giebt man sich als Journalisten aus, bald als Maler. Immer hat man Familie und will bestimmt in 2–3 Tagen alles zurückgeben. Gestern hab ich es zum ersten Mal über mich gebracht, einen abzuweisen. Der Kerl war mir zu widerlich. Außerdem habe ich ihn im Verdacht, daß er mehr Geld hatte als ich. Aber, wenn ich zusammenzähle, ich glaube nicht, daß 50 Mk monatlich reichen, die man mir mit der Begründung aus der Tasche zieht, ich sei ja ein freiheitlicher Mensch und die reichen Leute helfen nicht. Die Leute abweisen nützt auch nichts. Sie kommen mit tötlicher Sicherheit wieder. Ich möchte nur wissen, wo sie sich verständigen. Kain-Leser oder Anarchisten sind es nie, die kommen, immer ein eleganteres Vagabundentum, in abgeschabter Bourgeois-Kleidung, arme Industrieritter, die sich wie Hochstapler vorkommen, wenn sie sich für einen Schriftsteller ausgeben.
Steinebach erzählte mir gestern Interessantes aus seinem Leben. Er war bei der Heilsarmee, war auch Grubenarbeiter und hat viel gehungert. Ein ganz feiner Mensch. Jetzt hat er sich einen Parlographen angeschafft, auf den er mächtig stolz ist. Er führte mir den in der Tat sehr praktischen Apparat vor. Eine richtige phonographische Diktiermaschine. Ich sprach auch mal hinein, und hörte dann meine Stimme, die mir ganz fremd und sonderbar vorkam. – Steinebach hat auf meine Veranlassung an Onkel Leopold geschrieben und ihn gebeten, 3000 Mark für den „Kain“ herzugeben, für deren Verzinsung er garantiere. Ich will nun selbst auch noch anbohren. Ob es helfen wird, ist mir allerdings mehr als fraglich. An Strauß hat Onkel negativ geantwortet. Ich will jedenfalls die endgiltige Ablehnung der Familie abwarten, ehe ich Schritte unternehme, die den Bruch mit ihr herbeiführen müßten. Scheuen werde ich aber diese Schritte nicht mehr, wenn ich sehe, daß die Angst um ihre lumpigen paar Kröten größer ist als das Bestreben, mir aus dem Schlamassel zu helfen. Mit der bloßen Warterei auf den Tod des Vaters komme ich nicht weiter. Jetzt soll mir alles gleich sein: Meinen Weg will ich gehn – ohne Aufschub!
München, Donnerstag, d. 5. Oktober 1911.
Ich bin entschlossen, von jetzt ab täglich für den Kalender zu arbeiten. Sonst kommt der nie von der Stelle. Bis jetzt habe ich erst zwei Manuskripte beim Drucker abgeliefert und von dem, was neu zu schreiben ist, noch nichts getan. – Zunächst sorge ich mich jetzt darum, daß der Fortbestand des „Kain“ arg gefährdet ist. Steinebach hat keine große Lust mehr, Geld hineinzuschustern. Nun hat sowohl Strauß wie er an Onkel Leopold geschrieben und eben geht auch von mir ein Brief an ihn fort, der ein Meisterwerk ist und hoffentlich 3–4000 Mark lockern wird. Die werde ich natürlich nicht kriegen, sondern wirklich für das Blatt arbeiten lassen. Heute abend kommt nun wieder eine neue Nummer heraus, die wegen des vorzeitigen Nachrufs auf Bebel Aufsehn machen dürfte. Ich werde Bebel das Heft schicken.
Vorgestern war ich zu Fränze Fischer, der kleinen Sängerin von Kati Kobus, die mich beinah im Ammersee ersäuft hätte, zum Thee und Abendbrot eingeladen. Emmy, Anny Trautner, Lebrun, Morax und noch ein junger Herr, der Doktor heißt und wahrscheinlich Fränzes Schatz ist, waren da. Es war recht unterhaltsam. Lebrun sang wunderschön. – Emmy hat, wie Bolz mir erzählte, großes Pech gehabt. Sie ist einem Lockspitzel ins Garn gegangen und hat nun eine Kontrollkarte bekommen. Das arme Mädel. Ich werde sehn, sie nach Zürich mitnehmen zu können. Vielleicht engagiert Bulmans sie für den „Grauen Esel“.
Wie mir mitgeteilt wurde, tritt zur Zeit bei Benz Sofie Stöckl auf – mein altes liebes Julchen, eigentlich mein erstes Verhältnis, damals in Wien. Ich schrieb ihr, sie möchte mich mittags antelefonieren. Das hat sie bisher nicht getan. So werde ich wohl heut oder morgen abend zu Benz gehn. Ich wäre glücklich, wenn zwischen uns zweien wieder etwas werden könnte. Seit Kätchen habe ich keine Frau mehr im Bett gehabt. Und die täglichen Consul-Küsse genügen auch nicht immer. – Übrigens war vor einigen Tagen eine Schwester des Consuls bei ihr, die ich leider nur einige Minuten sah, in die ich mich aber Knall und Fall verliebte. Noch viel schöner als Consul. Ganz große tiefe dunkle Augen, ein blendend schöner Mund, etwas welliges Haar, sehr bleiches und vergeistigtes Gesicht. Wunder-wunderschön, dabei herzlich und offen im Wesen. Sie ist nach Leipzig gefahren, wo sie bei einer Theosophen-Familie sein wird. Ein wenig theosophisch sah sie schon aus. Aber solche Nüchternheiten müssen diesem herrlichen tiefen Geschöpf doch auszureden sein.
München, Freitag, d. 6. Oktober 1911.
Verrücktes Leben. Eben geht Sofie Stöckl mit ihrer Freundin fort, die bei mir Mittag aßen. Ich mußte mal wieder Beichtvater einer unglücklichen Ehe spielen. Die Freundin – Bob genannt, eine typische etwas maskuline Lesbierin – ist wahnsinnig eifersüchtig, und als ich nun meine „Freivermählten“-Theorien auseinandersetzte, wurde natürlich alles Prinzipielle aufs Persönliche bezogen: große tragische Auseinandersetzungen. Tränen (bei Bob, Julchen blieb sehr ruhig). Ich mußte das Mannweib küssen, kurzum, es war sehr rührend. Das hübscheste ist: bei all den Schwüren der beiden, daß sie ehrlich voreinander seien, mußte ich der Stöckl noch lügen helfen. Ich war nämlich gestern abend bei Benz, wo ich Julchen flüchtig sprach und ging dann in den Simpl. Nachher kam sie mit einem Grafen dort an, und ich lud sie ein. Ich mußte ihr versprechen, der Freundin zu erzählen, sie sei mit mir dagewesen und das nun während der ganzen Diskussion, ob Menschen, die sich lieben, einander belügen dürfen, aufrecht halten. Sofie ist noch immer recht hübsch. Sie säuft nicht mehr soviel, ist etwas stärker geworden, und trägt die Haare jetzt rot. (Als ich sie kennen lernte, war sie brünett, als ich sie vor 3 Jahren in Nürnberg wiedersah, hellblond). Sie hat mir versprochen, mir eine Nacht zu widmen. Heut abend muß ich mit beiden zusammen ausgehn, wahrscheinlich wieder in den Simpl. Gestern war es sehr nett dort. Mary Irber war da, die mir Vorwürfe machte, weil ich sie noch nicht antelefoniert habe. Nachher kamen Leute von der Theatertruppe der Suzanne Dèsprès, die im Schauspielhause gastiert. Zwei der Herren trugen Verse vor, einer ein ernstes Gedicht von Richepin – sehr temperamentvoll, mit großen Gesten und fabelhafter Modulationsfähigkeit der Stimme, – der andre ein lustiges Gedicht von Lorraine, ebenfalls sehr hübsch und wirksam vorgetragen.
Heut abend schon muß ich im „Kleinen Theater“ auftreten, da Madame Hanako, die zurzeit dort spielt, plötzlich erkrankt ist. Seit mehr als einem Jahre (Frankfurt) habe ich auf keiner Cabaret-Bühne mehr gestanden, und ich bin recht neugierig, wie ich wirken werde. Gestern abend noch holte ich mir 50 Mk Vorschuß und kaufte mir heute vormittag für 34 Mk einen neuen Anzug bei Isidor Bach. Jetzt gehe ich an die Versendung des „Kain“ Nr 7, der heut erschienen ist.
München, Sonnabend, d. 7. Oktober 1911.
Vor einigen Tagen – dies ist nachzutragen – war Diro Meier bei mir, der jetzt Redakteur am „Komet“ ist. Ein hübscher netter großer blonder Junge von 21 Jahren. Der unglückliche Mensch hat die Phantasie, er könne die Erbschaft von seinen verstorbenen Eltern, 30000 Mark, die er jetzt zur Mündigkeit ausgezahlt kriege, nicht besser anlegen, als indem er sie ungeteilt in den „Kometen“ hineinsteckt. Ich riet ihm davon ab, alle rieten ihm ab, sein Onkel und Vormund wollte ihn entmündigen lassen, aber er tut, was er will. Nun setzte er mir die ganze Finanzlage des Blattes auseinander. Es hat bis jetzt 65000 Mark geschluckt. Nun kommen diese 30000 hinzu, falls weitere 50000 Mark auch noch hinzukommen. Da rechnet man mit Bolz, der demnächst das sehr nette Frl. Tarrasch heiraten will, und der grad diese Summe als Mitgift kriegt. Der ist an dem Blatt, das alle seine Zeichnungen bringt, stark interessiert – und mit 80000 Mark – da hat Herr Meier gewiß recht – läßt sich sehr viel und vielleicht sogar aus einem schlechten Blatt ein gutes machen. Hierzu möchte das Blatt nun mich gewinnen und Meier hat mich unverbindlich angefragt, ob ich bereit sei, mich mit einem Fixum engagieren zu lassen. Ich habe mir alles vorbehalten, denke aber, ich werde trotz der Bedingung, ich dürfte dann für kein andres Witzblatt mitarbeiten, darauf eingehn, falls a) Herr Velisch aus aller redaktioneller Tätigkeit entfernt, b) mir ein Monatsgehalt von 200 Mk garantiert wird. Die „Jugend“ hat sich noch nicht gemeldet, und aus dem „Simplizissimus“ werden, selbst wenn die Verbrüderung durch Thoma wieder hergestellt werden sollte, die Einnahmen nicht groß sein. Andrerseits wäre dadurch vielleicht der „Kain“ zu sichern, wenn ich nämlich stets gleich die Hälfte an Steinebach abführte. Daraufhin wird er gewiß das übrige Risiko auch weiterhin noch auf sich nehmen. Die 3000 Mark, die hineingegeben werden sollten, scheinen in der Tat nicht aufzutreiben zu sein. Lulu Strauß gab mir gestern den Brief von Onkel Leopold an ihn, und der sieht hoffnungslos aus. Er hält die Rentabilität des Blattes für ausgeschlossen und beruft sich auf seine Sachkenntnis, da er Mitbesitzer einer Zeitung sei. Das Ding heißt glaube ich: Waidmannsluster Anzeiger und besorgt die Geschäfte der in Waidmannlust, Hermsdorf, Lübars und benachbarten Dörfern wohnhaften Grundstückspekulanten. Aber weil dieses Blatt schlecht rentiert, ist der „Kain“ ein hoffnungsloses Unternehmen! – Das grauenvolle bei solchen Lächerlichkeiten ist, daß sie mich mit meinem ganzen Sein und Wollen hemmen. – Natürlich folgen in dem Briefe dann noch die üblichen Drohungen. Wenn ich größere Schulden mache, würde mich mein Vater auf Pflichtteil mit Zinsgenuß setzen und der Zuschuß der Geschwister – die monatlichen 150 Mark – würden aufhören. Also die Familie versagt mal wieder, da es ja um Dinge geht, die mein Lebensinteresse engstens berühren. Das Geld, das wissen sie, ist ihnen späterhin absolut sicher. Die Zinsen garantiert ihnen Steinebach: ganz gleich. Man will recht haben, man will mir mit Gewalt beweisen, daß Schriftstellerei ein brotloses Beginnen ist, man will mich am arbeiten hindern, um mir Faulheit vorwerfen zu können. Die Erbitterung, die sie in mir immer neu schüren, hat in ihren Zahlentabellen keinen Platz. Darüber geht man hinweg. Das legt sich wieder. Wartet! Und wenn ich mich anders nicht rächen kann, als durch die Hinterlassung dieser Aufzeichnungen – eure Kinder und Kindeskinder werden sich für euch schämen müssen!
Abends trat ich nun also auf. Ich „arbeitete“ nur 10 Minuten und hatte einen Kanonen-Erfolg. Das freut mich, da ich im Sommer des vorigen Jahres in Frankfurt a/M. glatt abstank. Es ist mir eine Bestätigung, daß ich immer mal wieder auf die Cabaret-Tätigkeit zurückgreifen kann, wenn die Geldnot sehr groß ist. Nach Wien würde ich bei annehmbarer Gage ohne weiteres wieder gehn. Sehr amüsant waren die Plakate abgefaßt. Auf denen stand: „Wegen Unpäßlichkeit der Mme. Hanako einmaliges Auftreten von Erich Mühsam.“ Es klang, als ob ich für die japanische Künstlerin ihre Rolle spielen sollte. Das Theater war nur sehr mäßig besucht. Aus dem Applaus hörte ich deutlich das kindlich jubelnde Händeklatschen und das helle Gelächter Emmys heraus. Ob ich heute wieder auftreten muß, steht noch dahin. Heut nachmittag spielt die Hanako vor geladenem Publikum. Ich werde mit Uli hingehn. Dann werd ich erfahren, ob sie imstand sein wird, abends noch einmal zu mimen, oder ob ich sie wieder vertreten muß. Geschäftlich wäre das letztere schon besser. Aber große Lust habe ich nicht.
Nachher ging ich laut Verabredung zu Benz um Sofies Freundin „Bob“ in den Simpl. abzuholen. Julchen wollte nachkommen, sobald sie ihre Arbeit hinter sich hätte. Im Simpl. saß der Herr, mit dem ich Julchen schon vorgestern getroffen hatte, ein Graf Schwerin, der sich v. Ziegler nennt. Als Julchen kam, stellte sie ihn Bob vor, die den Namen schon eifersüchtiger Weise gehört hatte. Sie fuhr herum: „Ach, Sie sind der Herr von Ziegler!“ – Schwapp, drehte sie ihm den Rücken und flüsterte mir zu: „Mir das anzutun!“ – Ihre Gereiztheit wurde immer größer, und sie fing an, sich gradezu lümmelhaft zu benehmen. Endlich ging sie mit allen Gebärden einer großen Eheszene. Es wurde dann noch recht lustig im Simpl. Ich trank viel und küßte alle herumsitzenden Mädchen und Frauen. Auch Frau Michel, ehemals Anita Prévôt, versprach mir einen Kuß, wenn ich noch etwas vortrüge. Ich tat es und durfte mir von ihren sehr hübschen und sinnlichen Lippen die Belohnung holen. – Inzwischen wurde bei der Stöckl die Besorgnis wach, die Freundin könne die häusliche Szene, die bevorstand, mit dem Revolver begleiten, da sie einen schönen Browning besitze. Es wurde deshalb beschlossen, wir fahren mit einem Auto zu dreien vor die Wohnung, ich gehe hinein, und der Graf wacht draußen. So geschah es. Es gab einen Heidenkrach. Sofie verhielt sich brillant dabei. Die Revolver-Besorgnis war übrigens unbegründet. Ich mußte sehr diplomatisch sein, um einerseits die Tragödie nicht tragisch werden zu lassen, andrerseits die von Bob angekündigte, von Julchen sehnlich herbeigewünschte heute zu vollziehende Ehescheidung nicht zu stören. Es wurde beschlossen, Bob solle heute früh abreisen. Ob sie nun fort ist, weiß ich nicht. Bei solchen Weibsleuten sind immer Überraschungen möglich. Ich bekam sowohl von Julchen, die sich während der Familienszene entkleidet hatte, zärtliche Küsse, dann auch von Bob, als sie mich hinausbegleitete. Übrigens hatte ich ihr vorher, ehe Julchen dabei war, im Simpl. unter die Röcke gefasst und sie sogar überredet einem Piacere zu dreien zuzustimmen. Daraus wird nun wohl nichts werden. Jedenfalls hat mir Julchen, die übrigens in den Grafen schwer verliebt ist, ihre Gunst fest versprochen.
Nachdem alles erledigt war, fuhr ich mit dem Grafen noch zum Bahnhof. Er erzählte mir sehr viel. Er hat als Offizier den Hererokrieg mitgemacht und ist, wie er selbst behauptet, jetzt der reichste Grundbesitzer in Deutsch-Südwest-Afrika. Sein Grundbesitz ist so groß wie das Königreich Sachsen. Vielleicht ist der Mann mit ein paar tausend M. für den „Kain“ heranzukriegen. Ich werde mit Sofie drüber reden. Was er mir von den Eingeborenen dort, von seinen Leoparden-Jagden und Kriegsabenteuern erzählte, interessierte mich ungemein, umsomehr, als ich den Eindruck hatte, daß keine oder nur wenig Renommage dabei war. Ich werde sehen, häufiger mit dem Manne zusammen zu kommen.
Von Margrit kamen heute 100 Franken. 70 stellt sie mir für diese Tage in Aussicht. 30 hat sie schon auf meine Anweisung Johannes gegeben. Ist das verzehrt, so ist jede Spur von dem Berner Pump für 3 Jahre ausgelöscht. Dann kommt die Katastrophe, sofern Gott nicht hilft. – Paul Cassirer läßt mich durch Herzog zur Beteiligung an seiner Balladen-Anthologie einladen, die sehr frech werden soll. Na, da kann ich dienen. – Feuchtwanger schickt mir das Gedicht eines alten Hofschauspielers (den Namen will ich zur Vorsicht nicht einmal hier nennen) gegen Possart. Ein Dokument beispiellosen Hasses und Erbitterung. Ich werde es im „Kain“ drucken. – Die „Allgemeine Rundschau“ bringt einen Artikel „Wedekind und seine Freunde“, in dem auch ich und der „Kain“ hundsfrech angepöbelt werden. Diese Burschen werde ich mir kaufen. – Der Kalender ist noch immer nicht weiter gediehen. Ich verdiene Prügel für meine Sorglosigkeit.
München, Sonntag, d. 8. Oktober 1911.
Die Hanako ist ein erstaunliches Phänomen. Eine Pantomimistin, deren gleichen es, in Europa mindestens, nicht giebt. Sie spielte zwei Stücke, die sie sich selbst verfaßt hat. Zuerst: „der Selbstmord“. Die dramatische Umrahmung ist sehr dürftig, und nur da, um den seelischen Affekt der Dienerin, die der Untreue bezichtigt wird, vorzubereiten und einzukleiden. Ihr ist von zehn goldenen Platten eine gestohlen worden (von einem verschmähten Liebhaber, aus Rache). Sie liefert die Platten ab und zählt sie ihrem Herrn vor: ganz gleichmütig und geschäftsmäßig zählt sie von 1–9 und merkt nun, daß eine fehlt. Sie zählt noch einmal, etwas verwundert und leise geängstigt. Zum dritten Mal in heller Angst – und dann noch ein viertes Mal schon ohne Hoffnung, ganz verzweifelt. Schon dieses viermalige Zählen von 1–9 gehört zum Aufregendsten, was ich auf der Bühne gesehn habe. Der Herr schlägt sie – die Reaktion darauf von körperlichem Schmerz, hündischer Angst, gekränkter Unschuld und Devotismus zugleich war ungeheuer stark. Und dann ist sie allein und beschließt sich zu töten. Das stumme Spiel dauert vielleicht eine halbe Stunde und wird minutiös durchgeführt. Ganz langsam vollzieht sich vor den Augen der Zuschauer alles, was an Effekten, Entschlüssen, Betrachtungen und Handlungen in dem kleinen Japanermädel vorgeht. Wie sie plötzlich von Tränenergüssen geschüttelt wird – ganz abrupt, wie sie das Messer aus dem Kleid zieht, es besieht, abputzt, ansetzt, wieder fortlegt, noch einmal die Teller durchzählt, herumhorcht, ob keiner da ist – das ist alles ganz gewaltig im Eindruck. Und dann der Selbstmord selbst. So habe ich noch nie jemand auf der Bühne sterben sehn. Es ist unglaublich kühn, die Illusion im Zuschauer zu wecken, als ob sie sich wirklich die Gurgel durchbohrt. Langsam drückt sie das Messer hinein, und die wimmernden Schmerzenslaute dabei sind ganz erschütternd. Das Blut läuft über das Kleid, sie sinkt – und nun kommen die andern Personen, der Herr mit dem vermißten Goldteller in der Hand, – und sie verdeckt die Augen und stirbt. Ich verhehlte mir trotz des ungeheuren Eindrucks, den ich hatte, nicht, daß hier die Schauspielkunst – und vielleicht gehört sie dahin – eng an die Grenze der Akrobatik geriet, nur daß hier eben jede Demonstration seelisch motiviert ist. Im zweiten Stück „Otake“ wird dieser Charakter der Hanako-Kunst kaum noch bemäntelt. Die Dienerin (Hanako) putzt sich in der Abwesenheit ihrer Herrin mit deren Gewändern. Der Liebste der Herrin kommt, hält sie für seine Geliebte. Die Dienerin, um sich nicht zu verraten, wendet ihm den Rücken. Er hält sich für abgewiesen. Darauf kommt ihr eigner Geliebter, der sie erkennt. Als er fort ist, noch einmal der vermeintlich Verschmähte. Sie wendet sich natürlich wieder von ihm ab und er ersticht sie in der Meinung, sie sei die Herrin. – Wie die Hanako schon auftritt, ein akrobatisches Bravourstück: mit einem ganz großen schweren Sack, den sie – ungeheuer lustig – ein paar Stufen hinaufzuschleppen hat. Sie macht es ganz köstlich – aber es ist eine zur Kunst gesteigerte Clownsleistung. Dann die entzückende Pantomime des Sich-Putzens. Wie sie ungeschickt – unglaublich rasch und viel mit sich selbst plappernd – die Schmuckschatulle der Herrin heranholt und sich unendlich umständlich pudert und schminkt – mit all den kleinen reizenden Mätzchen, die sie dabei macht (der täppische Versuch, sich im Spiegel von rückwärts zu sehn) – das ist alles unvergeßlich. Dann beim ersten Besuch des Geliebten der Herrin das amüsierte Versteckspiel, die Lust am Schmollen. Dann die entzückende Liebesszene, als der eigne Geliebte sie erkennt. Dann beim zweiten Besuch des Herrn doch die Angst sich zu verraten im Dilemma mit der Angst vor der Wut des Mannes, und schließlich stirbt sie wieder ganz einzig. – Das war ein großer Eindruck, den ich gestern empfing. Die Hanako ist eine Meisterin der Schauspielkunst, durchaus genial. Ihre Truppe spielt fein und diskret. Übrigens klingt die japanische Sprache scheußlich jaulend und papageienhaft.
Abends ging ich wieder zu Benz, Julchen abholen. Bob ist natürlich nicht abgereist, sondern in hysterischen Absichten dageblieben. Sie war nicht mit bei Benz, und Julchen, die ihr gesagt hatte, sie habe bis 2 Uhr zu tun, die aber um ½ 12 schon aufbrach, fuhr in die Odeonbar, wo sie mit ihrem Grafen verabredet war. Bis dahin küßten wir uns aufs Inbrünstigste im Auto.
Von Onkel Leopold kam heute eine überraschende Postkarte. Er habe meinen Brief mit ausführlichem Kommentar via Berlin (Mühsam, Hans) nach Lübeck (Julius und Leo) weitergeschickt und denkt bestimmt, daß das Geld kommen wird, aber erst in etwa 14 Tagen. –- Na also! Demnach hatte ich recht, daß ich mein Schreiben ein Meisterwerk nannte. Wenn jetzt blos keine halsbrecherischen Bedingungen an die Hergabe geknüpft werden. Ach, wär ich froh, wenn die Sache perfekt ist. Dann ist meine Arbeit gesichert und meine Stimme braucht nicht zu ersticken.
München, Montag, d. 9. Oktober 1911.
Gestern nachmittag hatte ich zum Kaffee den Besuch des Herrn v. Krobshofer, der mit einem jungen Maler, namens Huber kam. Wir berieten, in welcher Weise hier eine anarchistische Bewegung von neuem begonnen werden kann, kamen aber vorläufig zu keinem Resultat. Wenn ich von Zürich zurückkomme, werde ich jedenfalls mit einer öffentlichen Versammlung wieder mal losgehn. – Nachher rief mich die Fehl an, die mir schon die ganze letzte Zeit schwer auf die Nerven gegangen war und mich ziemlich viel Geld gekostet hat. Ihr Mann müsse unbedingt sofort in seine Heimat – er ist wieder vom Tod auferstanden –, und ihnen fehlten 30 Mk zum Reisegeld. Bekäme sie die Summe nicht sofort, so müsse sie sich erschießen. Das Ende vom Liede war, daß Rößler, Roda Roda und ich je 10 Mk hergaben, damit der schlecht riechende Schlowak abdampfen kann. Es ist schon ekelhaft, fortwährend zahlen zu müssen, wo Herz und Laune garnicht interessiert sind.
Nachher fuhr ich mit Rößler und dem Consul zu Eckel essen. Wir tranken Burgunder und Sekt und fuhren dann noch zu Benz. Das Stöckl hatte ihren Afrikaner bei sich. Ich sprach sie kaum, zumal ich schon ziemlich betrunken war. Nachher im Stefanie forderte mich Oppenheimer noch spät auf, mit ihm zu pokern. Über Unanständigkeiten dieses Pokerers habe ich hier früher schon Notizen gemacht. In der letzten Zeit hatte er wieder Material gegeben. Neulich forderte er mich auf, mit ihm 25 Schachpartien zu spielen, die er alle gewinnen wollte. Für jede schon gespielte Partie wolle er sobald er verliere oder Remis mache, eine Mark zahlen. Ich sollte, falls ich alle verliere, 5 Mk bezahlen. Wir spielten ganz korrekt, nahmen keine Züge zurück und zogen die berührte Figur. Dabei waren wir nicht rigoros. Hatten wir eine Figur schon gezogen, und sahen plötzlich, daß wir eine Dummheit gemacht hatten, so wurde dieselbe Figur rasch wieder, ohne daß der andre Einwände machte, woanders hingerückt. Nur einmal ärgerte ich mich: Oppenheimer hatte die Dame verloren und stand ziemlich schlecht. Ich rückte mit meiner Dame ein Feld zu weit und wollte sie, als ich sie kaum losgelassen hatte, wieder zurückschieben. Das verhinderte er, da er bei seiner Damenlosigkeit nicht mehr tolerant sein könne. So verlor ich die Partie, wie alle andren. Bei der 24ten Partie machte Oppenheimer einen entscheidenden Bock, durch den er eine Figur verlor. Nachdem ich sie schon gewonnen hatte, verlangte er seinen Zug zurück und behauptete dreist und gottesfürchtig, er habe mir schon unzählige Züge zurückgegeben. Um Krach zu vermeiden, und weil er mir in seiner Angst um das Geld leid tat, gab ich nach. Es mußten also 2 Züge zurück wieder aufgebaut werden, und nun verlor ich natürlich, da er ein sehr guter Schachspieler ist. Ich bildete mir ein, er würde bei der Streithaftigkeit der 24ten Partie wenigstens auf das Geld verzichten. Das tat er aber nicht, und ich zahlte ihm zunächst 2,50 Mk aus und blieb die Hälfte schuldig. – Danach bot er mir einen neuen Wettkampf an zu 50 Partien und den gleichen Bedingungen. Ich sollte bei Verlust aller Partien 10 Mk zahlen. Wir spielten und ich gewann die 22te Partie. Das war vorgestern. Ich sagte ihm gleich, daß ich auf das Geld verzichte, nur die 2 Mk 50, die ich ihm gleich bezahlt habe, solle er mir zurückgeben. Das tat er. Nun pokerten wir also gestern. Hardy saß dabei, – zum Schluß auch Emmy. Oppenheimer verlor 10–20 Mk an mich. Ganz zum Schluß bekam ich eine Sequens in die Hand, bei der das As unten als 5 zählte. Als verglichen wurde (er hatte nur ein kleines Paar), behauptete er, das sei keine Sequens und deutete an, ich wolle ihn betrügen. Ich brach das Spiel sofort ab, überließ ihm die 4 Mk, um die es sich handelte und machte dann, während er draußen war, zu Hardy und Emmy die Bemerkung, Oppenheimer sei kein anständiger Mensch. Er kam dazu, mischte sich ins Gespräch und behauptete ich hätte ihn schon den ganzen Abend betrogen. Ich wurde furchtbar wütend und beschimpfte ihn in der Absicht eine Keilerei zu provozieren. Aber erst nach dem Verlassen des Lokals, als ich schon auf der andren Straßenseite war, rief er mir nach, er werde mich ohrfeigen. Jetzt kam ich zurück und verlangte, er solle das tun, da ich nie zuerst schlage. Er wagte es aber nicht und bot einen kläglichen Anblick. – Ich ärgerte mich über Hardy und Emmy, die dann ganz vergnügt mit ihm zusammen auf den Heimweg gingen. In unseren Kreisen ist auch nicht eine Andeutung von Solidarität vorhanden. – Ich habe das alles hier so ausführlich aufgeschrieben, damit der Biograph des großen Oppenheimer (über den Michel ja jetzt schon ein Buch geschrieben hat) später charakteristische kleine Züge zur Verfügung hat. – Ich persönlich bin ja der Meinung, daß ein Mensch, der im privaten Leben nicht reinlich ist, auch keine reine Kunst schaffen kann. Denn die braucht neben aller Technik und Erfindung zuallererst einmal Lauterkeit des Herzens. Ich habe über bildende Kunst kein ganz sicheres Urteil. Daß Oppenheimer ein ganz hochbegabter Künstler ist, untersteht nicht dem mindesten Zweifel. Aber die Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, rücken mir die Ansicht vieler in das Licht großer Wahrscheinlichkeit, die behaupten, er mache Mätzchen und posiere. Ich kann mir nicht helfen: es wäre ein Wahnsinn der Natur, wenn sie zuließe, daß schmutzige Seelen erhabene Kunst gestalten können. Das ist ein Privileg der Sauberen.
München, Dienstag, d. 10. Oktober 1911.
Ich hörte gestern den ganzen zweiten Akt des Rößler-Hellerschen Lustspiels, das „die Fünf“ oder „die fünf Frankfurter“ heißen soll. Auch Gustav Waldau war bei der Vorlesung. Wir waren entzückt, und mein Eindruck, daß es sich hier um ein ganz feines Lustspiel mit echten dichterischen Qualitäten handelt, wurde sehr verstärkt. – Abends ging ich ins Lustspielhaus und sah Tschechows „die Möwe“, ein interessantes feines Stück, das die Gegenüberstellung lauter unglücklicher Menschen zum Gegenstand hat. Lauter schwerblütige Russen, jeder und jede mit einer unglücklichen Liebe im Herzen. Besonders fesselte mich der Charakter des Dichters Konstantin: ich wurde trotz der größten Verschiedenheiten an Donald Wedekind erinnert. Das Spiel war mäßig. Am besten noch Kalser. Auch die Lorm ging an, und die Roland mißfiel mir weniger als sonst. In der Torggelstube wurde gepokert. Ich gewann, zuerst 100 Mk, verlor dann aber fast alles wieder und stand mit etwa 15 Mk plus auf. Immer mitzunehmen.
Heut früh überraschte mich der Pfarrer Vogl mit seinem Besuch. Ich war mit ihm bei Gusmaroli zu Mittag. Aber er mißfällt mir doch wieder in mancher Hinsicht sehr. Wenn er über seine Freiheitlichkeit der Kirche gegenüber redet, so habe ich immer die Empfindung wie bei einem Schuljungen, der seinem Lehrer hinter dem Rücken die Zunge herausstreckt. Jetzt erwartet er mich im Stefanie mit Meyrink. Er bleibt morgen noch hier. Ich werde mich ihm nicht viel widmen, da ich noch meine Beiträge für den „Komet“ zu schreiben habe und übermorgen nach Zürich muß. Dort hoffe ich Johannes zu treffen.
München, Mittwoch, d. 11. Oktober 1911.
Johannes und Iza sind hier. Heut früh um 8 Uhr überraschten sie mich mit ihrem Besuch, beide totmüde von der Nachtfahrt, aber sonst ganz wohl aussehend. Jetzt – ich bin beim Mittagessen – schlafen sie und wollen erst um 5 Uhr geweckt werden. Morgen schon soll die Reise nach Wien weitergehen – und so werde ich meine Abreise auf den 13ten früh verschieben. Ich bin vorläufig zu froh über die Überraschung, um gleich über die Gespräche, die ich mit Johannes führte, zu berichten. – Heut nachmittag will Kanders herkommen zur Begrüßung und eben habe ich auch einen Dienstmann an Dr. Wolfskehl geschickt. Vielleicht orientiere ich auch noch Strich.
Den Pfarrer wurde ich gottseidank gestern noch los. Ich schützte Arbeitsüberlastung vor und empfahl ihm, zur Hanako zu gehen. Vorher waren wir im Café mit Meyrink zusammengewesen, der sehr interessant sprach, natürlich über überirdische Dinge: Mystik, Magie, Spiritismus, Okkultismus, Spuk und dergleichen. Ich war überrascht, daß er mir in vielen Einwänden recht gab und sie noch unterstrich und begründete. So sagte ich, die Theosophen seien mir deshalb so unsympathisch, weil ich in ihnen noch rüdere Rationalisten sehe als in den Häckelschen Alleswissern. Sie wollen sogar erkennen, wie die jenseitigen Dinge beschaffen sind. – Ich erklärte, ich hätte keinen Grund, an Behauptungen glaubwürdiger Menschen, sie hätten außerweltliche Erscheinungen, zu zweifeln. Nur leuchte mir nicht ein, daß das die Geister Verstorbener sein müssen. Meyrink gab mir zu, daß der einzige Anhalt dafür der sei, daß diese Erscheinungen es selbst behaupten, was natürlich garkein Beweis ist. Auch darin gab Meyrink mir recht, daß die Gespenstererscheinungen entsetzlich kitschig seien, indem sie in Bettüchern oder blauen Wölkchen dahergondeln. – Zwei Definitionen will ich mir merken. Meyrink erläuterte den Begriff Instinkt als „Gedächtnis der Zelle“. Und als Vogl mich fragte, was „Kitsch“ sei, antwortete ich zu Meyrinks großer Freude: „Ludwig der Zweite“.
Sonst ist vom gestrigen Tage nicht mehr viel zu vermerken. Bei Benz traf ich die Stöckl nicht an. Sie hatte sich krank gemeldet. Aber Uli mit Gefolge: Seewald, Kanders und Alwa (Thesing ist abgesetzt) waren dort. Nachher fuhr ich mit Uli per Droschke ins Stefanie. Daß sie sich auf der Fahrt zweimal von mir den Mund küssen ließ, sei um der Seltenheit dieser Gunst willen freudig angemerkt.
München, Montag, d. 16. Oktober 1911.
Gestern bin ich von Zürich zurückgekommen, und nun habe ich nachzutragen, was sich von Johannes‘ Aufenthalt her bis jetzt – also vom 11ten an zutrug. Das ist nicht wenig. Ich hatte, um Johannes Gelegenheit zu schaffen, einige seiner früheren Freunde wiederzusehn, Strich, Kanders und Wolfskehl zum Nachmittag zu mir bestellt. Ich las Johannes grade aus diesen Heften vor (auch Iza war dabei) als Strich und Kanders eintraten. Höfliche, keineswegs sehr warme Begrüßung. Die beiden nehmen Platz. Keiner spricht ein Wort. Ich frage, ob ich etwas anbieten darf und lasse eine Flasche Wein kommen. Endlose Pause. Ich äußere: „Im Theater wäre solche Pause unmöglich.“ – Man grinst. Die Situation wurde peinlich, aber keiner fand die Anknüpfung. Endlich kam Wolfskehl, und nun entspann sich ein recht trockenes Gespräch über Baader, Ritter und andre ältere bibliographische Herren. Zum Abendbrot bleiben wir allein. Abends hatten wir uns zu Kati Kobus mit Wolfskehl verabredet. Nachher noch einmal Stefanie. Ich hatte mit Wolfskehl eine lange Diskussion über die revolutionäre Tendenz alles Theaterspielens. Er sagte kluge Dinge. Verständigen konnten wir uns aber nicht. Mit Johannes war ich auch am nächsten Tage wenig allein. Er war sehr lieb. Von Iza hatte ich den Eindruck, daß sie auf mich in die Vergangenheit hinein schwer eifersüchtig ist. Am Freitag wollte ich nun in der Frühe nach Zürich fahren, Johannes und Iza mittags nach Wien. Dieser Freitag, der Dreizehnte, wird mir im Gedächtnis bleiben. Eine solche Häufung von Pech und Ärger ist mir lange nicht vorgekommen. Ich ließ mich sehr früh wecken, frühstückte in Johannes Zimmer und las ihm noch aus dem Tagebuch vor. Um 10h 20 sollte der Zug gehn. Wir fuhren mit der Elektrischen zur Bahn und erfuhren, daß der Zug seit dem 1. Oktober schon um 10h 10 fährt. Es war 10h 15. Der nächste Zug fahre 12h 50 und sei 8h 55 in Zürich. Ich telegrafierte sofort an Trindler, und wir gingen nun langsam ins Café Orlando di Lasso. Dort hatten wir uns kaum hingesetzt, als Johannes erklärte, er wolle noch einmal hinausgehn und komme gleich wieder. Er ließ seinen Überzieher zurück, kam aber nicht wieder. Ich war furchtbar ärgerlich, da ich keine Erklärung wußte, als die, er habe mal wieder an den Lokalen seiner alten Sünden entlang bummeln wollen und darüber Freundschaft, Verabredung und Eisenbahn vergessen. Um ¼ nach 12 ging ich, schickte einen Dienstmann mit dem Überzieher und einem Brief zu Iza und fuhr um 12h 50 pünktlich nach Zürich ab, sehr verärgert und übellaunig, daß der Freund ohne ein Wort des Abschieds mich einfach sitzen ließ. Jedenfalls beruhigte mich die Tatsache, daß ich ihm 50 Mark gegeben hatte, sodaß er nicht in unmittelbare Verlegenheit kommen konnte. Erst auf der Fahrt kam mir der Gedanke, er könnte vielleicht verhaftet sein. So verlief die Reise recht schlimm; ich war in fortwährenden Zweifeln und Sorgen, und Ärger, Angst, Selbstvorwürfe und alle möglichen Überlegungen ließen mir zu keinem klaren Nachdenken über den Vortrag Ruhe, den ich abends halten sollte. Die Reise schien mir endlos zu dauern. Merkwürdigerweise machte ich unterwegs bei aller Unruhe doch ein recht nettes Gedicht: „Küsse mich. Gieb mir die lüsternen Lippen – “ Vor Winterthur an einer kleinen Station ging der Zug plötzlich nicht weiter. Mehrmals hörte ich, wie das Abfahrtszeichen gegeben wurde, dann merkte man, wie die Lokomotive anzog. Es gab ein merkwürdiges Geräusch und Gerüttel im Wagen, aber er fuhr nicht los. „Aussteigen!“ wurde gerufen, und man erfuhr, daß die Bremse des Wagens, in dem ich saß, nicht funktionierte. Der Wagen wurde also ausrangiert und mit einer Verspätung von drei Viertelstunden ging die Reise weiter. Um ¾ 10 Uhr kam ich in Zürich an, von zwei Genossen an der Bahn erwartet. Im Sturmschritt in ein Auto und blitzschnell zum Volkshaus, wo ich im großen Saal sprechen sollte. Cilla stand vor der Tür des Hauses und berichtete, schadenfroh lachend, daß schon ein andrer rede. Ich lief die Treppen hinauf, und wurde vom Vorstand des Freidenker-Vereins mit Vorwürfen empfangen, die sogleich auch andeuteten, daß ich das ausgemachte Honorar nicht bekommen könne, da die Hälfte der Zuhörer schon weggelaufen seien und ihnen das Eintrittsgeld zurückgezahlt sei. Ich ließ mich auf keine langen Debatten ein und ging in den Saal, wo ein Sozialdemokrat schrecklich trocken und unverständlich von Religionslosigkeit und ähnlichem redete. Offenbar, um mich zu ärgern, zog er die Rede, als ich gekommen war, noch in die Länge. Als er fertig war, verlangte die Versammlung doch noch mich zu hören, und ich hielt nun einen ganzstündigen Vortrag über Ferrer, der mit sehr starkem Beifall aufgenommen wurde. In der Diskussion sprach nur der Vorredner einiges dummes Zeug, worin er die Notwendigkeit des öffentlichen Zwanges dartun wollte. Ich fertigte ihn leicht ab. Nun war ich total abgespannt und hatte, da ich während der ganzen Reise nichts gegessen hatte, Mordshunger. Aber statt nun gleich ihren Verpflichtungen nachzukommen, debattierten die Herren Ober-Freidenker unaufhörlich, ob sie mir zahlen sollten oder nicht. Mich wollte man nötigen, auf der Straße zu warten, bis sie zu einem Entschluß gekommen seien. Ich war wütend und ging dann mit Reitze und noch einigen Kameraden ins Café „Laus“. Dort kriegte ich nur ein paar Eier zu essen. Während ich mich daran sättigte, erschien ein Mann, trat auf mich zu und stellte sich als Polizeibeamten vor. Er habe den Auftrag, 20 Franken von mir einzuziehen, die ich als Gerichtsstrafe schon seit 1905 schulde. Andernfalls habe er mich zu verhaften, und ich habe sofort vier Tage Gefängnis abzusitzen. Ich hatte das Geld nicht und Reitze legte es aus. Ich muß das nun an Steinebach als Teilzahlung für verkaufte „Kains“ abführen. Die 20 Franken, die man nach mehr als 6 Jahren nun plötzlich von mir erpreßte, sind die Strafe für den „Diebstahl“, den ich damals an den Herren Münzer und Feigel begangen haben sollte. Der Fall sei hier erzählt, damit er in meinen Erinnerungen nicht fehlt. Ich lebte damals mit Johannes Nohl in Zürich oben auf dem Zürichberg, in der Rütistrasse, wenn ich nicht irre. Etwas weiter hinauf, schon am Waldrand wohnte der jetzige Schriftsteller Kurt Münzer mit dem früheren Inspizienten Feigel in homosexuell-flagellantistischer Gemeinschaft. Die beiden hatten mit uns Verkehr gesucht, den wir auch oberflächlich pflegten, obwohl Johannes sowohl wie ich gegen Feigl von Anfang an die stärkste Antipathie hatten. Wir pumpten die Nachbarn mitunter an, sie uns auch. Nun ging es uns einmal wieder sehr schlecht, wir hatten schon alle Bücher verkauft und hatten nichts zu essen. Johannes bekam einen Schwächeanfall vor Hunger. Ich stürzte zu den Nachbarn, um sie um ein paar Franken anzupumpen, traf sie aber nicht zuhaus. Aber auf dem Tisch bei ihnen lag der ganze fünfbändige „Cicerone“ von Burckhardt. Ich nahm die Bücher, trug sie zum Antiquar und verkaufte sie für 10 Franken unter der Bedingung, daß ich das Recht behalte, sie binnen 8 Tagen zum selben Preis wieder auszulösen. Den beiden hinterließ ich schriftlichen Bescheid über den Verbleib der Bücher. Nun kamen sie aber an und erklärten, sie müßten die Bücher unbedingt sofort wieder haben, da kompromittierende Photographien darin lägen. Als ich die holen wollte, war der Buchhändler inzwischen verreist, und die andern Leute im Haus wußten nicht, wohin er sie gelegt hätte. Inzwischen wurde der Feigl immer zudringlicher und ausverschämter. Wir boten ihm die 10 Fr. in bar, um die Bücher wiederzuholen. Es half nichts. Er behauptete, die Bücher, in denen Münzers Name stand, gehörten jetzt ihm und er bestehe auf ihrer sofortigen Herbeischaffung. Da er bei mir hierbei sehr freche Bemerkungen über Nohl machte, schmiß ich ihn hinaus. Er ging zur Polizei und verklagte mich wegen Diebstahls. Inzwischen hatten wir Bücher und Bilder wiederbeschafft, auf denen die beiden Herren allerdings in recht gewagten Stellungen getypt waren. Bei der Verhandlung erklärte ich, mein Vorgehen sei nach allen Gepflogenheiten einer weniger bürgerlichen Bohême-Moral absolut selbstverständlich und korrekt gewesen und ich würde, wenn ich einem hungrigen Freunde nicht anders helfen könnte, im ähnlichen Falle wieder genau so handeln. Der Richter erklärte, auch er würde in diesem Prozeß lieber die Rolle des Angeklagten als die des Klägers spielen, mußte mich aber verurteilen. Feigl wurde kurze Zeit danach wegen einer an Benedikt Friedländer begangenen Erpressung zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. – Also diese 20 Fr. Strafgeld hat die sorgsame Züricher Polizei jetzt nach 6 Jahren eingezogen, indem sie mich bespitzeln ließ, wohin ich nach meinem Vortrag ginge, und mich dann im Caféhaus überfiel. – Dann ging ich mit in Reitzes Wohnung, wo ich von diesem Unglückstag ausschlief. – Am nächsten Morgen ließ ich in einer Bank ein paar Mark in Franken umwechseln. Dabei sah ich ein junges Mädchen, das sich einen deutschen Zwanzig-Markschein kaufte. Ein reizendes Geschöpf, jung, zierlich, lebendig. Als ich mit Reitze wieder auf der Straße war, wollte ich sie an uns herankommen lassen. Sie merkte es aber und blieb vor jedem Schaufenster sehr lange stehn, um nicht an uns vorbeigehn zu müssen. Sehr langsam bewegten wir uns zum Café „Laus“. Noch langsamer folgte das Mädel. Ich ging vor die Tür des Cafés und beobachtete sie. Als sie am Hause davor angelangt war und dort Ansichtskarten betrachtete, nahm ich meinen Hut und ging auf die Straße. Ich sprach sie an. Nach längerem Zögern und Sträuben ließ sie sich auf eine Unterhaltung ein und kam dann auch mit ins Café hinein. Es stellte sich heraus, daß sie am Theater, und zwar an der Oper in Zürich engagiert ist. Ich schlug ihr vor, sie solle nach München kommen, ich würde mich bei einem Cabaret für sie interessieren. Sie war sehr enchantiert von der Idee und schrieb mir ihren Namen auf: Charlotte Gillèt. Sie ließ sich willig von mir Beine und Schenkel abtasten und wir verabredeten um 10 Uhr abends im Züricher Hof ein Rendezvous (dort hat sie mich leider versetzt.) Ich will jedenfalls abwarten, ob sie sich nicht noch bei mir meldet und will dann suchen, sie hier irgendwo anzubringen. Denn das kleine frische Balg hat mir ausnehmend gut gefallen. Und in Zürich ein hübsches Mädchen finden, das ist gewiß noch nicht vielen Menschen gelungen. – Reitze und ich gingen dann zu Dr. Brupbacher. Ich ließ mir von ihm ein Rezept gegen den Bandwurm aufschreiben, der sich in der letzten Zeit wieder sehr unangenehm fühlbar macht und verabredete mich zum Nachmittag mit ihm in dem neuen Café Odeon. Dort hatten wir sehr gute Gespräche. Er ist viel klarer und in seinen Ansichten ernster geworden als früher und tendiert jetzt stark zum Sozialistischen Bunde. Über Friedeberg urteilt er jetzt ebenso abfällig wie ich. Nachher kam Reitze und berichtete mir, die Herren Freidenker hätten Dienstag eine Vorstandssitzung, in der sie sich schlüssig werden wollten, ob und wieviel sie mir bezahlen wollen. Da lassen sie mich also erst die Reise machen, hören auch mein Referat an und prellen mich nachher um die Kosten. Ein ekelhaftes Gesindel, diese freien Menschen! – Ich sprach noch in verschiedenen Cafés verschiedene Bekannte und schlief diese Nacht – leider allein – im Hotel zum Bären.
Gestern kam ich nun von der unerquicklichen Reise zurück. Die Fahrt über den Bodensee in der herbstlichen Mittagssonne war herrlich schön. Im übrigen dichtete ich auf der Fahrt die 12 Monats-Sprüche für den Kalender. – Ich fand hier die Gastspiel-Kontrakte des Kleinen Theaters vor, die ich heute dort unterzeichnete. Heut abend muß ich auftreten. Außerdem waren Drucksachen da, u. a. der „Pan“, in dem Kerr (der Herzog hinausgeekelt hat) Harden wegen einer sexuellen Kleinigkeit frech anpöbelt und in dem ein Nachruf auf Victor Hadwiger steht, von dessen Tod ich dadurch erst erfuhr. Er war erst 32 Jahre alt und ist am Herzschlag gestorben. Obgleich er ein alter Duzfreund von mir war, hatte ich keine allzugroßen Sympathien für ihn. Immerhin ein sehr interessanter Typus und ein großer Sonderling, – dabei ein starkes wenn auch verwirrtes Talent.
Rößler lud mich telefonisch zu Eckel ein, und da ich inzwischen hier schon Abendbrot gegessen hatte, ging ich nur zu einem Schluck Wein hin. Der Konsul war auch schon da und ich erfuhr zu meinem Erstaunen, daß es nun zwischen den beiden wirklich zu Ende ist. Sie hat ihn mit einem Architekten Lutz betrogen und er nimmt das schwer übel. Sie haben hier beide die Pension gekündigt und Rößler will vorläufig ganz von München fort, was ich unendlich bedauern würde. Dann kam noch Heinrich Mann und Brantl, und schließlich ging ich mit H. Mann noch zu Benz, wo wir bis 2 Uhr nachts blieben. Sofie Stöckl ist leider noch krank. Ich will sie morgen besuchen.
Heut war der Konsul bei mir zu Tisch. Wir küßten uns sehr reichlich, und das Weitere wird nun wohl auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. – In einigen Tagen wird zudem das Puma wieder hier sein – und dann hoffe ich, manchmal recht glücklich sein zu dürfen.
München, Dienstag, d. 17. Oktober 1911.
Der „Komet“ hat – mit auf meine Anregung hin – regelmäßige Redaktionssitzungen eingeführt, an denen die Hauptmitarbeiter teilnehmen. Gestern fand, da Fuhrmann von Rußland zurück ist, die erste statt, an der außer den Redakteuren Fuhrmann und Diro Meier, Velisch als Drucker, die Zeichner Lutz-Ehrenberger, Bolz und Aller und ich teilnahmen. Die Veranstaltung erwies sich als recht fruchtbar. Ich halte es für möglich, daß das Blatt sich allmählich noch recht tüchtig entwickeln kann, sodaß die Mitarbeit daran nicht blamabel sein wird. Meier deutete mir kürzlich an, man denke daran, mich voll mit festem Gehalt als Redaktionsbeirat anzustellen. Ich werde 200 Mark monatlich verlangen. Wenn daraus etwas wird, miete ich das Nebenzimmer, das 40 Mk kosten soll, und werde dann, zum ersten Mal im Leben, getrenntes Schlaf- und Wohnzimmer haben. Ich machte während der Sitzung für 30 Mk Witze, die ich ausgezahlt bekam.
Abends mußte ich im Kleinen Theater auftreten, wo ich bis zum 23ten inclusive Kontrakt habe. Ich werde als große Kanone ganz am Schluss abgeschossen. Das Programm vorher war, abgesehn von einer Französin, die ich von Benz her kannte, unsagbar scheußlich. Ich hatte viel Erfolg, zumal mit den kräftigen Sachen, die mir die Zensur erstaunlicher Weise sämtlich freigegeben hat (darunter „der Komet“ und „Thekla“). Nachher ging ich mit Rößler, dessen Bruder, der in Berlin Bankdirektor ist, Roda Roda und Frau, Wennerberg und Frau und der Baronin v. Reznicek, die alle meine Vorträge angehört hatten, in die Odeon-Bar, wo reichlich getrunken wurde. Von da zu Benz. Dort zotete man kräftig. Besonders war Rößlers Bruder in riskanten Witzen sehr ergiebig. Die Stöckl erzählte mir, daß ihre