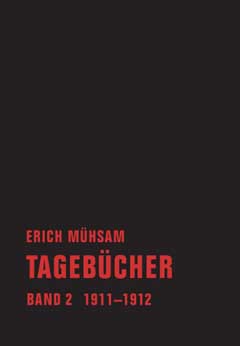IX
3. April – 26. Juni 1912
S. 1156 – 1299
München, Mittwoch, d. 3. April 1912.
Mit dem erotischen Grossbetrieb, der „Glücksträhne“, wie Lotte sich in Anlehnung ans Pokerspiel ausdrückt, scheint es wieder mal vorbei zu sein. Tagelang kein Kuß, und alles fort und verreist, wovon man einige Freuden erhoffen könnte. Dabei hätte ich grade jetzt große Regelmäßigkeit nötig, da ich schauderhaft onaniere und wirklich bald üble Folgen davon fürchte. – In einigen Tagen ist ja vielleicht Ella Barth zu erwarten, und vielleicht bringt sie mir die ersehnte Ruhe und Beglückung.
Vorgestern arbeitete ich eifrig am Leitartikel des „Kain“ (der erst heute fertig wurde). Abends war ich in der Torggelstube, nachdem ich mit Wilm eine Stunde allein das „Krokodil“ bevölkert hatte. Ich unterhielt mich ausgezeichnet mit Wilhelm v. Scholz, den ich dann noch bis zu seiner Pension in der Max Josefstrasse begleitete. Später traf ich im Stefanie Anton Dreßler, der mir gräßliche Dinge berichtete. Er muß 1000 Mk Schulden seiner Ehefrau zahlen, die sich nicht von ihm scheiden lassen will. Am Tage nach dieser Eröffnung verlor er aus der Tasche Schmuck im Werte von 2200 Mk, den sich Frl. Rolffs nur ausgeliehen hatte, und am folgenden Tage fuhr er mit ihr im Auto zur „Bonbonnière“, bei einer Kurve ging die Tür auf, Frl. Rolffs wurde hinausgeschleudert und erlitt einen Schädelbruch und eine Gehirnerschütterung. Sie liegt schwer krank in einer Klinik. Ich war recht erschüttert von diesen Mitteilungen.
Gestern früh traf ein Telegramm ein von Berndls, ich möchte sie abends um 7 Uhr von der Bahn holen. Um 3 Uhr war Komet-Sitzung (die Fortsetzung des Blattes ist noch unentschieden). Um 5 ging ich zu Strauß, um ihm den Bahnhofsprozeß zu übertragen, er hatte Konferenz und ich mußte 1½ Stunden warten. Ehe ich zur Bahn ging, telefonierte ich dann noch mal heim, um das Abendbrot abzubestellen. Herr Kaderschafka sagte mir, eine Dame sei dagewesen und habe auf einem Zettel hinterlassen, daß sie mich im Stefanie erwarte, zwei andere Damen hätten sehr oft per Telefon nach mir gefragt. – Berndls kamen an. Ich brachte sie in dieser Pension unter. Pedantische Kleinbürger. – Ich fand in meinem Zimmer diesen Zettel: „Cher Mühsam. Je suis à Stefanie. Zaza t’embrasse.“ Jane! die ich längst mit ihrem Espagnol in Italien wähnte! Sie war natürlich längst fort vom Café. Ich schrieb ihr, sie solle heute zu Tisch zu mir kommen. Sie kam leider nicht. Vielleicht wollte sie adjö sagen. – Die beiden andern Damen, wurde mir im Café gesagt, hätten auch dort fortwährend angerufen. Natürlich meldeten sie sich, als ich endlich kam, nicht mehr. Wer mag das gewesen sein? Ich war sehr wütend, alles versäumt zu haben und ging in die Torggelstube. Zuerst nur Strauß. Dann kam der widerliche Sektreisende Grimm, später Muhr, Dr. Kantor, Wilh. v. Scholz, Gustel Waldau, Weigert, Dr. Rosenthal mit dem Pariser Maler Spiro, den ich noch aus dem Café du Dôme kenne, und zuletzt, als die meisten schon fort waren, Wedekind, der von Wien zurück ist. Es war ein sehr netter Abend. Ich trank sehr viel.
Finanziell wird dieser Monat, fürchte ich, sehr übel werden. Die Rechnung beträgt 171 Mk. 40 an Johannes, und 275 Mk werde ich alles in allem nur haben, falls der „Komet“ nicht doch noch wieder gehn sollte. Jaffé ist noch verreist, mit dem Dreimaskenverlag wird nicht allzufest zu rechnen zu sein, und wenn nun – worauf ich andrerseits doch sehr sehr hoffe – Ella kommt – – ich weiß nicht, wie alles werden wird, zumal am 1. Mai ja nicht einmal mehr die 100 Mk, die ich diesmal vom „Komet“ kriege, da sein werden. Von Lübeck hatte ich mal wieder eine Karte. Papa gehts besser. Er geht schon wieder in Sitzungen. Aber sein Herz ist noch krank, wovon er selbst nichts ahnt. Ich habe in der letzten Zeit sehr stark das Gefühl, daß doch in der allerkürzesten Frist die große Wendung bevorsteht. Gott geb’s.
München, Freitag, d. 5. April 1912.
Mit dem „Kometen“ sieht es windig aus. Ich fürchte sehr, daß ich mit dem Schuldschein über 1500 Mk eine kapitale Dummheit gemacht habe. Geht jetzt das Blatt ein, so habe ich eine Menge Arbeit ohne Vergütung geleistet und muß obendrein später – wann denn nun endlich? – ein kleines Vermögen draufzahlen. Könnten die, die nie Not gekannt haben, blos einen Einblick in die Lage eines Menschen tun, der ewige Geldsorgen hat! Hätte ich gewußt, wovon ich diesen Monat alle kleinen Ausgaben bestreiten kann, hätte ich mich wohl gehütet, mich derartig zu verpflichten. Aber die Hoffnung, wieder ein Jahr lang – und wohl doch das letzte, in dem ich derartig rechnen muß – mit einigem Anstand über die Tage hinwegzukommen, war so verlockend, daß ich das Risiko einging. Morgen wird mir wohl als Geburtstagsgeschenk die Nachricht zuteil werden, daß es Herrn Wild nicht gelungen ist, den Rest der Garantie aufzutreiben, daß ich kein Geld mehr vom „Kometen“ bekomme und Herrn Diro Meier statt dessen 1500 Mk schulde. – Es gibt nichts Kostspieligeres in der Welt als den Dalles.
Eben telefoniert Albert R., er sei im Stefanie. Ich breche also ab und eile hin. Vielleicht erfahre ich etwas über die Verhaftungsaffären.
München, Sonnabend, d. 6. April 1912.
Mir ist garnicht geburtstäglich zu mute, und den ganzen Tag wars nicht anders. Kein wirklich beteiligtes Herz, kein Kuß, keine Feier. Ich nehm’s, wie es ist.
Um also trocken fortzufahren. Was geschah vorgestern? – Ach ja: Mittags erschien Jane, ich lag noch im Bett, küßte mich, zirpte herum und machte mich sehr heiter, ob ich auch einsah, daß sie erotisch für mich verloren ist. Wir gingen miteinander ins Café, wo sie ihren argentinischen Béguin traf – und der Tag brachte weiter nichts Sensationelles. Tags zuvor hatte sie mich abends zu Benz bestellt gehabt, kam aber nicht. Ich traf dort das Puma mit ihren Ehemanns-Stellvertretern, und Freksa, die Beutler, Düllberg und Wilhelm v. Scholz. In der Torggelstube war in diesen Tagen gar nichts los. – Gestern gabs auch nichts Wichtiges, nur, daß Uli von Paris zurück ist. Ich traf sie auf der Straße vor dem Café Stefanie und freute mich, daß sie mir zur Begrüßung gleich den Mund gab.
Abends war dann also R. im Café. Er erzählte von der Scheidegger-Geschichte. Es scheint doch nicht ganz so hoffnungslos zu stehn, wie ich glaubte. Man hofft, Scheideggers Unglaubwürdigkeit infolge seiner erblichen Belastung und andern Erscheinungen von Geisteskrankheit nachweisen zu können. Überaus gefährlich ist die ganze Sache natürlich trotzdem. Ich kann wohl sagen, daß mich seit Jahren nichts mehr derartig aufgeregt hat wie die bodenlose Schuftigkeit dieses Lümmels. Denn – soll er selbst irrsinnig sein –, auch Wahnsinnsausbrüche müssen von Charakternoblesse temperiert sein. Sehr erschütterte mich, was R. über Friedel erzählte. Sie ist natürlich sehr gefaßt und beherrscht, doch aber in großer Bewegung und sieht schlecht aus. Alle Augenblicke ist sie in Zürich. Sie will weder mit mir noch mit sonstwem irgendwelche Begegnungen, zumal sie fortgesetzt bespitzelt wird. (Seit einer Reihe von Tagen beobachten Morax und ich an der Ecke gegenüber dem Café Stefanie zwei Spitzel, die sich in 2–3 Stunden gegenseitig ablösen und dort Wache stehen. Ob diese Beschnüffelung in irgendeinem Zusammenhang mit den Schweizer Verhaftungen steht? Und in welchem?) – Der Gedanke an Friedel verfolgt mich seit dem Unglück, das sie betroffen hat, unausgesetzt. Selbst nachts schrecke ich auf und meine, ihr geschähe etwas. Ob sie in der Ferne ein Gefühl hat für meine trostlose Treue? Wann werde ich sie endlich wiedersehn?
Als ich gestern heimkam, fand ich ein Telegramm aus Paris vor, ich solle sofort an Johannes telegrafisch das Monatsgeld nach Arago schicken. Nach seinen letzten Mitteilungen mußte ich annehmen, er sei in Zürich, und natürlich ist das Geld dorthin abgegangen. Ich bin sehr böse auf ihn, daß er mir immer nur schreibt, wenn er mich im Moment braucht. Freilich: ich schreibe ihm ja überhaupt garnicht.
Und heute habe ich nun also mein 34tes Jahr glücklich hinter mich gebracht. Die Waidmannsluster und Tante Rosel aus Graz waren gestern schon mit Glückwünschen da, heute nun alle meine Geschwister, außer Joëls. Geschenke stehen mir auch in Aussicht. Hans und Minna wollen wissen, ob ich lieber Hemden oder Unterhosen haben will. Da ich Unterhosen überhaupt nie trage, werde ich Hemden wählen. Charlotte stellt eine Tasse, Ostereier und einen Aschbecher in Aussicht als gemeinsames Präsent von Joëls und Landaus. Schön. – Von Papa kam ein ausführlicher Brief, dem 10 Mk beigeschlossen waren. Der Inhalt ergriff mich einigermaßen. Er schreibt ausführlich über seinen Gesundheitszustand und berichtet, daß es ihm erheblich besser gehe als in den letzten drei Monaten. Dann heißt es wörtlich: „Viel wird ja nicht mehr werden. Der Knax, den ich weghabe, wird sich kaum mehr reparieren lassen.“ Die erste Empfindung, in diesen Worten solle wieder ein Vorwurf gegen mich liegen, wird wohl falsch sein. Er wird es wohl ganz unpolitisch meinen – hoffe ich. Aber seine Glückwünsche für das neue Lebensjahr erbittern mich doch wieder recht. Könnte er nicht dafür sorgen, daß mein Leben glücklicher und meine Arbeit zweckmäßiger und erfolgreicher wäre? Zehn Mark – ein Millionär! – Aber andrerseits: kennte er meine Empfindungen, er wäre unfähig, sie entfernt zu begreifen. Er lebt in einer andern Welt, weil er in einer andern Zeit lebt.
Mittags waren Uli und Seewald bei mir. Sie schenkten mir Zigarren. Lotte und Emmy gratulierten mir im Caféhause, in dem ich den ganzen Nachmittag von 3–8 Uhr stumpfsinnig zugebracht habe. So fange ich das neue Lebensjahr an, und bei Gott mit wenig Hoffnungen. Der „Komet“ ist hin – man muß es jetzt wohl sicher annehmen – es sieht trübe aus.
34 Jahre! Du lieber Himmel! Was habe ich erreicht! Wie kläglich wenig! Immer noch das dürftige möblierte Zimmer. Immer noch von Monat zu Monat die Angst, die Rechnung nicht zahlen zu können. Und schon wieder die völlige Entkleidung aller Sicherheit im Geldverdienen. – Und der Ruhm? Du lieber Himmel! Was tue ich mit dem bißchen Berühmtheit? Mit dem Angeglotztwerden? Mit den Komplimentationen? Wer kennt meine Lyrik? Wer führt meine Dramen auf? Wieviele Leute lesen auch nur den „Kain“, der noch mein einziger Trost ist? – Und die Liebe? Schweigen will ich, erröten, mich schämen, und ihrer denken, der Einzigen, die ich verlor, weil ich’s nicht wert war, sie mir zu erhalten. Friedel, Friedel! Mit dem Gedanken an Dich beginne ich dies neue Jahr. Mit dem Gedanken an Dich werde ich dies Jahr wie alle ferneren dieses Lebens beschließen – und ewig unglücklich sein.
München, Sonntag, d. 7. April 1912
Das war wohl der ödeste, stimmungsloseste Geburtstag gestern, den ich je erlebt habe: aber auch garnichts Festliches den ganzen Tag, garnichts Erhebendes und Erfreuliches. Nach der gestrigen Einzeichnung hier ging ich in die Torggelstube, wo ich zuerst mit Lotte, Uli, Seewald, Kalser und Cronos, nachher, als die noch in eine Bar weitergingen – natürlich ohne auf die Idee zu kommen, mich zum Mitgehn aufzufordern, – am Stammtisch mit Futterer, Schwaiger und einem Regierungsrat Fischer, einen ganz lustigen, stark fürs Theater interessierten Herrn, der mir seine Stellung als gleichbedeutend mit der eines preußischen Landrats erklärte. Schwaiger hatte den guten Geschmack, mich zu einer Diskussion über Anarchismus zu provozieren, und ich nahm Dalba, Caserio, Czolgosz, Breszi u.s.w. energisch in Schutz. Zum Glück kam um 2 Uhr Steiner, der mich ins Café Orlando abholte, wo wir noch bis 3 Uhr Billard spielten. – Einen Ertrag hat aber dieser Tag doch gehabt: ich habe seit langem wieder einmal ein Gedicht gemacht, das mir bis jetzt aus der Nähe noch sehr gelungen scheint: ein Sonett (merkwürdig! Ich mache doch nie Sonette!), zu dem die Sorge und das Mitgefühl für Friedel mich stimmte. Ich hatte es den ganzen Tag embryonal im Kopf, bis es in ganz später Nachtstunde – zum Teil erst im Bett – seine überraschende Form annahm. Ich war von der Anstrengung des Dichtens so aufgeregt, daß ich sehr lange nicht einschlafen konnte und mir nach 5 Uhr früh noch die Patience-Karten aufschlug.
Heut kam ein Brief von Grethe und Julius aus Lübeck. Die beiden größeren Jungen hatten mit drangeschrieben. Der älteste, Walther, hat nächste Woche „Barmitzwoh“. Ich muß ihm was schenken, und werde wohl eine hübsche Lenau-Ausgabe billig zu erwerben suchen. – Ferner ein sehr betrübender Brief von Ella. Sie kommt nicht. Offenbar ist Martin wahnsinnig verliebt in sie und läßt sie nicht fort. Aber sie fordert mich auf, zur Hauptmann-Premiere nach Lauchstädt (wo liegt das?) zu kommen, wo sie auch sein wird. Ich will mich erkundigen, was das bedeutet. Hauptmann wird doch sein neues Stück „Gabriel Schillings Flucht“ nicht an irgendeiner Provinzbühne uraufführen lassen? Ich verstehe das nicht. Ehe ich mich zu solcher Reise entschlösse, müßte ich auch erst – abgesehen von der Geldmöglichkeit – die Gewißheit haben, daß Ella ohne Begleitung dorthin kommt. Ihr im Hotel vor der Zimmertür des Herrn Martin Gutenacht sagen zu sollen, könnte mich wenig reizen.
Jetzt will ich für Steinrück und Waldau, die im Neuen Verein Lyrik rezitieren sollen, Gedichte aus dem Krater heraussuchen, und jedem ein Exemplar schicken.
München, Montag, d. 8. April 1912.
Ostermontag. Es ist ein wundervoller warmer Frühjahrstag, und ich bin wieder erst um ½ 2 Uhr aufgestanden. Ich muß schon gestehn, daß ich garnicht mehr mit meiner Lebensart zufrieden bin. Vielleicht werde ich doch mal die Pension wechseln müssen. Das Essen gefällt mir, seit die neuen Wirtsleute da sind, garnicht mehr, und das Ende des „Kometen“ wird mich ja wohl sowieso in die fatale Notwendigkeit versetzen, meine ganze Lebenshaltung wieder beträchtlich zurückzuschrauben. Jetzt habe ich noch einige 40 Mk – sind die aber alle, dann gnade mir Gott oder Professor Jaffé.
Die Liebes-Glücksträhne scheint ganz abgerissen zu sein. Ich sehne mich wieder sehr nach Erotik. Nicht mal ein hübsches Dienstmädchen ist da. – Seit längerer Zeit interessierte mich im Café Stephanie ein sehr anmutiges Geschöpf: groß, mit den hochgezogenen Schultern, die ich so sehr liebe, schlank, blond, blauäugig, und in der Kleidung von jener gelinden Schlampigkeit, auf die ich immer wieder hineinfalle. Keiner wußte ihren Namen, man sagte mir nur, daß sie in der Pension Führmann wohne. So sah ich sie dann auch bald mit Leuten meiner entfernteren Bekanntschaft und beschloß, ihr unter allen Umständen persönlich näher zu treten. Ich fing das so an wie immer: ich grüßte sie, und erreichte in kurzer Zeit, daß sie mich, wenn ich sie mal übersah, zuerst begrüßte. Ich wollte nun einmal eine Gelegenheit abwarten, wo ich sie allein anträfe und sie dann anreden, da ich sie nun aber vor einigen Tagen in der Gesellschaft von Morax sah, setzte ich mich einfach dazu. Sie war sehr nett. Es stellte sich aber heraus, daß sie nicht nur verheiratet ist, was ja nicht unbedingt hätte zu stören brauchen, sondern in zwei Monaten ihrer Entbindung entgegensieht. Ich hatte nichts bemerkt. Ihr Mann ist ein ganz junger Bursche namens Jung, die Ehe dauert bis jetzt 2 Jahre und ein einjähriges Kind ist schon da. Gestern saß ich mit dem Ehepaar im Café, Jane kam mit Béguin an unseren Tisch, und verschwand bald wieder – nachdem ich dem Herrn Bunge (dem Argentinier) seine Eifersucht vorgeworfen und er sie bestritten hatte –, und gegen ½ 7 Uhr beschloß man, einen gemeinsamen Spaziergang zu machen. Morax und Idachechen [Idachen], Öhring, das Jungsche Ehepaar und ich bewegten uns in den Englischen Garten, ich immer per Arm mit der schwangeren jungen Frau, die drei anderen Männer vorne weg, und in der Mitte allein die treue Ida, die jugendliche Ahnfrau. Es war beschlossen, zu Führmann essen zu gehn, und nach einem sehr langen Spaziergang kamen wir unten in der Belgradstraße an. Es wurde Clavier gespielt. Der kleine Lotz machte die possierlichsten Größenwahnscherze, und nachher, Frau Jung hatte sich gedrückt, gingen wir noch zu etwa 6 Personen einen Schnaps trinken, wobei wir wohl ein Dutzend Kneipen absuchten. In keiner gab es Schnaps. Endlich fanden wir in der Herzogstrasse eine Wirtschaft „Ursula“, wo wir welchen kriegten. Ein Klavier wurde hereingeschoben, Morax spielte und wir andern sangen dazu revolutionäre Lieder zum Erstaunen der übrigen Gäste. Gegen 11 Uhr begleitete man mich zur Straßenbahn und ich fuhr zur Torggelstube. Ich ließ das Puma mit den sie umwerbenden Cronos und Kalser allein und setzte mich in die Ecke, in der die Lorm, Feldhammer, Weigert, Schwaiger, Spiero, Gustel Waldau und Albert Steinrück versammelt waren. Das Gespräch ging natürlich fast ausschließlich um die Presse-Intrigen gegen Steinrück und Speidel. Steinrück erklärte kategorisch, daß er keine Lust habe, sich hier herumzuärgern, da er die glänzendsten Anträge nach Berlin und Wien habe. Er, Spiero, Feuchtwanger, der noch gekommen war, und ich gingen dann noch ins Orlando. Steinrück wollte von Feuchtwanger und mir wissen, was er, speziell auf die neueste Schweinerei der „Münchner Post“, die in diesem Augenblick dem „Bayerischen Kurier“ gegen Steinrück beispringt, tun soll. Wir rieten ihm übereinstimmend: garnichts. – Ich bemühe mich, unter Künstlern, Literaten und geistig interessierten Menschen eine Sympathiekundgebung für Speidel zu inaugurieren. Es ist aber sehr schwer, einen aktiven Menschen zu finden, von dem es ausgehen kann. Ich muß natürlich im Hintergrund bleiben, da sonst die ganze Aktion diskreditiert wäre. Ich will womöglich heute mit Professor v. Stieler sprechen.
München, Mittwoch, d. 10. April 1912.
Gestern wurde mein keuscher Wandel wieder einmal anmutig unterbrochen. Mittags kam Emmy, die nach Berlin ans Passagecabaret engagiert ist und von mir Texte zum Singen haben möchte. Ich lag noch im Bett und nahm sie zu mir. Sie ist immer noch reizend in ihrer nackten Hemmungslosigkeit. Während wir noch splitternackt nebeneinander lagen, brachte das Mädchen einen Brief, den ich ihr, da auf Antwort gewartet wurde, vorsichtig durch die Türspalte abnehmen mußte: Von Dr. Emma Gellért. Sie wohne jetzt bei mir nebenan, Akademiestrasse 15, und bitte mich, doch gleich zu ihr zu kommen. Ich schrieb zur Antwort, es sei im Moment unmöglich. Ich käme bestimmt heute um ½ 3. Jetzt muß ich blos schnell essen und dann gleich zu ihr. Mir graut ein wenig. – Gestern nachmittag erschien, von einer Postkarte, die früh ankam annonciert, Pfarrer Vogl. Ich weiß nicht viel mit ihm anzufangen, doch muß ich ihm auch heute wieder einige Abendstunden widmen. Über die Schweizer Verhaftungsgeschichte war er noch nicht orientiert, und nun natürlich sehr erschrocken. Heut ist er bei Meyrink in Starnberg. – Gestern abend war ich, wie täglich, in der Torggelstube (immer in der trügerischen Hoffnung, Consuela Nicoletti zu treffen). Zuerst mit Muhr allein, dann mit Weigert allein. Mit dem ging ich noch ins Café Odeon, wo wir Domino spielten. Nachher kamen noch W. v. Scholz, Steinrück und Dr. Goldschmidt, und zum Schluß begleitete ich Steinrück heim, den die Preßhetze gegen ihn sehr aufregt. Er erzählte mir von seinen Maßnahmen. Ich habe leider auch mit Stieler nichts ausrichten können. Die aktiven Menschen sind in München sehr dünn gesät.
München, Donnerstag. d. 11. April 1912.
Morax brachte gestern eine erschütternde Nachricht ins Café. Wilhelm Michels junge Frau, Anita, die frühere Frau von René Prévôt, ist nach ganz kurzer Influenza-Krankheit gestern früh gestorben. Michel soll völlig verzweifelt sein, und als Morax bei ihm war, um ihn und Anita zu dem Cabaret-Abend einzuladen, den er mit Emmy morgen veranstaltet, fassungslos geweint und beinah irre geredet haben. Es ist sehr schlimm für ihn. Vor etwa zwei Jahren ließ er sich von der Mutter seiner sechs Kinder scheiden, die ihn verlassen hatte, um mit Karl Schloß zu leben. Er hatte das Glück, Anita Prévôt zu finden, und sie nahm sich der drei Kinder, die Michel zu sich nehmen mußte, mit rührender Liebe wie eine echte Mutter an. Seit längerer Zeit kränkelte sie schon. Besonders eine mißglückte Geburt hatte ihr übel zugesetzt, und nun stirbt sie dem armen Menschen weg und läßt ihn mit den Krabben allein. Scheußlich! – Und sie war so ein liebes Weib. Ich mochte sie sehr gern, und nun fallen mir allerlei kleine Geschichtchen ein, die mit ihr in Verbindung stehn: als Johannes das Ehepaar Prévôt zu Rebhühnern einlud, und die beiden in Festtoilette in unsre kleine Türkenstrassen-Bude einrückten. Wir hatten an nichts mehr gedacht. Johannes lag im Bett. Ich saß auf einem Stuhl daneben, und wir aßen Frikadellen. – Ich sehe noch, wie Anita damals lachte. Sie konnte sehr herzlich lachen. – Und dann, im vorigen Jahre, jener Simplizissimus-Abend, wo alle angesäuselt und erotisch animiert waren. Ich saß mit dem Arm um Anitas Taille und gab ihr Küsse, und der Ehemann – damals schon Michel – platzte beinahe vor Eifersucht. – Jetzt ist sie tot. Kaum zu fassen. Ich habe an Michel ein paar Worte geschrieben, denen er anmerken wird, daß sie von Herzen kommen.
Gestern nachmittag nach dem kurzen Besuch bei E. G., die sehr zärtlich war, las ich bei Steinebach die Kain-Korrekturen. Nachher saß ich im Café mit Frau Marie Jung, und der verwachsenen, aber sehr reizvollen Frau Hoch. Ich bin in die Jung, trotz ihrer Schwangerschaft, einigermaßen verliebt, was ich ihr auch gestand. Ich fragte sie, ob sie ihren Mann prinzipiell nicht betrüge. Sie erklärte, darin keinerlei Prinzipien zu haben. Als ich ihr dann sagte: „Legen Sie nur erst Ihr Kind ab, nachher fange ich sofort mit Ihnen an“, lachte sie, und sagte weder ja noch nein. Übrigens scheint in ihr die Schwangerschaft einen Zustand absoluter Wurschtigkeit hervorzurufen. Sie sitzt manchmal ganz apathisch da, plötzlich klagt sie über große Schmerzen und spricht Befürchtungen für den Verlauf der Entbindung aus. Dann macht sie wieder märchenhafte Dummheiten. Das Ehepaar hat garkein Geld (ich habe aus meinem Dalles schon mit 5 Mk ausgeholfen). Neulich waren aber etwa 10 Mk da, die sie in Verwahrung hatte. Sie ging fort und kaufte ein silbernes Portemonnaie und noch sonst soviel Kleinigkeiten, die gar keinen Zweck haben, daß sie in den neuen Geldbehälter nichts mehr hineinzustecken hatte. Der Jüngling, der ihr Ehemann ist, scheint Alkoholiker zu sein. Er sagte nur: „Du bist ja verrückt“, als sie mit den Klamotten anrückte. Ein komisches Paar.
Abends war dann der Pfarrer Vogel wieder da. Dr. Ludwig erschien im Caféhaus und lud ihn, mich und Morax zum Abendbrot ein. Dieser Dr. Ludwig mit dem Ziegengesicht, dem Moralknödel und der öligen Menschenliebe geht mir auf alle Nerven. Ich drückte mich mit Morax bald und ging kegeln. Nachher im Bunten Vogel stieß dann mein Anarchismus mit dem Patriotismus des Herrn v. Maaßen zusammen. Wilm und Schwaiger sekundierten ihm, B. v. Jacobi in zurückhaltendem Maße mir. Lahmeyer saß lächelnd dabei. Nachher ging ich mit Maßen[Maaßen] friedlich zusammen fort.
Heut las ich die Kain-Revision, spielte im Stephanie mit einem Russen Schach, begleitete das Puma ein Stück Weges, erledigte einige dringliche Korrespondenzen und will jetzt durch Sturm und Dreck der Torggelstube zuwandern, wo ich hoffe, mit W. v. Scholz über Maßnahmen in der Hoftheater-Affaire verhandeln zu können.
München, Freitag, d. 12. April 1912.
Der Abend verlief ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und zwar viel angenehmer. Als ich mit dem Einschreiben in dies Heft eben fertig war, kam das Zimmermädchen mit einem Gruß von Frieda Gutwillig und der Anfrage, ob sie mich besuchen dürfe. Sie kam, eben von der Reise zurück, frisch und lustig und ich küßte sie ganz gehörig ab. Ich werde das liebe Mädel wohl bald hinlänglich verliebt haben, und dann – fahr wohl, Jungfernschaft, sofern du noch vorhanden bist. – Ich ging dann zunächst ins Café, wo Emmy mich bestürmte, ich solle sie in den Simpl. begleiten. Sie wollte dort Billets für heut abend kaufen. Morax hat mich gebeten, das Lokal zu schneiden, und obgleich ich seinen ganz persönlichen Konflikt mit dem Wirt keineswegs im Prinzip als Grund zu einem Solidaritätsboykott anerkennen kann, tue ich ihm den Gefallen. So gerieten er und Emmy aneinander, und die bohrende Art von Morax machte mich sehr nervös. Dann hatte ich noch mit Emmy eine Auseinandersetzung über Hardy, der wieder in München herumsteigt und mich ostentativ schneidet, da dann aber Else Kündinger kam, wurde die Stimmung bald friedlicher, und ich ging mit Else und Alva, die noch ins Luitpold wollten, fort, um mich der Torggelstube zuzuwenden. Ecke Odeonsplatz und Briennerstrasse traf ich, die ich in der Torggelstube suchen wollte: Steinrück, v. Scholz und Dr. Goldschmidt. Wir tranken viel guten Wein in der Odeonbar, wohin die Herren mich einluden und blieben unter den unterhaltsamsten Gesprächen bis ½ 3 Uhr dort beieinander. Goldschmidt zahlte. Es war ein netter Abend.
Heute kam ein ausführlicher Brief von Landauer, dem ich zum 7. April, seinem Geburtstage gratuliert hatte. Ich werde den Brief bestimmter Gründe wegen vernichten. Ein Dresdner Kain-Abonnent will meinen Rat. Er hat in einem Hausflur einer Dame unter die Röcke gefaßt und ein Schutzmann hat sich da als Voyeur betätigt. Ich werde dem Manne raten, das Maul zu halten und die Dame nicht auch noch vor andern Staatsgrößen bloszustellen.
Es ist wieder ganz winterlich. Eiskalter Sturm. Dabei will ich jetzt zum Schwabinger Friedhof zur Beerdigung der armen Anita Michel.
München, Sonnabend, d. 13. April 1912.
Ich habe noch nicht an vielen Beerdigungen teilgenommen, und empfinde vor der ganzen Kirchhofsatmosphäre ein gewisses Grauen. Nur ein Kirchhof, in dem ringsum kein Mensch zu sehn ist beruhigt mich und ist mir ein lieber Aufenthalt. Wie gern war ich damals in Berlin auf dem alten Friedhof in der Invalidenstrasse, wo man ganz allein sein, unter wundervollen alten Bäumen spazieren gehn und weltentrückt denken konnte. Bei einer Begräbnisfeierlichkeit aber, wo man dadurch, daß Särge noch über der Erde stehn, überlaut an Tod und Trauer gemahnt wird, glaube ich immer, Leichengeruch zu spüren, und es ist mir übel zu Mute. Zum Glück verspätete ich mich gestern und kam auf den Friedhof hinaus, als schon alles vorbei war. Michel war garnicht dabei gewesen. Er soll so erschüttert gewesen sein, daß man ihn gleich heimgebracht hatte. An seiner Stelle machte Anitas erster Mann, Prévôt, die Honneurs. Es war eine scheußliche gedrückte Stimmung. Ich lehnte es ab, mich den Herren, die noch im Auto zu Michel fuhren, anzuschließen. Lieber besuche ich den armen Menschen in diesen Tagen noch, wenn er schon ruhiger ist und zugänglicher. Prévôt, der als Correspondent der „M. N. N.“ nach Paris geht, erzählte mir, daß sich Michel ihm anschließen und schon in ganz kurzer Zeit ebenfalls nach Paris übersiedeln werde. Die Kinder werden unter Freunde verteilt.
Im Stephanie saß die junge schwangere Frau, und – ich weiß nicht, wie es kam – plötzlich war sie dabei, mir ihr Herz auszuschütten. Sie klagte sehr über ihren Mann, der alles Geld versaufe und sich überhaupt nicht um sie kümmere. Sie wolle, wenn sie nur das Geld auftreibe, nach Hause, nach Breslau, und sich dann von Jung trennen. Große Tränen standen in ihren Augen, ich hatte das arme Weib wirklich gern, und ich glaube sehr – zumal nach dem Gespräch, das wir heute im Café führten, daß die Freundschaft, die sich da anknüpft, für uns beide ernst werden kann.
Abends war dann die von Morax arrangierte Cabaretunterhaltung, „der grüne Teufel“, in der Schillerstrasse. Es war überraschend hübsch. Viele Leute, meistens Bekannte, die mit Thee bewirtet wurden. Morax trug vor, Emmy, dann auch Hardekopf, zuerst eine eigne Skizze, sehr fein, prononziert, stark im Ausdruck und ausgezeichnet mit Leidenschaft und Kraft gesprochen – es ist erstaunlich, wie dieser Mensch sich ganz langsam und ganz sicher zum echten Künstler entwickelt. Dann las er aus dem „Sturm“ ein Manifest von Marinetti vor, der den literarischen „Futurismus“ propagiert. Ich war über das Zeug (das brillant stilisiert war) so ungehalten, daß ich das Wort zu einer Polemik erbat, und nun trug sich der merkwürdige Fall zu, daß das Cabaret zur Tribüne wurde. Ich wehrte mich dagegen, daß man das Grammophon höher werten sollte als den Gesang, den Kientopp höher als das Theater. Ich predigte Kultur und Kunst anstatt Zivilisation und Technik und schloß mit dem Wunsch, daß
München, Sonntag, d. 14. April 1912.
Den Schlußsatz mußte ich bis heute zurückstellen, weil Dr. Emma Gellért kam, mit der ich mich sogleich nackt ins Bett legte.
Ich schloß also in jener Rede mit dem Wunsche, daß die von den literarischen Futuristen glorifizierte Rapidität der Dinge zunächst mal über den literarischen Futurismus hinwegfegen möge. Ich hatte mächtigen Beifall, nur Emmy schrie: „Hier ist doch keine Versammlung!“, worauf ich replizierte: „Jede Versammlung ist ein Cabaret.“ – Nachher las ich noch Gedichte vor. Es war ein schöner Abend, und, was ich seit vielen Jahren nicht mitmachte, ein echter Cabaret-Abend, bei dem das leichte Chanson, das ernste Lied, die reine Kunst und die improvisierte Ansprache zum Recht kam. – Nachher hielt ich mich nicht lange in der Torggelstube auf, da dort wenig los war, sondern kehrte bald wieder im Stefanie ein, wo ich viele Cabaretisten versammelt fand. Hardy grüßt mich immer noch nicht. Es ist zu dumm, zu geschmacklos, wenn ich bedenke, daß wir in den Tiefen unsrer Herzen ja doch noch gute echte Freunde sind.
Gestern nachmittag hatte ich nun eine sehr ernste eindringliche Aussprache mit Frau Jung, von der ich merkwürdigerweise immer noch nicht sicher weiß, ob sie Marie heißt oder sonstwie, da ich die Gewohnheit habe, jede Frau willkürlich mit irgendeinem Vornamen anzusprechen, was dann zur Folge hat, daß mich die Weiber mit falschen Namensangaben frozzeln. – Sie beschwerte sich bitter über ihren Gatten, der in der Gesellschaft des übeln Fritz Klein und andrer haltloser Gesellen tagaus nachtein bummle und sich um sie überhaupt nicht kümmere. Sie gestand mir die Befürchtung, daß das Kind in ihrem Leibe absterbe, und daß sie jeden Augenblick das Eintreten der Wehen und das Akutwerden der Fehlgeburt erwarte. Ich gab ihr 3 Mk, damit sie für alle Fälle ein Auto bezahlen könne, und stellte mich ihr ganz und gar zur Verfügung, wenn sie plötzlich Hilfe brauche. Heut sah ich sie noch nicht, und weiß nicht, was aus der Geschichte geworden ist. Die enge Vertrautheit, in die ich mit der reizenden Person inzwischen gekommen bin, läßt mich mit einiger Zuversicht darauf schließen, daß sie gewillt ist, sobald sie physisch dazu im Stande ist, mich enger an sich zu fesseln.
Mit Küssen werde ich inzwischen täglich von Fritzel Gutwillig versorgt, deren intimere Gunst mir wohl auch nicht lange mehr versagt bleiben wird. Wenn sich nur die finanziellen Schwierigkeiten bald in gedeihlicher Weise lösen wollten! Da sehe ich der Entwicklung mit schweren Sorgen entgegen.
München, Montag, d. 15. April 1912.
Ich komme eben vom Langenschen Verlage, wo ich Korfiz Holm zu bewegen suchte, mein „Tagebuch aus dem Gefängnis“ zu erwerben. Ich ließ ihm die „Kain“-Hefte, in denen bisher Auszüge draus erschienen sind, dort und soll ihn in einigen Tagen wieder anrufen. Ferner telefonierte ich Jaffé an und erhielt den Bescheid, er werde wahrscheinlich heute abend von der Reise zurückkommen. Er war, soviel ich weiß, bei Friedel in Ascona, und ich werde vielleicht Näheres über ihr Ergehn hören. Auch hoffe ich, daß er mir Geld geben wird bis die Usselmannsche Aktion im Gange ist. Spätestens übermorgen bin ich mit meinen Schätzen am Rande. Aber ich habe immer noch gewisse Hoffnungen, über die Komet-Pleite ohne Katastrophen hinwegzukommen, wiewohl ich im Moment noch garnicht weiß, wie ich auch nur am 1. Mai hier die Rechnung bezahlen, geschweige denn Johannes ein Monatsgeld schicken soll. Heut kam ein Brief von ihm, aus Paris. Sehr lieb und freundschaftlich. Aber er beschwert sich über meine Schreibfaulheit, da ich doch seit Wochen seine Adresse nicht hatte. Er soll schon seine Antwort kriegen. – Wedekind ist wieder in München. Ich saß in der Torggelstube zuerst mit Weigert und Kalser, dann kam das Puma und Cronos. Ich holte sie an den Stammtisch. Lotte war reichlich beschwipst. Plötzlich erschien Wedekind, und sie fing an, literarisch zu posieren, was mir weniger gefiel als sonst, weil die verliebten Herrn Kalser und Kronos allzusehr darauf eingingen. Wedekind hatte offenbar auch wenig Geschmack daran und ging bald. – Ich beabsichtige, heute eine Menge Korrespondenz zu erledigen. Die Familienbriefe sind gottseidank erledigt.
München, Dienstag, d. 16. April 1912.
Der Geldmangel wird nachgerade peinlich fühlbar. Jaffé ist noch nicht von seiner Reise zurück, die Sache mit dem Verlage Langen ist mindestens sehr unsicher, ebenso die Mitarbeiterschaft beim „Simplizissimus“. Heut war ich auf der Redaktion, traf aber nur Olaf Gulbransson, mit dem ich mich zum Billardspiel verabredete. Morgen will ich wieder hin. Vielleicht hole ich wenigstens 20 Mk für das Gedicht „Ein kleines Abenteuer“ heraus, das seit 1½ Monaten dort lagert. Sonst bin ich morgen völlig pleite. Heut war ich nachmittags auch noch beim Dreimasken-Verlag, wo ich mir von Lodygowsky das Manuskript von Benatzkys Operette „Cherchez la femme“ geben ließ, aus der ich eventuell eine Posse mit Gesang machen soll. Nachher traf ich Meyrink, den ich fragte, wieviel ich verlangen solle. Er erzählte, ihm sei dieselbe Arbeit angetragen worden, da er aber 5000 Mk forderte, habe er den Auftrag nicht bekommen. Er riet mir, 3000 Mk oder 2000 Mk mit niedrigen Tantiemen zu verlangen. – Wie Lodygowski berichtete, bemüht sich der Verlag eifrig, die „Freivermählten“ irgendwo anzubringen. Robert habe sich noch nicht entschieden, er fürchte Zensurschwierigkeiten.
Gestern abend war Krokodil: Wilm, Jodocus Schmitz, Kutscher, Dülberg, Wedekind, Huch. Das Gespräch bewegte sich zuerst auf dem Gebiet der Anagramme, in denen Dülberg Erstaunliches leistet, obwohl er einen nachgrade mit der monomanischen Vorkäuung dieser Wortspiele sekiert. Nachher war merkwürdigerweise Herr Leonor Goldschmied Gegenstand der Unterhaltung. Die Polizei hat ihm die öffentliche Vorlesung seiner „Entweihung der Erde. Tragödie der Gewalt“ verboten. Es soll unerhörter Mist sein. Goldschmied selbst ist – darüber sind alle Meinungen einig – ein unerträglicher, aufdringlicher, widerlicher Kerl, dem es darauf ankommt, überall für sich persönliche Ehren einzuheimsen und der mit seinem aufdringlichen Anliegen alle Leute belästigt. Der hat sich nun an eine Reihe von Leuten, darunter an Wedekind, gewandt und sie aufgefordert, einen Protest gegen das Polizeiverbot zu unterschreiben. Kutscher und Dülberg vertraten das Prinzip, man dürfe sich unter garkeinen Bedingungen mit so einem Burschen solidarisch machen und müsse es rundweg abweisen, sich an der Aktion zu beteiligen. Dülberg machte dabei die Einschränkung, es komme auf das Ethos in dem Werk an, nicht auf seinen Wert. Er wolle die Arbeit erst lesen, komme er dabei zu der Überzeugung, daß es Goldschmied künstlerisch mit seiner Sache ernst ist, so unterschreibe er, sonst nicht. Wedekind und ich vertraten heftig den entgegengesetzten Standpunkt, man dürfe die Polizei unter garkeinen Umständen als ästhetische Instanz anerkennen, und, sei es noch so ekelhaft, mit einem solchen Gesellen zu tun haben zu müssen, der obendrein ja zweifellos Beziehungen zur Polizei hat oder doch hatte, so bleibe doch nichts andres übrig, als dagegen zu protestieren, daß die Polizei den Vortrag eines Werkes verbiete, über dessen Wert sie kein Urteil haben kann, und mit dem sie selbst ja doch Wedekinds Arbeiten auf eine Stufe stelle. Der Disput ging bis 2 Uhr nachts, dann wurde der Ratskeller geschlossen, die Torggelstube fanden wir auch nicht mehr offen, so ging jeder seiner Wege.
Heut nachmittag war ich, ehe ich zum Dreimasken-Verlag ging, bei Strauß, um über den Bahnhofsprozeß zu reden. Es wird, denke ich, sehr lustig werden, und hoffentlich nicht allzu kostspielig. Gillardonis traf ich heute im Café. Sie und Lorenzen haben ebenfalls Beschwerde gegen den Strafbefehl eingelegt. – Während ich mit Strauß sprach, erschien dort Dr. Gotthelf, begleitet von einer hübschen Dame, die mir beinahe um den Hals fiel: Sonja Palm, die Schönheit vom Künstlertheater. Ich soll sie heut abend im Torggelhause wiedersehn. Eine Porträtkarte von Jenny Vallière kam an. Sie wird nächsten Monat in München sein.
München, Mittwoch, d. 17. April 1912.
Die Leute stehen mit schwarzen Gläsern auf der Straße und glotzen zum Himmel. Es ist Sonnenfinsternis. Ich wußte von nichts, doch fiel mir, als ich vor 10 Minuten (es ist ½ 2 Uhr) aus dem Fenster sah, die eigentümliche Trübung des wolkenlosen Himmels auf. Jetzt ist alles schon vorbei.
Der Abend bot gestern nicht viel Besonderes mehr. Sonja kam nicht in die Torggelstube. Doch waren Peppi und Lottchen Wegener da, Peppi entzückend. Sie gingen mit Muhr, Eyssler und Gotthelf noch ins Odeon-Casino, ich später mit Steiner ins Orlando Billard spielen. Ich gab 60 Points vor und gewann. Dann forderte mich, 5 Minuten vor 3 Uhr, ein Baumeister zu einer 30er Partie heraus. Ich ließ die ersten Bälle aus, während dessen er mehrere Serien machte, sodaß ich auf 2 Pts stand, als er schon 14 hatte. Bei 26 hatte er 28, ließ aus und ich gewann, während Wirt und Kellner in höchster Nervosität zum Schluß drängten, da die Polizei schon vor der Tür stand.
Eben telefonierte ich Jaffé an, der vor 10 Minuten von der Reise gekommen war. Ich soll ihn um ½ 9 Uhr besuchen. Er war 8 Tage in Ascona. Hoffentlich rückt er mit Geld heraus.
München, Donnerstag, d. 18. April 1912.
Von Friedel ein Brief. Ich las ihn erst vor einer Stunde und bin nun ganz ergriffen und erschüttert. Wie lieb diese Frau ist und wie kalt gegen mich! Der Eindruck, den ich aus diesem Schreiben habe, ist der, daß sie die Situation, die ihr entsetzlich nahe geht, vollständig beherrscht und daß sie Frick unendlich liebt, und was das bei ihr heißt, habe ich auch erfahren. Das wird wieder lange dauern, bis ich diesen Brief verwunden habe, der alle Liebe und alles Leid wieder aufreißt.
Mit Frau Jung (sie heißt Margot) ist es ein großes Kreuz. Ich bin nun völlig ihr Beichtvater und soll helfen, da ich doch mir selbst nicht helfen kann. Das Kind in ihrem Leibe ist, wie sie meint tot und sie erwartet stündlich das Eintreten der Wehen. In eine Klinik wird sie nicht aufgenommen, da eine Anzahlung von mindestens 20 Mk schnell gefordert wird und nicht vorhanden ist. Die königliche Frauenklinik, die verpflichtet ist, jeder Frau gratis Geburtshilfe zu leisten, verweigert ihr die Aufnahme, solange die Wehen nicht da sind. Ich sprach gestern telefonisch mit einem Frauenarzt, Dr. Wiener in der Kaufingerstrasse, dessen Adresse mir Doktor Benedikt, Gotthelfs Freund gegeben hatte. Auch der wußte garkeinen Rat, und das arme Weib leidet. Dabei wird sie von Gläubigern bedrängt, alle ihre Sachen sind versetzt und jetzt hat man auch noch ihre Pfandscheine gerichtlich gepfändet. Bekäme ich jetzt von irgendwoher Geld, dort wäre der erste Platz, wo ich hülfe. Aber mein Vermögen zählt – vor allem grade auch infolge der verschiedenen kleinen Abstoßungen nach dieser Seite – blos noch 2 Mk 50 – und ich weiß noch garnicht, von wo Zufluß kommen soll.
Abends war ich dann bei Jaffé. Er berichtete mir von Paris. Er hat Johannes 150 Fr. zur Einrichtung einer Wohnung mit Iza gegeben. Cecha ist gekommen und hat es ihm abgelistet. In Ascona war er eine ganze Woche. Friedel leide sehr, doch sei sie außergewöhnlich klug und überlegt in allen ihren Schritten. Die Situation für Frick sei dadurch kompliziert worden, daß grade jetzt, unabhängig von der Scheidegger-Sache, Fricks Bruder, der fromm gewordene Heilsarmee-Soldat, ihn und sich wegen eines Überfalls auf einen Trambahnwagen denunziert habe. Es handelt sich da offenbar höchstens um eine Verhinderung Arbeitswilliger während eines Streiks. Wie meine Geldaffaire mit Jaffé steht, konnte noch garnicht geregelt werden. Ich soll zunächst die Adressen der sämtlichen Häuser beschaffen. Ich muß aber zunächst sehn, eines Berliner Adreßbuchs habhaft zu werden. Ich sehe den Dingen pessimistisch entgegen, wiewohl ich mir noch nicht vorstellen kann, daß ich etwa die Pension verlassen und wieder das Leben von ehemals mit allen Entbehrungen durchmachen sollte.
Der Dreimasken-Verlag bleibt vorläufig meine beste Hoffnung. Das Stück des Herren Benatzky habe ich bis jetzt bis zum Beginn des dritten Aktes gelesen. Ein wüstes Zeug. Natürlich werde ich mich trotzdem erbieten, was draus zu machen. Ich muß jetzt Geld haben. Es hilft alles nichts. Morgen besuche ich auch sicher den Simplizissimus.
Nach dem Besuch bei Jaffé ging ich kegeln und nahm dabei Etzel die 2 Mk ab, die er mir noch schuldete. Dann Simpl. (ich habe den Boykott jetzt aufgehoben). Außer mir gingen Halbe, v. Maaßen, Schwaiger und Reese hin. Eine neue junge Dame, namens Melitta, war da, gute Figur – starke Typusähnlichkeit mit Mary Irber, lange nicht so hübsch, aber charakteristischer. Ich poussierte sie und erhielt das Versprechen einer Nacht gegen die Lieferung eines Chansons. Soll sie haben. An die Verwertung meiner Dichtkunst zu Liebeszwecken sollte ich überhaupt mehr denken.
München, Freitag, d. 19. April 1912.
Heut vormittag war ich beim „Simplizissimus“ und erhielt für das Gedicht „Ein kleines Abenteuer“ 20 Mark. Das war sehr wichtig, denn mein Kapital betrug noch 40 Pfennige, außerdem blieb ich gestern abend der Luise in der Torggelstube 6 Mk für die Zeche schuldig. Auf der Redaktion traf ich Geheeb, Thoma, Gulbransson und Korfiz Holm. Wir sprachen über die Pleite des „Kometen“ und über Wedekind. Holm bat mich, morgen wegen des „Tagebuchs aus dem Gefängnis“ zu ihm auf den Verlag zu kommen. Hoffentlich lockere ich bei dieser Gelegenheit einen blauen Lappen. Ich bin sehr froh, daß das Gedicht erscheinen wird und mein Name also wieder in dem Blatt stehn wird, das eigentlich diesen Namen begründet hat. Heut nachmittag gehe ich zum Dreimasken-Verlag. Ob diese Aktion günstig ausgehn wird? Endlich muß ich auch mal wieder an den Essayband für den Karlsruher Dreililien-Verlag denken, der ja vertragsmäßig noch 250 Mk bringen soll.
Gestern war ich mit Frieda Gutwillig fürs Lustspielhaus verabredet. Ich hatte für die „Zarin“ von Lengyel eingereicht. Zu meiner Überraschung erhielt ich auf dem Bureau des Theaters den Bescheid, die Billete seien nicht genehmigt, da das Haus ausverkauft sei. Seltsam. Der Grund liegt natürlich darin, daß ich nach Herrn Dr. Roberts Meinung im "Kain" das Lustspielhaus und Frau Ida Roland nicht zärtlich genug gestreichelt habe. Nun, ich werde auch ohne den Besuch dieses Kunstausschanks leben können. – Ich ging mit der Kleinen ins Imperialtheater, wo wir uns die Kinoaufnahmen ansahen, von denen mich nur ein paar Eskimo-Studien interessierten. Vor uns saß Frau Douglas-Andreé, mit Addi – freudige Begrüßung. Dann Torggelstube, wo wir Abendbrot aßen (daher die hohen Kellnerin-Schulden). Anwesend waren Dr. Brecher, Charlé, der jetzt vom Dreimasken-Verlag fürs Künstlertheater engagiert ist, Meßthaler, Feuchtwanger, Weigert, Dr. Rosenthal. Am andern Tisch erschien das Puma mit Strich, der grade von Italien zurück ist. Um ½ 2 Uhr fuhr ich das Fritzel im Auto heim, wobei ich meinen Unterricht im Küssen eifrig fortsetzte. Sie kanns schon ganz gut, sträubt sich aber noch des Weiteren, da sie „brav“ bleiben will.
Eben erfuhr ich eine angenehme Unterbrechung. Der Geldbriefträger brachte eine Postanweisung aus Brake in Oldenburg: 5 Mk von Dr. Duken, dem ich das Geld geliehen hatte. Unangenehm ist, daß mir Herr Junghans, Dukens Testamentsvollstrecker die Summe schon ausgelegt hatte. Jetzt habe ich also die Schulden bei dem. Gestern – das vergaß ich hier zu vermerken – kam ein seltsamer Brief von Hardekopf. Er bittet mich, mich in alter Weise „lieber Mühsam“ anreden zu dürfen und teilt mir mit, daß er die „Kain“-Nachnahme habe zurückgehn lassen, nicht wegen der zwischen uns eingetretenen Entfremdung sondern, weil er zur Zeit kein Geld habe. Ich weiß noch nicht, ob ich ihm antworten werde.
München, Sonnabend, d. 20. April 1912.
Der Dalles beunruhigt mich nachgerade empfindlich. Von den 25 Mk, die ich gestern hatte, schenkte ich der lieben Margot Jung – ich nenne sie Mariechen – 5. Gegen 7 Mk mußte ich in der Torggelstube bezahlen. 7 Mk verlor ich spät nachts im Luitpold, wo Muhr und Gotthelf Écarté spielten und ich wettete, und, als ich dann nur noch eine knappe Mark besaß, pumpte mir Professor Dreßler weitere 10, von denen jetzt noch 9 da sind. Mit dem Verlage Langen ist es nichts. Ich sprach ausführlich mit Holm, der mir mitteilte, daß die Herren, die darüber zu bestimmen haben, gegen die Annahme des Gefängnisbuches sind, für Gedichte ist auch kein Interesse, und nun will ich mich mit dem Werk an den Verlag Mörike wenden und meine übrigen Hoffnungen auf den Dreimasken-Verlag konzentrieren. Dort war ich gestern und sprach mit Lodygowsky und Friedmann. Ich erklärte die Umarbeitung von „Cherchez la femme“ übernehmen zu wollen gegen ein Honorar von 3000 Mark, von denen 500 Mark Vorschuß sofort bei der Auftragserteilung zu zahlen seien. Ich soll Montag oder Dienstag Bescheid haben. Wenn daraus nichts wird, bin ich aufgeschmissen.
Meine Freundschaft mit Mariechen wird immer inniger. Auch sie verheimlicht mir nicht mehr, daß sie mich gern hat und gestern erzählte sie, wie beiläufig, doch aber so, daß ich ein Bedauern daraus schließen konnte, daß ihr jetziger Zustand ihr jeden geschlechtlichen Verkehr verbiete. Ich knüpfte daran an und erhielt unverblümt ihre Zustimmung, als ich sie fragte, ob sie, wenn sie die tote Frucht los ist, ihren Mann mit mir betrügen werde. Schmerzlich empfand ich es, als sie erzählte, bei ihrem ersten Kind habe sie noch eine Stunde vor Eintritt der Wehen mit ihrem Manne –. Wenn das Kind jetzt wirklich in ihrem Leibe abgestorben sein sollte, so möchte ich nur wünschen, daß die Geburt recht schnell vonstatten gehe. Auf nachher freue ich mich ehrlich. Abends sprach ich im Caféhause Uli, die reizend war. Nachher ging ich in die Torggelstube: Gotthelf mit Lottchen, Pepi, Muhr, Dr. Benedikt, Weigert, Albu. Ich saß neben Pepi und hatte sie lieb. Es ist merkwürdig, wie gerne ich das Mädchen habe. Ich versprach ihr, mit ihr, wenn ich meine Erbschaft habe, eine schöne Reise zu machen. (Dasselbe habe ich auch Mariechen Jung und, ich glaube, noch vielen Mädchen versprochen). Wärs nur erst endlich so weit! Gotthelf, Muhr, die beiden Mädels und ich gingen dann noch ins Luitpold, von wo aus ich Pepi im Auto heimbegleitete, was mir etliche sehr süße Küsse einbrachte. Pepi sagte spontan, indem sie meine Hand auf ihren Busen legte: „Es ist lieb von dir, daß du immer zu mir hältst“. Meine dringenden Bitten, zu mir schlafen zu kommen, lehnte sie ab. Aber ich gebe die Hoffnung auf das entzückende Geschöpf noch nicht auf.
Nachher kam ich ins Luitpold zurück und verlor all mein Geld. Jetzt schaue ich ins Café nach Mariechen.
München, Sonntag, d. 21. April 1912.
Den Verlag Mörike konnte ich telefonisch nicht erreichen. Morgen setze ich meine Versuche fort. Mariechen war sehr nett, hatte aber fortwährend Schmerzen. Ich schenkte ihr eine Mark und begleitete sie nachher heim. Unterwegs kaufte ich ihr Chokolade. Sie ist wie ein Kind. Ich wäre gern mit ihr ins Zimmer gegangen. Sie meinte aber: „Heiraten können wir uns ja jetzt doch nicht“. Zudem werde sie in der Pension sehr beobachtet. Ich muß also warten und konnte sie noch nicht einmal küssen. Aber wir duzen uns schon, wenigstens, wenn wir allein sind, und heut hab ich ein kleines Gedicht auf den Namen Margot gemacht, das ich ihr nachher überreichen will. Es ist sehr lustig und ich glaube, ich hab da seit langem mal wieder einen Vortragsschlager zustande gebracht.
In der Torggelstube war endlich mal wieder eine anständige Gesellschaft beieinander. Die Anwälte Rosenthal, Strauß, Goldschmidt, ferner Feuchtwanger, Futterer, Steinrück, Jacobi, nachher Wedekind und einige Statisten (Muhr, Keyserling etc). Sehr rege Unterhaltung. Zuerst wieder der Fall Leonor Goldschmied. Ich stellte Wedekind zur Rede, weil er – mit Thoma, Stolberg, Holm und andern – einen ganz unglaublichen, offenbar von der Wanze selbst verfaßten Aufruf unterschrieben hat. Ich behauptete, und außer Wedekind stimmte mir der ganze Tisch zu, Wedekind habe einen Protest gegen das Vorlesungsverbot unterschreiben dürfen, niemals aber eine Kundgebung für den Dichter Goldschmied. Wenn die Polizei zwischen ihnen beiden keinen Unterschied mache und Leonor Goldschmied auch nicht, so solle doch er – Wedekind – ihn machen. – Dann die Hoftheater-Krisis. Die Erörterung ging von meinem Kain-Artikel über den Fall aus, bei dem man sich fragte, ob er nicht für Speidel schädlich sein könne. Dr. Goldschmidt meinte, wenn ein Zentrumsmann im Landtage mit dem Argument komme, der Anarchist Mühsam sei für Speidel, so könne das sehr gefährlich für ihn werden. Ich glaube das nicht. Bricht ihm dieser Artikel den Hals, so rettet ihn doch nichts mehr. – Um ½ 3 Uhr trennten wir uns. Ich begleitete mit Goldschmidt und Keyserling Steinrück bis vor seine Wohnung, und nahm dann eine Einladung des jungen Grafen zu einer Tasse Mokka im Odeon-Casino an. Pepi und Lottchen begrüßten uns. Dann kam Lodigowsky an unseren Tisch und stellte uns seine Braut vor, die er mir, als sie mit Keyserling tanzte, als sehr reich pries. Er lud mich zur Hochzeit ein. Wichtiger war mir, was er geschäftliches aus dem Dreimasken-Verlag berichtete. Danach habe der Dreimasken-Verlag mit Georg Müller ein Übereinkommen getroffen, daß alle bei Müller erscheinenden Buchdramen vom Dreimasken-Verlag in Theatervertrieb genommen werden und umgekehrt alle Dramen des Dreimasken-Verlages bei Müller als Buch erscheinen müssen. Lodigowsky, der mich mit dem Anerbieten der Duzerei überfiel, wobei ich nicht entweichen konnte, garantierte mir, daß meine „Freivermählten“ binnen zwei Monaten gedruckt würden. Mich sollte es weiß Gott freuen. Morgen soll ich wegen „Cherchez la femme“ Bescheid und wohl auch Vorschuß kriegen und ferner wird mir der Verlag, wenn ich Lodigowskys Geschwafel glauben darf, ein Monatsgehalt von 200 Mk anbieten für Lektortätigkeit. Ich müßte dafür im Monat 20 Dramen lesen. Also neue Aussichten, neue Möglichkeiten. Nur ist mir der junge Mann nicht sonderlich vertrauenserweckend. Abwarten.
Gotthelf ist gestern nach Italien abgefahren. Nachmittags war ich bei ihm. Er schenkte mir eine ungeheure von Julius Muhr stammende Zigarre, die mindestens 3 Mk gekostet hat, (Ich rauchte sie abends ohne viel Genuß) und ein Schachspiel, das ich im Stefanie deponierte. – Von dem Kufsteiner Anwalt Dr. Strele kam heut ein Brief. Er machte die erfreuliche Mitteilung, daß der Staatsanwalt seinen Einspruch gegen den Freispruch Nohls zurückgezogen habe, der somit „in Rechtskraft erwachsen“ sei. Die Rechnung, die der Anwalt beilegte, beträgt 20 Kr. 65 h. Das ist nicht viel, wenn ich Geld übrig habe, werde ichs zahlen.
München, Montag, d. 22. April 1912.
Mein Barvermögen beträgt 50 Pfennige. Aber um ½ 4 Uhr soll ich Mörike besuchen und um 5 Uhr den Dreimasken-Verlag. Ich bin recht gespannt, wie die beiden Aktionen ausgehen werden. Wenn negativ, so weiß ich nicht weiter.
Gestern geschah nichts Belangvolles. Im Café Zotereien mit Grete Krüger, Toni Huber und Mucki Bergé. Nachher ernstere Gespräche mit Bloch, der Amerikaner ist, über Emma Goldmann und die anarchistische Bewegung in den Vereinigten Staaten. Schach mit Roda Roda, Prof. v. Stieler und Major v. Hoffmann. Abends Torggelstube. Roda Rodas und Paul Brann.
Eben war Frieda Gutwillig bei mir, die ich gründlich abküßte. Heut oder morgen hoffe ich, endlich auch von Mariechen den ersten Kuß zu kriegen – sofern sie nicht heute schon in die Klinik geht, um ihr totes Kind ans Licht zu bringen. Ich habe ein wenig Angst vor der Operation, und diese Angst beweist mir, daß ich die junge Frau doch nachgrade schon recht lieb habe. Ihr Mund hats mir angetan, der ganz bezaubernd schön ist.
München, Dienstag, d. 23. April 1912.
Bis jetzt ist mir noch garnichts gelungen. Mörike, der einen guten Eindruck auf mich machte, ein etwas verängstigter junger Bücherwurm, beanspruchte eine Woche Zeit zur Lektüre der Tagebuchexzerpte des „Kain“. Ich werde ihn jedenfalls schon am Donnerstag oder Freitag antelefonieren. Nachher ging ich, begleitet von Mariechen, zum Dreimasken-Verlag. Lodygowsky eröffnete mir zunächst, daß ich 3000 Mk für die Umarbeitung von „Cherchez la femme“ nicht bekommen werde, da man im Verlage der Meinung sei, es brauche blos der dritte Akt umgearbeitet zu werden. Er schlug vor, ich solle praenumerando 500 Mk dafür verlangen, außerdem 50% der Tantièmen. Damit müßte ich schließlich einverstanden sein. Als ich aber 50–100 Mk oder auch nur 20 sofort haben wollte, erhielt ich die Antwort, er, Lodigowsky sei ganz allein, habe kein Geld bei sich, die übrigen Herren seien verreist, kurzum: nichts sei möglich. Mariechen, der ich den Bescheid brachte, war sehr traurig. Ich küßte ihr auf dem Hausflur die Wange, dann tröstete ich sie, indem ich ihr versprach, wenigstens ihren größten Schmerz, daß sie in völlig defekten Stiefeln herumlief, abzustellen. Ich führte sie also zu dem Schuhgeschäft in der Fürstenstrasse, wo ich seinerzeit für Lotte und mich Schuhe kaufte, und ließ sie ein Paar aussuchen, zu dem sie dann auch noch Leisten, Putzzeug und Gummiabsätze kaufte. Ich habe dort jetzt über 20 Mk Schulden. Nachher pumpte ich im Café Wallner, den Geschäftsführer, um 10 Mk an, von denen ich Mariechen noch 5 schenkte. Sie war sehr glücklich darüber. Wenn jetzt all das erwartete Geld wegbleibt, dann wird’s mir ganz übel ergehn. – Eine kleine Episode aus dem Café: Ich nahm Mariechens Hand in meine, beugte mich zu ihr und sagte: „Mariechen, ich habe Dich sehr sehr gern“. Sie antwortete, indem sie mich mit ihren lichten braunen Augen ansah: „Ich dich auch. – Aber zeig es nicht so öffentlich.“ Später begleitete ich sie wieder zur Belgradstrasse hinunter. Sie erzählte mir allerlei von früher. Sie war Tänzerin, und will wieder ans Cabaret, sobald sie schlank ist. Auch erfuhr ich einige Namen von Männern, die früher ihre Freunde waren. Das arme Mädl hat vor der Entbindung fürchterliche Angst. Sie erzählte viel von der Geburt ihres ersten Kindes. Es ist ein unerhörter Skandal, daß keine Klinik sie ohne Anzahlung aufnimmt, ehe nicht die Wehen akut sind. Ich muß unbedingt sehn, ihr wenigstens die 20 Mk zu schaffen, die das Rote Kreuz von ihr zur Aufnahme verlangt. Und dann muß sie sofort in Behandlung.
Abends „Krokodil“: Kutscher, Huch, Dülberg, Happe, v. Jacobi, Halbe, Wedekind, Weisgerber. Weisgerber berichtete über eine höchst gefahrvolle Skitour, die er gemacht hat, bei der er schneeblind wurde und um ein Haar verunglückt wäre. Im übrigen wurde immer noch die „Titanic“-Katastrophe besprochen, von der die Menschen garnicht loskommen können. Ich werde meine Ansichten darüber im „Kain“ deponieren. – Um ½ 2 Uhr gingen noch Wedekind, v. Jacobi, Halbe und ich in die Torggelstube, wo das Thema erörtert wurde: Welchen Schaden erleiden die Theater durch das Kino? Jacobi hält den Schaden für unermeßlich. Wedekind und ich behaupteten, der Schaden betreffe das ernste Theater garnicht, sowenig wie die Malerei an der Photographie gelitten habe, da sie sich eben entgegengesetzt der Ähnlichkeitsportraitierung entwickelt habe, und Halbe hielt sich mit seinem Urteil ziemlich zwischen den beiden Ansichten. Dann kam das Gespräch auch auf Thomas Manns Eintritt in den Zensurbeirat, den wir gleichmäßig alle verurteilten. Ich werde auch diesen Fall – und den Fall Goldschmied im nächsten „Kain“-Heft vornehmen. Halbe brachte mich per Auto heim.
Von Wilhelm Michel kam heute eine Karte aus Paris: „Es ist alles noch schrecklich und traumhaft“. Mich rührt, daß er in meiner Rue des Martyrs wohnt.
München, Mittwoch, d. 24. April 1912.
Es ist wieder aus allem nichts geworden. Dieser Lodygowsky ist ein konfuser Schmuser. Als ich ihn anrief, erklärte er, er könne leider garnichts machen, ehe nicht die verreisten Herren zurück sind. Ich wurde hinlänglich grob am Telefon: Es sei ein Skandal, wenn ein großer reicher Verlag, der mit einem Autor in große Geschäftverbindungen treten will, dem noch nicht 20 Mk geben könne, um ihm aus einer augenblicklichen Verlegenheit zu helfen. Ich pumpte nachher Lorenzen um 2 Mk und Diro Meier um 5 Mk an. Dann ging ich mit Mariechen ins Café Luitpold, wo ich aus dem Adreßbuch für Berlin die Häuser der A. Cohnschen Erben mit ihren Grundbuchblättern exzerpierte. Morgen abend soll ich das Material zu Jaffé bringen. Ich bin gespannt, ob er daraufhin etwas für mich tun wird. – In der Torggelstube traf ich abends nur Feuchtwanger und den lärmenden Keyserling; am andern Tisch aber saßen Lotte, Fritz Strich, Cronos, Uli, Seewald und noch irgend ein Herr Löwenstein oder ähnlich. Denen schloß ich mich an, als sie ins Café Orlando gingen. Auf dem Heimweg wurde ich von Uli und Lotte sehr geuzt: ich müsse, wenn ich die Erbschaft gemacht habe, mit ihnen beiden zusammen eine Reise machen. Die Mädels waren sehr lustig und beide entzückend. – Ich spielte dann noch im Stephanie Schach, und schlief im Bett erst sehr spät ein, nachdem ich noch um ½ 5 ein Gedicht gemacht hatte („Nein, ich will nicht eher zu Grabe.“) Heut früh wurde ich dann gleich wieder mit Unannehmlichkeiten geweckt: Mörike winkt ab. Er verspricht sich von dem Gefängnistagebuch keinen nennenswerten Absatz und der Rechtsanwalt Dr. Geiss, den ich vor Jahren wegen Johannes’ Homosexualitäts-Verfolgungen bemühen mußte, und dem ich seitdem 50 Mk schulde, mahnt um diese Summe recht energisch, obgleich er mir seinerzeit selbst gesagt hat, er würde den Schuldschein nehmen, aber die Summe nie von mir verlangen. – Gegen Mittag – ich war aber noch nicht aufgestanden – kam Berndl zu mir. Er ist mir nicht sonderlich sympathisch. Ein trüber Schleicher. Jetzt will ich ins Caféhaus, Mariechen sehn. Sie war gestern in einer Klinik, um sich untersuchen zu lassen. Eine Hebamme horchte, wie sie mir erzählte, an ihrem Bauch und erklärte ihr: „Es lebt“. Irgendwelchen Rat gab man ihr garnicht. Hätt ich nur erst Geld, daß ich sie zu einem tüchtigen Gynäkologen schicken könnte.
München, Donnerstag, d. 25. April 1912.
Der Dalles wird immer unerträglicher und beängstigender: zugleich schwinden die Hoffnungen, seine Konsequenzen rechtzeitig abzustellen, täglich mehr. Was mache ich nur am 1. Mai? 175 Mark kommen an – sonst kein Pfennig. In der Pension zahle ich vielleicht 160 Mk. An Johannes 40 Mk. An Wallner 10. An das Schuhgeschäft 25. Marie in der Torggelstube bis jetzt 3, Cigarrenfrau bis jetzt 1 Mk, mit dem, was ich noch an Schulden, die bezahlt werden müssen, bis zum Monatswechsel aufnehmen werde, sehe ich bestimmt eine Summe von etwa 250 Mk anwachsen. Davon fehlen zunächst 75 und fehlt ferner alles, was ich den ganzen Mai hindurch nötig brauche. Das sind wüste Zustände. Vielleicht hilft der Dreimasken-Verlag ja immer noch, aber nach all meinen Erfahrungen will ich doch um des Himmels willen nicht zu fest damit rechnen. Noch weniger fest mit Jaffé. Jadassohn sprach ich gestern von Strauß aus am Telefon. Er erklärte, so beschäftigt zu sein, daß er vor 2 Tagen nicht zu sprechen sei. Also kann ich mich erst morgen wieder bei ihm melden. Ich kam dann auf den Plan, noch etwas mit dem Gefängnistagebuch zu versuchen und ging zum Buchhändler Goltz. Der war sehr freundlich, versicherte mir aber, daß er sich auf Buchverlag garnicht mehr einlasse. Über den „Kain“ sprach er sich sehr günstig aus und meinte, das Blatt sei mit etwas Geldopfer sehr gut zu lanzieren. Da will ich Steinebach nicht dreinreden. – Ich denke jetzt noch das Tagebuch bei Callwey anzubringen zu suchen. Es wäre doch wirklich unerhört, wenn ich meine Arbeit wieder nirgends loswerden könnte, wo jeder Stümper für seinen Scheißkram gute Verleger findet. Alles nur, weil man eigne Ansichten über die Einrichtungen der Erde hat. Wieviel weiter wäre ich schon, hätte ich für meine Verse für alle meine Arbeiten sichere Absatzgebiete. Seit ich den „Kain“ habe, schreibe ich wenigstens meine Ansichten über die aktuellen Ereignisse nieder. Als ich „Jugend“, „Simplizissimus“ hatte, war ich lyrisch sehr produktiv. Selbst in der „Komet“-Zeit machte ich doch aktuell-satirische Gedichte. Jetzt liegt dieses Talent, mit dem ich doch wohl vornean vor den übrigen Satirikern stehe, völlig brach. Man will von mir nichts aufnehmen, nicht weil ich nichts könnte, sondern weil ich der unbequeme Erich Mühsam bin. Es ist schändlich. Ich arbeite nun ziemlich garnichts, weil ich mich vor dem Hausieren fürchte, das nachher kommt. Aus dieser Faulheit entspringt dann der Dalles, der sich durch Schulden, Erschlaffung, Unlust zu allem immer wieder selbst potenziert und in diesem Circulus viciosus wird schließlich Talent, Persönlichkeit, Gesundheit und selbst die sexuelle Potenz zermalmt, da solche Zeiten, da man nicht galant sein kann, weil das Geld kostet, bei mir stets zu maßlos übertriebener Masturbation führen.
München, Freitag, d. 26. April 1912.
Frieda Gutwillig unterbrach gestern meine Elegie und versetzte mich durch reichliche Zärtlichkeiten in freundlichere Stimmung. Leider kann eine bessere Stimmung jetzt garnicht vorhalten, da mir alles, aber auch alles in die Brüche geht. Ich sehe eine Zeit böser Schrecknisse und greuelhafter Unzuträglichkeiten vor mir – wenn nicht sehr schnell auf irgendwelchem Wege eine Wendung zum Guten eintritt. Heut soll ich mit Jadassohn sprechen. Aber ich bin im größten Zweifel, ob dabei etwas Wesentliches herausspringt. Gumppenberg, dem ich für „Licht und Schatten“ ein paar erlesene Gedichte geschickt hatte, sendet sie alle als „nicht recht geeignet“ zurück. Das feige Rindvieh! Neulich habe ich mit Steinrück und v. Scholz eine Stunde über ein Gedicht in „Licht und Schatten“ gelacht, dessen unfreiwillige Komik (ich glaube, der Dreck hieß „Erster Frühling“; der gänzlich unbekannte Autor ist mir nicht mehr im Gedächtnis) darin bestand, daß man fortgesetzt an Furze erinnert wurde. Die Winde von Duft und Klang spielten eine große Rolle. Das war also „recht geeignet“ für das Mistblatt. Ich glaube natürlich nicht, daß Gumppenberg meine Gedichte („Sehr traurig und bedrückt ist mein Gemüt“, „Stört mir den Schlaf nicht, ich will noch träumen“, und das Sonett: „Ich weiß dich leiden, sitz die wachen Nächte“) wirklich für künstlerisch unbedeutend hält. Er hat einfach Angst vor dem Hautgout meines Namens, das Schwein! – Auch der Besuch, den ich gestern bei Jaffé machte, war nur von sehr mäßigem Erfolg gekrönt. Er hatte natürlich garkeine Zeit, sein Tippfräulein war gerade da, und so setzte er mir in Kürze auseinander, daß er wahrscheinlich die ganze Pumpgeschichte nicht machen werde. Verpflichtungen etc. Aber er will noch ausführlich darüber mit mir sprechen – natürlich wird nichts draus werden. Es ist ja auch bei Jaffé nichts Neues: erst die großen Töne, und nachher keine Taten. Jedenfalls pumpte ich ihm 20 Mk ab. Vormittags hatte ich dem Stefanie-Julius schon 5 Mk abgenommen.
Meine Freundschaft mit Mariechen wächst sich inzwischen nachgrade zu einem Drama aus. Ich bin ihr Freund, Vertrauter, Ratgeber, Helfer. Ich muß für alles sorgen, an alles denken. Vorgestern kam sie aufgeregt ins Café. Der Ehemann habe 74 Mk mit der Post bekommen und sei damit über Nacht fortgeblieben, natürlich versaufe er alles. Sie war sehr unglücklich, ich mußte trösten. Gestern hatte sich der edle Gatte wieder eingefunden. Von dem Geld, das er mit einigen guten Freunden und Weibern verkneipt hatte, war nichts mehr da. Sie forderte mich dann auf, mit ihr spazieren zu gehn. Wir gingen bei Tietz in den Erfrischungsraum. Sie berichtete, Führmann wolle sie aus der Pension hinausschmeißen. Sie wisse nicht mehr ein noch aus. Das Ende vom Liede war natürlich, daß ich bei Führmann für die nächsten Tage bis zum 1ten garantieren mußte. Ich aß also gestern dort Abendbrot und sprach mit dem Mann. Der Scherz wird mich wohl an 30 Mk kosten, und ich habe keine blasse Ahnung, wo die herkommen werden. Aber ich habe die junge Frau von Tag zu Tag lieber, obgleich sie mir noch nicht einmal einen Kuß gegeben hat. Sie rechnet, scheint mir, auch stark auf mich als Nachfolger für ihren angetrauten Mann. Heiraten werde ich sie natürlich nicht, aber, wenn endlich finanzielle Hilfe kommt, will ich sie und ihr Kind, – wenn das zweite lebendig zur Welt kommt, auch das – gern zu mir nehmen und versorgen.
Auch andre Leute wollen meine Hilfe. Frau Jenny Vallière schreibt mir aus Dortmund einen Brief, den ich diskret behandeln soll. Sie ist vom 1. Mai an hier im Deutschen Theater, und will, daß ich für sie die Leute bearbeiten soll, die ihr Reklame machen können. Ich weiß mich zu berherrschen. – Ein Genosse aus Offenbach, Eisenreich – ich glaube, das ist ein Uhrmacher aus Siebenbürgen, den ich von Wien her kenne – hat noch seltsamere Anliegen. Er schickt mir für 8 Mark bayerische Postwertzeichen, Postkarten, zum Teil mit Rückantwortskarte, 3, 5 und 10 Pfennig-Marken, für die ich ihm postwendend bares Geld senden soll. Jetzt kann ich mit dem Zeug hausieren gehn. Vielleicht kaufts Roda Roda im Ganzen, oder Steinebach. Ich bin schon ein geplagter Mann, der nur sich selbst nicht helfen kann.
München, Sonnabend, d. 27. April 1912
Arge Zeiten. Zu aller persönlichen Bedrängtheit auch noch die Sorge um Mariechen. Sie ist sehr elend und schwach. Auch gestern mußte ich sie wieder aus dem Café fortbegleiten, und indem sie in meinem Arm hing und über Schmerzen klagte, sagte ich ihr leise Liebesworte. Wir saßen eine Weile auf einer Bank am Lenbachplatz und obwohl wir kaum sprachen und uns nicht ansahen, wußten wir, daß wir uns lieb haben. Nachher zogen wir, immer Arm in Arm, durchs ganze Warenhaus Oberpollinger, saßen dort schließlich im Erfrischungsraum, und nachdem Mariechen an den Hut- und Handtaschen-Verkaufsständen dreiviertel Stunden gesucht und nichts gefunden hatte, ging sie in ein Spezialgeschäft beim Karlstor und kaufte für 4,50 Mk nach halbstündigem Aussuchen ein Besuchstäschchen, das sie heute wieder umtauschen will. Nachher brachte ich sie in der Trambahn zum Stefanie, und da dort schon alles fort war, von der Türkenstrasse per Auto zu Führmann. Sie lehnte sich während der Fahrt fest an mich und als sie ausstieg, gab sie mir zum ersten Male die wundervollen weichen warmen Lippen. Im Geben und Empfangen dieses Kusses lag alle Verständigung und alles Versprechen für die Zukunft. Abends war ich in der Torggelstube, wo zuerst Lotte, Strich, Uli, Seewald und noch einiger Anhang den Stammtisch besetzten. Ich saß bei ihnen. Auch Weigert kam, der mich plötzlich darauf aufmerksam machte, daß eben Adolf Paul durch den anderen Raum gehe. Ich sah nach, – es stimmte, und jetzt setzten wir uns draußen an einen Tisch, an dem sich außer Paul, Weigert und mir allmählich noch Gumppenberg, Futterer, Wedekind mit einem Schwager, dem Mann der Sängerin Erica W. und Steinrück einfanden. Adolf Paul erzählte mir, er komme in Berlin öfters mit Landauer zusammen und zwar in der Neuen freien Volksbühne, die sich jetzt einem „Verein Versuchsbühne“ angegliedert habe. Ich schrieb mir die Adresse (noch immer Heinrich Neft) auf und habe heute schon veranlaßt, daß die „Freivermählten“ dorthin geschickt werden. Gumppenberg stellte ich wegen der Zurücksendung meiner Gedichte. Er behauptete, er habe sie aus taktischen Gründen – des Inhalts wegen – nicht nehmen können. Die Sache habe mit meiner Person nichts zu tun, und er bitte mich dringend, ihm so schnell wie möglich möglichst viele andre Gedichte einzusenden. Versuchen kann man es demnach also noch einmal. Es scheint wirklich keine Böswilligkeit dabei zu sein, sondern ausschließlich Dummheit, Verständnisarmut und Pedanterie – nette Eigenschaften für den Herausgeber der einzigen Zeitschrift für moderne Lyrik. Wir blieben noch lange beisammen. Zum Schluß gingen Steinrück, Paul, Futterer und ich noch ins Café Orlando. Futterer brachte mich schließlich im Auto heim.
Der Dreimasken-Verlag (Jadassohn) hatte mich wieder auf heute mittag um 12 Uhr vertröstet, und ich habe mit Mariechen verabredet, daß sie mich abholen soll. Sie kam kurz vor 12 Uhr, verabfolgte mir einen Kuß und wir fuhren los. Das arme Weib wartete auf der Straße, und ich mußte sie über eine halbe Stunde warten lassen. Lodigowsky hat lauter Schmuß geredet. Die Verhandlungen wegen des „Cherchez la femme“ müssen ganz neu beginnen. Nach eingehender Erörterung der Sache formulierte ich meine Forderung so: 25% der Tantièmen, davon 1200 Mark Vorschuß. Das wird jetzt Benatzky vorgeschlagen werden, und auf dieser Basis wird nun vielleicht – in einigen Wochen – der Vertrag zustandekommen. Ferner soll ich Lektor des Verlages werden, d.h. regelmäßig Stücke lesen und für jedes gelesene Stück, über das ich ein getipptes Gutachten einreichen muß 10 Mk kriegen. Um die 200 Mk, die der „Komet“ brachte, hereinzubekommen, muß ich also erst 20 Dramen lesen im Monat und darüber mein Urteil abgeben. Das sind erfreuliche Dinge –, obwohl ich mir ja sage, daß es immer noch gut ist, ich habe überhaupt wieder eine halbwegs sichere regelmäßige Einnahme. Als ich gleich 100 Mk Vorschuß wollte, wurde mir der auf 50 Mk heruntergehandelt, und auch den konnte man nicht gleich auszahlen. Ich soll ihn mir heut nachmittag um ½ 4 Uhr holen. Zugleich soll ich dann die ersten 5 Stücke für meine Lektortätigkeit ausgehändigt kriegen. Um 3 Uhr – in 20 Minuten – soll Mariechen mich auch zu diesem Wege abholen. Ihr muß ich gleich 30 Mk geben, damit sie im Falle plötzlicher Ereignisse sofort in die Klinik kann. Sie möchte am liebsten nach Breslau zu ihrer Mutter fahren, und zwar in meiner Gesellschaft. Daran ist garnicht zu denken, da das Geld dafür keinesfalls beschafft werden kann, wie die Dinge jetzt stehn. Mit Jaffé wird auch wohl nichts zu wollen sein, und die Hoffnung eines Eingreifens Gottes, die mich ja eigentlich seit 12 Jahren auf den Beinen hält, muß auch in dieser Lage wieder als einzige Zuflucht gelten. Nur läßt Gott sich allmählich verdammt lange Zeit mit seiner Hilfe.
München, Sonntag, d. 28. April 1912.
Mariechen ist im Spital. Schon gestern nachmittag – nachdem ich mir vom Dreimasken-Verlag 50 Mk und die Manuskripte hatte geben lassen und ihr 30 Mk übergeben hatte – war ich mit ihr dort. Ich hörte, wie sie fragte, ob „mein Mann“ während der Untersuchung warten dürfe und so saß ich eine halbe Stunde zwischen unterschiedlichen leidenden Frauen in der Wartestube der kgl. Frauenklinik in der Pestalozzistrasse. Der Arzt sagte ihr, die Sache könne jeden Tag eintreten, es könne auch noch 14 Tage dauern, aber schon auf dem Wege von der Klinik spürte sie sehr arg die Wehen, und ich mußte sie in der Sonnenstrasse in ein Café bringen. Dann tauschten wir das vorgestern gekaufte Täschchen gegen eines um, für das ich 6 Mk draufzahlen mußte. Endlich hatte ich sie im Stefanie. Während ich die 5 Dramenmanuskripte heimbrachte, war sie fort. Ich ging dann zum Gambrinus und sprach in der Freien Vereinigung über „Das Elend der Politik“, das gleiche Thema, das ich vor einem Jahre schon einmal in der Gruppe Tat behandelt habe. Ich erhielt 5 Mk und ging zur Torggelstube. Am Stammtisch saß Futterer mit einer Dame, die mir als Baronin Brockdorf vorgestellt wurde. Es war die Schriftstellerin Frigga v. Brockdorf, die geschiedene Frau meines Lübecker Nachbars und Kongymnasiasten Rolf von Brockdorf, den ich im Verdacht habe, der Vater von Rolf Reventlow zu sein. Ich unterhielt mich sehr gut mit der Dame über viele gemeinsame Bekannte, die Gräfin, das Puma, Grumbach (sie ist Sozialdemokratin), Schickele, Peter Altenberg u. s. w. An einem andern Tisch saß Wedekind mit Georg Hirschfeld und seiner neuen Frau, der Verleger Georg Müller, Adolf Paul und Steinrück. Am dritten Halbe mit Brann und Weigert. Zu denen setzte ich mich später und Halbe fuhr mich schließlich heim.
Heut aß ich in der Torggelstube Mittag – allein. Dann traf ich im Hofgarten Uli, Lotte und deren ganze Gesellschaft. Der kleine Hörschelmann erzählte, er sei in Heidelberg mit Ihringer vom Karlsruher Dreililien-Verlag beisammen gewesen, der mir sagen lasse, er warte sehr auf das Buch. Bravo! Soll er noch in diesen Wochen kriegen. – Da ich dann im Café Mariechen nicht antraf, fuhr ich zur Pension Führmann hinunter. Führmann berichtete, sie sei heute früh, da die Schmerzen sehr groß waren, in die Klinik gefahren. Nachher sprach ich im Café den Gatten, der mir Grüße von ihr bestellte. Er habe den Arzt gesprochen, der meinte, man werde wohl einen Eingriff machen müssen. Ich bin sehr aufgeregt. Gestern sprach ich mit ihr über die Möglichkeit, mich mit ihr zu vereinen. Sie schien recht geneigt dazu. Ich denke daran, vielleicht im Sommer mit ihr in die Umgebung von München zu ziehen, vielleicht nach Tutzing, wo wir guten Verkehr hätten – Steinrücks wollen wieder hin, vielleicht auch Waldaus – oder nach Bad Tölz, wo Thomas Mann seine Villa hat, und wo Frl. Seidenbeck eine Pension eröffnen will. Vielleicht auch zu Kati Kobus nach Wolfratshausen. Wenn nur jetzt alles gut abläuft! Morgen will ich mit dem Ehemann zusammen hin, und sie besuchen.
Der „Kain“ ist noch nicht begonnen. Von den Manuskripten habe ich erst eins gelesen – drei öde Einakter: Schmarren. Die Zeit drängt.
München, Dienstag, d. 30. April 1912.
Über meinem Haupt hat sich ein Klavier aufgetan. Wenn ich mit dem Mann, der das täglich stundenlang verarbeitet, nicht schleunigst zu einer Zeitverständigung komme, so wird meines Bleibens hier wohl nicht länger sein können. Ich habe eben meinen Besuch ankündigen lassen. –
Am Sonntag abend sollte ich ins Residenztheater. Steinrück hatte mir versprochen, für Tim Kleins „Veit Stoß“ einzureichen. Er hatte es natürlich verbummelt. So war ich diesen ganzen Monat nicht im Theater. In der Torggelstube war ich dann abends mit Peppi und Lottchen beisammen, die mit Pepis Offiziellem, Herrn Baron von Stettner, einem faden, müden Zavalier saßen, der einen Smoking und ein Monokel trägt. Später kamen Albus und Eyssler. – Gestern erschien mittags bei mir das Puma und war sehr nett. Mit den Piaceres zwischen uns scheint es wohl aus zu sein. (Eben war ich oben und habe mit dem Klavierspieler eine Vereinbarung getroffen). Das Puma war sehr nett, erzählte von ihren erotischen Abenteuern und ich ging mit ihr fort: sie in den Hofgarten, ich ins Stefanie, wo ich Herrn Jung erwartete, um mit ihm Mariechen zu besuchen. In der Sonnenstrassen-Klinik wurde uns gesagt, sie sei in der Frühe operiert worden. Es gehe ihr ganz gut, doch müsse die Placenta noch beseitigt werden. Besuch könne sie erst heute empfangen (Ich will gleich wieder zum Rendez-vous mit Jung ins Café). – Der Gedanke an die blonde Frau regt mich fortwährend auf. Ob die endlich mein Schicksal sein wird? Abends nahm mich Roda Roda vom Schachspiel aus mit zu sich zum Abendbrot. Liebe Menschen. Harro, jetzt 11 Jahre alt, ist ein Prachtbengel, stark, schön, lebhaft, geweckt – aber faul. Rodas sind in Sorgen, in welche Schule sie ihn plazieren sollen. Er zeigte mir ein Luftschiffmodell, das er, der Kleine, nach einer Zeichnung in einem illustrierten Blatt gebaut hat. Fabelhaft. – Nachher ich mit Roda in den Ratskeller zum Krokodil. Ein großer Kreis, darunter die scheußliche Frau Maria Holma, deren dämliches intellektuelles Gequassel allen furchtbar auf die Nerven ging. Sie und ein blondes belangloses Ehepaar war mit Josef Schanderl gekommen. Ich zog die Holma dermaßen auf, daß dadurch die Stimmung einigermaßen gerettet wurde, sagte ihr unglaubliche Bosheiten. Als mein Witz erlahmte, gingen, von dem Gequatsch und der Dekolletage des dicken geilen schwitzenden Blaustrumpfes angeekelt, die Herren Wilm, Weisgerber, Schmitz und Dr. Happe fort. Wir andern blieben, und zuletzt, als Kutscher, Roda, v. Jacobi und ich noch allein waren, wurde es sehr nett. Wir gingen schließlich ins Orlando und Roda fuhr mich per Auto heim.
Von den 5 Manuskripten habe ich bis jetzt 3 gelesen, eines nur kritisiert, und bis morgen sollen alle 5 Kritiken abgeliefert werden. Dabei habe ich vom neuen „Kain“ immer noch keinen Strich geschrieben. Ich weiß noch nicht mal recht, was hineinkommt – und der Dalles! Morgen ist der Erste. Mir graut. Mir graut.
München, Mittwoch, d. 1. Mai 1912
Ich bin eine Treppe höher einquartiert und habe – zum ersten Male in meinem Leben – zwei Zimmer, sehr hübsch, auf die Akademiestrasse hinaus, nur ist das leider direkt nach Norden gelegen, sodaß ich fürchte, ich werde nicht viel oder garkeine Sonne kriegen. Nun: jedenfalls eine Veränderung, und schon die tut wohl, solange ich noch als einsamer Junggeselle herumirren muß. Wie lange noch? Ob aus meiner längeren oder kürzeren Verbindung mit Mariechen etwas werden wird, steht ganz dahin. Gestern war ich – mit dem Ehemann – bei ihr in der Klinik. 9 Frauen lagen da in einem Saal, fast alle neben ihrem Bett ein Kinderbettchen mit einem quarrenden Etwas drin, lauter eben Entbundene. Nur Mariechen und ihre Bettnachbarin ohne Baby. Das der Nachbarin war tot auf die Welt gekommen. Mariechen, die angegriffen und gealtert, aber sehr schön aussah, hatte ein Mädchen geboren, das nur 1000 gramm wog und nur zwei Stunden schrie: Dann war es tot. Ich brachte ihr ein wenig Lektüre. Das Gespräch ging fast nur um materielle Dinge. Der armen Frau fehlt fast alles, nicht einmal ein zweites Hemd hatte sie und kein Taschentuch. Ich schickte ihr später durch den Mann mein einziges reines Leinennachthemd (zwei besitze ich im ganzen nur) und 2 Taschentücher. Morgen gehe ich wieder zu ihr. Ich beobachtete sehr das Verhalten der Gatten zueinander und kann mich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, daß sie ihn immer noch sehr gern hat. Sie zog ihn mehrmals beim Nacken zu sich nieder. Von mir ließ sie sich willig die Hand streicheln und küssen, gab mir aber nicht einen einzigen wirklich zärtlichen Blick. Ob ich da schon wieder an die Unrechte gekommen bin? Es ist schon schrecklich – dies ewige Warten auf ein bischen Liebesglück.
Abends war Frl. Gutwillig bei mir, die ich tüchtig abküßte. Abends ging ich in die Torggelstube, wo ich zuerst mit Brecher und Feuchtwanger am Stammtisch, dann mit Peppi, Lotte Wegener und noch einer Gärtnertheater-Choristin, Blanca Michalowitsch extra saß. Es war sehr lustig in unsrer Ecke. Ich mußte Sekt bestellen und erhöhte damit meine Schulden wieder sehr erheblich. Nachher auf der Straße machte mir die häßliche ältliche Blanca eine richtige Liebeserklärung und bat, mich küssen zu dürfen. Natürlich schlug ichs ihr nicht ab und wurde dadurch belohnt, daß dann auch Peppi mich mitten auf der Straße spontan auf den Mund küßte. Zum Abschied – Blanca hatten wir vorher schon abgesetzt – hielten mir Lottchen und Peppi noch einmal die Mäuler hin. Ich kam in guter Laune heim.
Und heute ist nun der gefürchtete 1. Mai. Es ergiebt sich, nachdem ich heut vom Dreimasken-Verlag die fälligen 50 Mk erhielt, diese Rechnung. Ich erhalte
von Waidmannslust |
180 Mk |
(5 Mk nachträgliches Geburtstagsgeschenk[)], |
habe noch |
50 Mk |
und werde mir von der Staatsbibliothek die dort |
seinerzeit deponierten |
20 Mk |
wieder abheben. |
|
250 Mk |
|
Ich muß zahlen: Hier in der Pension ungefähr |
150 Mk.- |
An Johannes schicken |
42 Mk.- |
16 Mk.- |
|
Marie (Torggelstube) |
10 Mk.- |
Mariechens Schuhe |
25 Mk.- |
Neuer Verein |
5 Mk.- |
6 Mk.- |
|
Das macht, wenn ich nichts Wichtiges noch vergessen habe |
254 Mk.- |
Bleibt ein Barbestand von -4 Mk, woraus erhellt, daß ich meine Schulden nur mit Maßen zahlen werde. Aber es sieht nicht ganz so schlimm aus, wie ich gefürchtet hatte. Ich hoffe blos, daß sich Führmann vorläufig nicht meldet, und daß für Mariechen nicht gleich wieder größere Ausgaben notwendig werden. Heute erzählte mir der Gatte, daß Führmann ihn schon aus der Pension ausgesperrt habe. Ich werde Mariechen, sobald ich sie allein sprechen kann, jedenfalls vorschlagen, vorläufig auf meine Kosten in meiner Pension zu wohnen. Wie ich es mit der Bezahlung mache, weiß ich nicht. Wie mir Wilm vorgestern im Krokodil erzählte, habe er einen Berliner Verleger kennen gelernt, der sich sehr interessiert über mich ausgesprochen habe, sehr reich sei und gern etwas von mir verlegen wolle. Ich gab Wilm meine Adresse mit der Bitte, den Mann zu veranlassen, an mich zu schreiben. Vielleicht ist da ein größerer Vorschuß zu kriegen. Jedenfalls bekomme ich ja auch, wenn ich nur fleißig bin, bald Geld vom Dreililien-Verlag, und die Lektortätigkeit im Dreimasken-Verlag müßte ich eben auch forcieren. Dann wirds hoffentlich gehen. – Jaffé hat natürlich endgültig abgewinkt. Es ist schon eine Schweinerei, von dem reichen Manne, erst dem Armen Hoffnung zu machen, und sichs nachher anders zu überlegen. Hätte ich nur erst meine Erbschaft! Ich werde diesen Burschen schon was zeigen!
München, Freitag, d. 3. Mai 1912.
Von Waidmannslust kamen 183 Mk, und die Rechnung betrug hier auf den Knopf 150.- Ich konnte also hier alles zahlen, die Zigarrenfrau, Julius im Stefanie, Johannes und den Neuen Verein zufriedenstellen. Nun habe ich noch etwa 12 Mk und kann mir die 20 Mk von der Staatsbibliothek immer noch holen. Zwar habe ich Wallner, Marie und den Schuster noch nicht bezahlt, brauchte auch unbedingt noch einen neuen Anzug und etwas Wäsche: aber ich bin doch schon ein wenig mutiger und hoffe auf Zufälle. – Mariechen ist allerdings kostspielig. Gestern knöpfte sie mir 5 Mk ab, und heute 2, was mit den Blumen, dem Parfum und der Chokolade, die ich ihr brachte, doch sehr fühlbar ist. Gestern sah sie entzückend aus, heute hatte sie Schmerzen, da jetzt die Milch kommt. Ich sprach heute, ehe der Mann kam, ausführlich mit ihr über die Zukunft. Sie versicherte mir, sie werde mit ihm keinen Sexualverkehr mehr eingehen, da sie fürchten müsse, daß er sich inzwischen mit zuviel zweifelhaften Weibern eingelassen habe und sie womöglich krank machen werde. Mit meinem Vorschlag, im Sommer nach Tutzing oder Starnberg oder Tölz mit mir zu ziehen, erklärte sie sich freudig einverstanden. Dabei gebe ich mich keiner Täuschung darüber hin, daß von Liebe zu mir noch nicht viel die Rede ist bei ihr. Die werde ich wohl erst erkämpfen müssen. Ihre Liebe gilt immer noch dem Ehemann, den sie aber für ideell verloren hält. Es lohnt ihr nicht mehr, sich für ihn zu opfern. Sobald wie möglich will sie nach Breslau zu ihrer Mutter und ihren Schwiegereltern ihr Kind wegnehmen. Ich habe ihr angeboten, das Kind mit zu übernehmen, wenn sie ganz mit mir zusammenleben will. Sie möchte mich aber damit nicht beschweren. Ich sehe der Entwicklung der Dinge sehr neugierig entgegen. Vielleicht finde ich bei dieser Frau nun doch endlich Ruhe und Sicherheit. Not tät’s mir.
Viel Besonderes hat sich in diesen Tagen nicht ereignet. Nur eine Begegnung war mir lieb: Ich traf auf der Amalienstrasse Martha Neves, Tilly Wedekinds reizende Schwester. Sie versprach mir, mich mal zu besuchen. Soll mich wundern, ob sie kommt.
Gestern spät nachts, als ich im Odeon-Café mit Steiner vom Billardsaal herunterkam, rief mich eine Dame an: Jenny Vallière. Sie sah entzückend aus, ist mir aber doch bei jedem liebenswürdigem Wort zu sehr aufs Geschäft aus.
Eben war ich, begleitet von Herrn Franz Jung, von der Klinik aus in der Druckerei, wo ich den Leitartikel für Nr. 2 „Politisches Variété“ abgab. Jung begleitete mich noch bis vor die Haustür (zu Fuß) und ich erzählte ihm unterwegs die Begründungsgeschichte des „Vaterland“ mit Scheerbart, die zur Herausgabe der „Wüste“ führte. Ich muß diese Geschichten doch mal alle niederschreiben. Es wäre schade, wenn sie verloren gingen. Auch die Italienreisen mit Johannes verdienen festgehalten zu werden.
Von Johannes kam ein Brief aus Villepreux (Seine et Oise), Restaurant Ventejoux, sehr schön. Ich werde ihn mir seines prachtvollen Inhalts wegen sorgfältig aufheben müssen. Zum Schluß ein paar Bemerkungen über die Automobilattentäter in Paris und den Tod Bonnots. Dann dieser Satz: „Ich wiederhole meine Prophezeiung: Deutschland wird in wenigen Jahren Republik sein und in Frankreich wird dereinst der letzte König sterben und der letzte Priester wird bei seinem Tode die Glocke läuten“. – Unsere Nachfahren mögen die Erfüllung kontrollieren. Denn das „in wenigen Jahren“ – – – ?? Ich glaube nicht recht an die Prophezeiung, aber an Johannes, an seine Genialität und seine tiefe menschliche Güte und Größe glaube ich.
München, Sonntag, d. 5. Mai 1912.
Gestern kam ich nachmittags zu Mariechen. Sie stand angekleidet da, die Mütze auf dem Kopf, im Begriff zu gehn. Ich half ihr packen. Wir warteten noch, bis der Mann kam. Dann gings hinüber zum Café Eiles, das mitten in der Sonnenstrasse im Freien einen Gartenausschank eingerichtet hat. Jung und ich tranken Kaffee, Mariechen Limonade. Sie sah sehr angegriffen aus und hatte Schmerzen von der Milch, die ihr bis in den Hals strömte. Ich mußte die Zeche zahlen, auch das Öl, das zur Bekämpfung der Brustmilch gekauft wurde, und das Auto, mit dem wir die Frau fortschafften. Jung hat mit ihr das Atelier eines Malers in der Schubertstrasse 6 bezogen, der bis Pfingsten verreist ist – ich glaube, Kugler heißt der Mann. Irgendein gemeinsamer Bekannter hat ihm die Schlüssel übergeben. So ist also die junge Frau ganz gut untergebracht. Sonst hätte ich ihr hier in der Pension ein Zimmer genommen, was natürlich sehr kostspielig geworden wäre. Ich begleitete sie noch hinauf – eine recht elegante Atelierwohnung in einer vornehmen Villa. Gut eingerichtet, mit Gas und allem, was nötig ist. Ich gab ihr noch 2 Mark, und jetzt will ich wieder hin und nach dem Rechten sehen, obwohl es geradzu Bindfaden regnet. – Ich ging mit dem Rest meines Vermögens – etwa 5 Mk (jetzt sind blos noch 2 da) ins Stefanie, wo ich mit Roda Roda, dann mit Nonnenbruch Schach spielte. Rößler fand sich ein. Er erzählte vom Consul, dessen Befinden seit dem Rodelunfall immer noch zu wünschen übrig lasse. Ich fuhr dann mit Roda Roda, dessen Frau, Schwiegermutter und Gustav Meyrink ins Schauspielhaus zu „Erich XIV“ von Strindberg. Das ist ein geniales Werk! Man übertreibt nicht, wenn man es mit Shakespeares Königsdramen in eine Linie stellt. Der Charakter Erichs, der sich am ehesten wohl mit dem Richards II. vergleichen läßt, ist in einer Weise herausgearbeitet, daß einem vor soviel Menschlichkeit in einem Unmenschen schaudert. Stollberg hat sich mit der Aufführung alle Mühe gegeben. Die Ausstattung war sehr schön, nur leider überall zu frisch, zu neu, roch noch nach Farbe und Lack. In der Inszenierung manches recht ungeschickt, besonders der Vorbeimarsch des Herzogs Johann auf der Brücke gradezu peinlich langwierig und ohne Temperament. Sowas darf nicht sein. Die Schauspieler taten, was in ihren schwachen Kräften stand. Weigert war als Erich gewonnen. Er war besser, als ich erwartet hatte, manchmal hatte er ausgezeichnete Momente, selbst ganze Szenen hindurch hielt hie und da die Anspannung vor. Dann wieder wurde er ganz konventionell. Er ist eben doch kein großer Schauspieler, der mit dieser riesigen aber unendlich dankbaren Aufgabe ganz fertig geworden wäre. Das wäre eine Sache für Kainz gewesen. Auch Moissi könnte ich mir sehr gut denken. Seinen Prokurator spielte Hans Raabe, natürlich mit Talent, aber natürlich durchaus ohne zureichendes Talent. Überall versagt es, überall langt’s nicht: die Rolle von Steinrück – Donnerwetter! Die Steffen störte nicht, war aber auch durchaus nicht bedeutend als Maitresse des Königs. Ansfelder als alter Sture mit großem Umhängebart unglaublich. Alle andern ziemlich und recht kläglich. Es gibt keine Künstler an der Bühne da.
Nachher Torggelstube. Dort lernte ich Anny Rosar kennen, die Wiener Schauspielerin die hier im Künstlertheater in Calderons „Circe“ spielen wird. Eine nette lebhafte Person. Brann lud sie, Rodas und mich zu sich ein, und so fuhren wir in seine reizende Wohnung in die Dietlindenstrasse. Dort wurde gezecht und Kempinsky-Sekt getrunken. Brann und ich brachten die Rosar heim. Ich ging dann noch ins Stefanie, wo ich mit Herrn Nitschke aus der Pension Führmann Billard spielte. Auf dem Heimweg merkte ich, daß ich recht betrunken war und ein wenig torkelte.
Heut kam ein Brief von Margrit aus dem Gefängnis. Sehr lieb, nett und freundschaftlich. Sie scheint gefaßt und gutes Mutes. Sie hat für Johannes wertvolle Exzerpten aus Lenaus Briefen an Sofie gemacht – über Baader. Ich soll sie ihm schicken. Ich werde der guten Frau schnellstens antworten.
München, Dienstag, d. 7. Mai 1912.
Mariechen giebt mir jetzt sehr zu tun und ich hetze mich allmählich für sie in Verpflichtungen, aus denen ich kaum mehr ein Heraus sehe. Sonntag wollte ich sie in der Schubertstrasse aufsuchen, da mir aber niemand öffnete, mußte ich wieder abziehn. Zu meiner nicht grade angenehmen Überraschung saß sie dann – 4 Tage nach der Entbindung! – im Stefanie. Ich blieb mit ihr beisammen, blieb für sie die Zeche mit schuldig, da all meine Habe 20 Pfennige betrug und begleitete sie gegen Abend heim. Der Ehegatte stand auf der Straße und wartete. Er sah sehr unliebenswürdig aus, und als die Frau mir zum Abschied die Hand drückte, sah ich ihr Auge geängstigt. Sie hatte sich zulange im Café aufgehalten. Jedenfalls waren wir unterwegs völlig einig geworden. Sie erklärte sich mit aller Bestimmtheit entschlossen, sich für ihr ferneres Leben mir anzuvertrauen, und so bin ich jetzt sozusagen für eine freie Ehe „verlobt“. Ein verrückter Zustand, den ich bei mir nicht für möglich gehalten habe.
Gestern war nun ein Tag, der mir im Gedächtnis bleiben wird. Ich war vormittags auf der Staatsbibliothek und ließ mir die 20 Mk zurückzahlen, die ich dort seinerzeit deponiert habe. Jetzt ist mir also die Möglichkeit, dort Bücher auszuleihen, wieder abgeschnitten. Um ½ 3 Uhr hatte ich mich mit Mariechen ins Stefanie verabredet. Sie saß dort mit Jung, Klein, Morax und Ida. Die Herren tranken Schnaps, den Klein spendierte, der als Direktor einer Fahrplan-Gesellschafts-Filiale mit 6000 Mk jährlich angestellt ist. Mariechen sah sehr angegriffen aus und ich bemerkte bald, daß sie in übler Laune war. Sie redete davon, daß sie so gern abreisen wolle, aber kein Geld habe. Immer mehr redete sie sich in Aufregung hinein, bis ihr die Tränen kamen und sie nun aggressiv gegen den Mann wurde, dem sie ungeheure Vorwürfe machte. Ich entnahm aus dem, was sie sagte, daß der Kerl sie in der Frühe geschlagen habe. Schließlich machte sich ihre Erregung in einem heftigen nervösen Anfall Luft. Sie schimpfte ganz laut durchs Lokal, als ob es ihr Freude machte, die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihr Unglück zu lenken. Schließlich schrie sie den Mann an: „Geh, du Schwein! Ich kann dich nicht mehr sehn! Geh doch! Was grinst du noch?“ – Ich bat den Mann, doch fortzugehn, um keinen größeren Skandal entstehn zu lassen, und so stand er auf. Als er fortging, nahm Mariechen ein Glas Wasser und schmiß es mit aller Wucht auf den Gatten. Leider traf es nicht. Es zerkrachte im Lokal. Allgemeine Aufregung. Ich half ihr schnell in den Mantel und ging mit ihr fort. Am Nebentisch hielt uns ein Herr an.
Ich hatte die Eintragung hier unterbrochen, weil ich um ½ 3 Uhr mit Mariechen im Café Odeon verabredet war. Sie versetzte mich. Ich wartete eine Stunde, ging dann ins Stefanie, wo mir Morax Dinge berichtete, die ich eventuell als Schluß der Mariechen-Episode werde betrachten müssen. Weiter in der Reihenfolge:
Nach dem Krach im Stefanie also sprach uns ein Herr an, ein ziemlich junger Mensch, elegant angetan, mit rotem Schnurrbart und etwas Assessor-Visage. Wir mögen ihn draußen erwarten. Er könne der Dame vielleicht finanziell helfen. Angenehm war mir die Sache nicht, ich dachte mir aber, ich dürfe Mariechen keinesfalls im Wege sein. So ging ich mit ihr hinaus. Sie trat in einen Hausflur, um sich auszuweinen. Der Jüngling kam, schob mich, als ich ihm entgegenging beiseite, und nahm Mariechen in ein reguläres Verhör, bei dem er feststellte, daß sie mit Jung verheiratet sei, eben erst eine Geburt überstanden habe, daß das Kind tot sei, daß sie 24, der Mann 23 Jahre alt sei und was sonst noch wichtig war, um eine Hilfe am Platze erscheinen zu lassen. Ich dachte mir: Was für ein Pack! Hat er wirklich mal eine anständige Regung, so findet er nie die anständige Geste dazu. Ich erklärte dem Mann, daß nichts weiter nötig sei, als das Reisegeld nach Breslau, also 30 Mk, und ich würde ihm durch Schuldschein oder Wechsel für die Summe garantieren. Der Mann tat aber sehr vornehm, verzichtete auf jede Garantie, holte sein Portemonnaie aus der Tasche und zog – fünf Mark heraus, obwohl man mindestens für 50 Mk Gold drin liegen sah. Das sei zunächst für Essen und Unterkunft. Im übrigen müsse er den Fall seinem Korps unterbreiten und sehn, ob das das Billet bezahlen werde. Ich veranlaßte Mariechen, die 5 Mk nicht zu nehmen, erklärte, daß für die Notwendigkeiten des Tages durch mich gesorgt sei, und gab dem Kerl meine Adresse, an die er versprach, das Billet nach Breslau einsenden zu wollen. Seinen Namen und sein Korps anzugeben, lehnte er ab und ging, flüchtig seinen Zylinder lüftend, davon. (Natürlich ist das Billet bis zur Stunde bei mir nicht eingetroffen). Ich fuhr jetzt mit Mariechen zur Auer Dult hinunter, da sie zur Reise dringend einen Koffer brauchte. Leider hatte ich, da, als ich von Hause fortging, herrlicher Sonnenschein war, keinen Überzieher an, und draußen am Mariahilferplatz langten wir bei ziemlich heftigem Regen an. Wir kauften einen schönen Koffer für 8 Mk 50 und fuhren damit nach der Schubertstrasse, wo Mariechen sofort ihre Effekten von seinen trennen und gleich mitnehmen wollte. Am Sendlingertorplatz mußten wir umsteigen, und während wir auf unsre Tram warteten, goß es in Strömen, sodaß ich völlig durchweichte. Natürlich hatte Mariechen zu der Wohnung keinen Schlüssel. So war die Fahrt dorthin umsonst gewesen. Wir nahmen jetzt ein Auto und fuhren zunächst beim Stefanie vor, wo ich Morax herausholte, der auf seinem Zimmer mehrere Körbe des Ehepaars beherbergt. Wir fuhren jetzt alle zu ihm in die Belgradstrasse, und dort nahm Mariechen die Scheidung vor, indem sie ihre Sachen in die Körbe und den neuen Koffer packte, seine in eine Ecke schmiß. Inzwischen bat sie mich, ihr aus der Apotheke nebenan Vaseline zu holen. Als ich hinauskam, wurde ich angerufen. Es war Jung. Ehe er zur Überlegung kam, bat ich ihn um die Schubertstrassen-Schlüssel, die er sofort hergab. Aber gleich wollte er sie wiederhaben, da er noch dorthin müsse. Ich gab sie nicht mehr heraus, sondern versprach ihm, sie ihm um 12 Uhr nachts ins Stefanie zu bringen. Er war in Nitschkes Gesellschaft. Als ich Mariechen Vaseline und Schlüssel brachte und ihr die Begegnung erzählte, wollte sie gleich hinterher und den Kerl womöglich auf offener Straße verprügeln. Gottseidank erwischte sie die beiden nicht mehr, und so ging die Reise zurück zur Schubertstrasse, von einem Ende Münchens bis zum andern. Mariechen wollte oben ihre Brüste, die sie schmerzten, behandeln, und bat mich, sie in einer Stunde vor der Tür wieder zu erwarten. Oben in der Wohnung hielt sie mir noch die Backe zum Kusse hin, dann ging ich los, ganz langsam ins Café Eiles in der Sonnenstrasse, wo ich die Kain-Manuskripte in ein Kuvert packte, um sie per Post zu Steinebach zu schicken, und dann zurück. Sie kam pünktlich um ½ 8 herunter mit meinem Handtäschchen, das ich ihr geliehen habe. Per Tram wieder fort. Sie beredete mich, mit ihr zusammen bei Führmann Abendbrot zu essen. Das Täschchen stellten wir bei Morax’ Wirtin unter. Nach dem Essen nahm Führmann Mariechen bei Seite. Es seien für Jung vorgestern 90 Mk angekommen, die er bekommen habe. Mariechen war außer sich vor Wut und ich war ebenso empört, daß der Kerl das Geld wieder im ganzen versoffen hatte, ohne ihr einen Pfennig zu geben, ohne ihr die Reise oder das Spital zu zahlen, ohne für die Pension irgendetwas zu entrichten. Dabei hatte er die arme Wöchnerin in der Frühe verprügelt, um ihr die eine Mark zu entreißen, die sie noch in einzelnen Groschen von dem übrig hatte, was ich ihr geschenkt habe. Jedenfalls hatte sie nun die Trennung vollzogen, hatte in der Schubertstrasse ihr Eigentum fortgeholt und ihm einen Brief hinterlassen, daß sie nicht mehr zu ihm kommen werde. Führmann benahm sich sehr anständig. Er bot Mariechen an, stets bei ihm zu essen und stellte ihr auch in seiner Dependance-Wohnung ein Zimmer zur Verfügung. Dorthin wollte sie nun also – es war 9 Uhr vorbei – endlich schlafen gehn. Wir holten das Täschchen zuerst von Morax zurück, und dann mußten wir, da Mariechen keine Schlüssel hatte, noch 20 Minuten im Freien warten, bis jemand kam, ich immer ohne Überzieher, und dabei regnete es und war empfindlich kühl. Endlich ging sie hinein. Ich eilte heim, holte den Mantel und ging in den Ratskeller, wo das Krokodil bei Maibowle sein einjähriges Bestehen feierte. Es war recht lustig. Ich mußte in das Präsenzbuch ein Gedichtchen schreiben als Pendant zu dem Krokodil-Gedicht Hermann Linggs, das das erste Buch schmückt. Nachher pumpte ich Schmitz um 10 Mk an, die ich versprach, beim übernächsten Kegelabend zurückzugeben. Nachmittags hatte ich Morax schon um 5 Mk erleichtert, die ich bis Ende dieser Woche zurückzahlen soll. Ich weiß noch nicht, wie das alles werden soll. Die Teilnahme am Krokodilfest kostete mich 4 Mk und nachher gab ich noch über 2 Mk aus. Da ich heute im Stefanie wieder für das, was Mariechen dort gestern verzehrt hatte vom Kellner um 2 Mk hergenommen wurde, habe ich von den gestrigen 35 Mk wieder blos noch 4 Mk und einiges. – Nach der Krokodils-Feier gings in eine Theestube in der Dienerstrasse, das ehemalige „Marco Polo“, wo eine unglaubliche Hure die Kellnerin spielte. Sie war für ihre gemeinen Zotereien zu häßlich und mir nur als Typus interessant. Nachher noch mit dem Rest der Teilnehmer zum Bunten Vogel. Um 3 Uhr nach Hause.
Was heut passierte nahm ich schon vorweg. Ich habe Mariechen noch nicht gesehn, nur in der Frühe telefonisch gesprochen. Nachdem sie das Rendez-vous, das wir dabei verabredeten, verabsäumt hatte, sprach ich also Morax. Der berichtete, sie sei mit dem Gatten heute ganz friedlich bei ihm gewesen, und da hätten sie alles wieder umgepackt, und wollen jetzt gemeinsam irgendwohin nach auswärts ziehn. Stimmt das, so ist die Angelegenheit für mich erledigt. Ich werde Mariechen, sobald ich sie wiedersehe, energisch klarmachen, daß ich nicht mit mir spielen lasse. Daß ich ihr über die schweren Tage der Geburt mit meinen beschränkten Mitteln hinweggeholfen habe, freut mich. Aber, wenn ich merke, daß ich ihr nur als materielle Hilfsquelle interessant bin, will ich die Beziehung doch lieber abbrechen, ehe sie begonnen hat. Liebt sie den Schweinekerl von Ehemann immer noch so, daß sie nach allem Vorgefallenen nicht von ihm lassen will, so werde ich sie an ihrem Untergang nicht zu hindern versuchen. Aber ich bin traurig. Dieser schönen Frau das Leben süß zu machen, wäre eine gute Aufgabe für mich gewesen, die mir manches Glück hätte schaffen können.
Von Siegfried Lang kam aus Paris ein dicker eingeschriebener Brief mit Manuskripten. Ich soll ihm beim Dreililien-Verlag dazu verhelfen, daß der ein Buch von ihm ediert. Das hat ihm Johannes geraten. Ich bin außer mir. Als ob ich, da ich den Verlag monatelang auf meine vertragsmäßige Manuskriptlieferung warten ließ, dort noch jemand anders hin empfehlen könnte! Ich muß das Buch jetzt nur möglichst bald fertig stellen, um das Geld zu kriegen. Ferner muß ich schleunigst die neuen Manuskripte für den Dreimasken-Verlag lesen und sehn, daß ich über diesen schauderhaften Monat mit halbwegs geregeltem Budget hinwegkomme. Mir graut, wenn ich bedenke, daß der Monat noch volle drei Wochen hat, und daß ich allein 100 Mk brauchte, die dringendsten Schulden zu begleichen. Von den täglichen Notwendigkeiten garnicht zu sprechen.
München, Mittwoch, d. 8. Mai 1912.
Mariechen habe ich weder gestern noch heute gesehen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan –. Ich war in diesen Tagen sehr nervös, zumal mir Johannes auch noch schrieb, er habe in Paris Kanders getroffen, der von Basel kam. Dort habe er ein Rendez-vous mit Frieda gehabt. Wie sehr bin ich doch bei dieser einzigen Geliebten abgesetzt! Was bin ich doch eigentlich für ein armer Teufel!
Gestern abend saß ich, trüber Gedanken voll im Zimmer, da wurde mir eine Dame gemeldet. Ich glaubte schon: Mariechen, – aber es war Emma Gellért, bei der ich die pflichtgemäßen Zärtlichkeiten nur mit einigem Widerstreben zustande brachte. Ich nahm sie aber doch ins Bett und tat meine Pflicht. Post coitum omne animal triste, heißt es. Meine Erfahrungen sind anders. Ich liebe die dicke Ungarin bei Gott nicht und zwinge mich zu jeder Freundlichkeit gegen sie. Und doch fühlte ich mich, als ich sie los war, recht wohl im Gegensatz zum ganzen Tag vorher und ging in die Torggelstube, wo ich sehr lustig und witzig war. Alma Lind war mit Strauß und dessen Bruder da. Später kamen noch Charlie Grünbaum mit seiner Frau. Es wurde unglaublich geschweinigelt (übrigens gefällt mir die Lind, die ich sehr lange nicht sah, recht gut). Strauß versprach mir, bei der Bonbonnière anzuregen, ob man nicht mich für den Juni engagieren will. Ich stellte folgende Forderungen: für den ganzen Monat als Rezitator meiner Verse 900 Mk, für den halben Monat 500 Mk; für den ganzen Monat als Rezitator und Conferenzier 1200 Mark. Strauß will diese Vorschläge machen. – Ich las nachher noch im Bett ein Stück für den Dreimasken-Verlag und werde das letzte heut nacht zu Ende lesen, und dann morgen alles abliefern und Geld holen.
Heut mittag kam das Puma zu mir zum Essen. Ich traf sie auf der Straße, als ich vom Bavaria-Bad kam. Vorher hatte ich von Steinebach den ersten Kain-Jahrgang sehr schön in Halbleder gebunden zugeschickt bekommen. Ich freue mich sehr darüber. Es ist doch eine anständige Leistung, im ganzen betrachtet. Das Puma erzählte wieder Erotica und als ich sie hinunterbegleitet hatte und ins Stefanie gehn wollte, rief mich jemand an. Es war Martha Neves, an die ich im Augenblick grade dachte. Es ist seltsam, wie das Mädchen mich neuerdings plötzlich beschäftigt. Wer weiß, wer weiß, ob ich nicht eines Tages Frank Wedekinds Schwager sein werde. Eine reizendere Frau könnte ich mir wahrhaftig nicht wünschen. Wir gingen nur ein paar Schritte miteinander. Sie versprach mir von neuem ihren Besuch.
Bei Steinebach las ich Korrekturen und ging dann mit dem Leitartikel der Mai-Nummer zu Strauß, weil ich Konfiskations-Bedenken hatte. Er meinte, der Artikel sei unbedenklich. Später Stefanie. Ich spielte mit Roda Roda Schach. Plötzlich bat er mich an einen andern Tisch und schlug mir vor, mit ihm zusammen ein Stück zu schreiben. Ich nahm an. Als Bedingung sagte er, auf Halb und Halb des Verdienstes arbeite er nicht, er glaube die größere Arbeit leisten zu müssen, und bot mir 40% an. In der Zeit des Entstehens wolle er mir monatlich 250 Mk Vorschuß geben. Ich ging drauf ein. Wir wollen Kontrakt machen, und schon in der allerkürzesten Zeit soll die Arbeit angehn. Ich bin sehr gespannt, ob aus dieser Geschichte etwas wird. Jedenfalls zeigen sich wieder Geldaussichten, und ich muß sehn, zu einem neuen Anzug und zu neuer Wäsche zu kommen. Die Klamotten fallen mir bald fetzenweise vom Leibe.
München, Freitag, d. 10. Mai 1912.
Die Mariechen-Geschichte ist doch nicht so schnell zu erledigen für mich. Ich merke, daß ich schon zu viel Feuer gefangen habe, um noch zurück zu können. Schicksal, nimm deinen Lauf! – Wie wird das enden?
Gestern hielts mich nicht. Ich ging abends zur Pension Führmann hinunter, sie zu suchen, die 50 Mk vom Dreimasken-Verlag in der Tasche. Ich wollte ihr das Reisegeld nach Breslau anbieten. Sie war nicht dort. Die Herren Richter und Lotz erzählten mir eine neue Schweinerei des Ehemanns Jung. Er lieh sich von Nitschke 10 Mk aus, der grade 100 bekommen hatte. N. gab ihm die Banknote zum Wechseln und Jung ward nicht mehr gesehen. – Ich schrieb an Mariechen eine Postkarte und bat sie, mich heut mittag telefonisch anzurufen. Das tat sie und bestellte mich um ½ 4 Uhr ins Café Bauer. Ich wartete lange. Schließlich kam der Gatte, kurz darauf sie. Sie sah blaß und krank aus, aber sehr schön. Ich erklärte ihr, daß ich das Reisegeld für sie habe, (leider blos das, da ich Morax sein Geld wiedergab und gestern allerlei für mich verbrauchte). Sie begleitete mich dann – der Mann hatte uns bald diskret verlassen – zum Dreimasken-Verlag, wo ich Sobotka leider vergebens suchte. Dann besorgte sie etwas in der Kaufingerstrasse und schließlich landeten wir im Café Perzl am Marienplatz. Wir sprachen uns über alles gründlich aus. Sie erklärte kategorisch, nicht bei ihrem Mann bleiben zu wollen und mit mir leben zu wollen. Von Breslau aus wolle sie mir ihre Entschlüsse deutlich formuliert mitteilen. Im Perzl nahm sie mir die 30 Mk für das Billet gleich ab und berichtete dabei, daß sie selbst noch 20 Mk hatte, die ihr der Mann allerdings nur gegeben habe, damit sie sie Nitschke zurückstelle. Ich veranlaßte sie sofort, das nicht zu tun, ich werde Nitschke für die 20 Mk garantieren. Jetzt wollte sie in die Belgradstrasse zum Leihhaus, ihre Reisedecke auszulösen, mit der sie morgen abend fahren wolle. Ich sollte inzwischen ins Stefanie und einen roten Radler an Nitschke senden, mit dem Garantie-Brief für die 20 Mk. – Spätestens ½ 8 Uhr wollte sie dann bestimmt bei mir sein zum Abendbrot. Ich bat sie in der Elektrischen noch sehr, mich bestimmt nicht zu versetzen und sie versprach hoch und heilig zu kommen. Es ist jetzt bald ¾ 9 Uhr. Ich habe aufgegessen – ohne Appetit wahrhaftig – und Mariechen ist nicht da. – Ich mag nicht glauben, daß sie mich nur als Geldwurzen betrachtet, aber ich bin sehr unglücklich. Muß ich mich denn von allen Menschen wie ein Hund behandeln lassen? Morgen wird sie natürlich eine ganz harmlose Erklärung für ihr Verstellen haben und ich werde damit zufrieden sein. – Ich sehe die ganze Johannes-Passion wiederkommen.
Ein eingeschriebener Brief kam von Martin Drescher aus Chicago. Er erinnert mich daran, wie ich ihn vor 10 Jahren mal von Friedrichshagen aus um Rat bat, ob ich nach Amerika übersiedeln sollte und wie er mir energisch abriet. Er legt Gedichte bei „Strolchenreime“, für die ich ihm einen Verleger beschaffen soll. Undankbare Aufgabe!
Heut hatte ich Besuch von dem ehemaligen Verantwortlichen des „Freien Arbeiters“ Oesterreich, der im Dezember die 4½ Jahre Zuchthaus hinter sich gebracht hat, die er für ein paar antimilitaristische Artikel bekommen hatte.
Ich wurde durch telefonischen Anruf unterbrochen. Mariechen: sie will gleich herkommen. – Ich bin überglücklich!
Also Österreich: der arme Kerl – er ist genau in meinem Alter, hat furchtbar gealtert im Zuchthaus. Er erzählte, daß er die ganze Zeit in Einzelhaft war, da man befürchtete, er könnte sonst für seine Ideen Freunde werben. Die ersten 2 Jahre habe er mit keinem Menschen gesprochen. Erst dann manchmal mit einem Wärter sich unterhalten. Entsetzlich! Ein anständiger Mensch mit etwas verbohrten, pedantischen Organisations-Ideen. Was für Menschen müssen doch die Richter sein, die ehrliche Leute, nur weil sie unbequeme Ansichten haben, dermaßen unglücklich machen mögen!
Gestern sprach mich im Café Stefanie Gustav Lewitzky an, den ich aus Ascona kenne und dann in Zürich wiedertraf. Er erzählte, er werde seine Freundin Asta hier erwarten. Ich freue mich sehr, die wiedersehn zu sollen. Ich hatte sie sehr gern. Nachher – nach 3 Uhr begleitete ich ihn noch. Ausführliche Gespräche über die anarchistischen Bewegungen in Rußland, Deutschland und Frankreich. Ich kam erst um 4 Uhr heim.
München, Sonnabend, d. 11. Mai 1912.
Meine große Freude war gestern verfrüht. Mariechen kam nicht mehr. Vielleicht wird sie mich gleich anrufen. Ich kanns nicht wissen. Wenn nicht, so werde ich ihr im Café Bauer einen Brief deponieren und für heut nachmittag ein Rendez-vous herbeizuführen versuchen. Ich möchte ihr doch noch adjö sagen vor der Abreise.
Ich habe viel vor heute. Erst muß ich auf der Druckerei alles ins Reine bringen, damit Montag unbedingt gedruckt wird. Um 4 Uhr soll ich auf dem Dreimasken-Verlag Sobotka sprechen. Gott gebs, daß von dem Geld zu kriegen ist. Ich muß unbedingt folgende Schulden in der allerkürzesten Zeit zahlen.
Marie (Torggelstube) |
Mk 12.- |
Schuster |
'' 25.- |
'' 10.- |
|
'' 20.- |
|
|
Mk 67.- |
Ferner brauche ich mehr als dringlich einen Anzug, Hemden, Strümpfe und Hut. Es wären also allermindestens 200 Mk nötig, um ohne garzu arge Schwierigkeiten bis zum Juni zu kommen. Wenn dann mein Vertrag mit Roda perfekt ist, wäre ja dafür gesorgt, daß die Ehe mit Mariechen beginnen kann.
Strauß hat, wie er mir gestern im Torggelhaus erzählte, mit Rößler gesprochen – und ihm nahegelegt, mir mit 200 Mk auszuhelfen. Der hat aber abgelehnt, weil er auf mich wütend sei. Zu dumm! Der alte eifersüchtige Esel. Hätte ichs wenigstens erreicht, was ich vom Consul wollte! Daran erinnert er sich natürlich nicht mehr, wie ich ihm einmal das Puma, das ich doch gewiß lieb habe, in seine Parterrebude bei der Mutter Groß durchs Fenster hineinreichte, und wie er vor einem Jahre (ich las das gestern grade hier im Tagebuch nach) auf meinem Diwan mit Emmy koitierte. Aber er ist von Natur etwas schundig, und da wirds ihm vielleicht ganz gut passen, jetzt, wo er die horrenden Einnahmen aus den „Fünf Frankfurtern“ hat, einen hilfsbedürftigen Freund sich mit Gründen vom Halse halten zu können. Gute Menschen sind selten.
Heut früh meldete sich, ehe ich aufgestanden war, Herr Emil Fey bei mir an, der ehemalige Freund Margarete Faas’, der ihr dann die Bibliotheks-Bücher stahl, und in Wien einen Menschen umbrachte. Ich ließ ihn eintreten. Er ist erst seit kurzem aus dem Gefängnis entlassen, in dem er (man hatte ihm Notwehr zugebilligt) 8 Monate gesessen hat. Er erzählte mir die ganze Geschichte, die mir recht widerwärtig war. Der ganze Kerl geht mir gegen den Geschmack. Ich habe stark die Empfindung, daß er pathologisch sein muß. Auf freundschaftliche Beziehungen werde ich mich nicht zu ihm einlassen. Leider will er einige Monate in München bleiben. Der Mensch ist mir etwas unheimlich, dabei aber intelligent, sehr belesen und offenbar trotz aller Charaktermängel von anarchistischen Ideen durchdrungen. Aber ein wüster Wiener, ein roher Patron und ein oberfauler Charakter.
München, Sonntag, d. 12. Mai 1912.
Heute hat Friedel ihren 36ten Geburtstag. Ich habe ihr einen Brief geschrieben, den sie wohl zur Zeit bekommen hat. Daraus wird sie ersehn, wie eng ich mich ihr immer noch verbunden fühle, wie stark und unerschüttert meine Liebe zu ihr noch ist und wie fest meine Dankbarkeit und Treue. Ich habe ihr auch über die Mariechen-Affäre einiges mitgeteilt. So ganz ohne Zeugen möchte ich dabei nicht sein, und sie wird’s freuen, mich in einem Erlebnis zu wissen, von dem mir vielleicht Heil kommen kann. Wird es kommen? Mir ist alles ganz unklar. Ich habe das Mädel seit vorgestern nicht gesehn. Gestern schickte ich ihr ein Telegramm und eine Postkarte, sie möchte antelefonieren. Aber bis jetzt hat sie sich wieder nicht gemeldet. Morax berichtete, sie sei heut mittag beim Essen gewesen, und Führmann erzählte, sie habe mein Telegramm und die Karte in der Hand gehabt und er habe sie auf meinen ihm gestern geäußerten Wunsch aufmerksam gemacht, daß sie mich anrufen solle. Er meinte, sie habe es wohl aus Furcht vor dem Manne, der bei ihr war, unterlassen. Ich weiß garnicht, was ich aus alledem machen soll. Am richtigsten wäre es natürlich, gleich Schluß zu machen, da sonst eine Nerven- und Geldschraube ohne Ende aus der Geschichte wird. Andrerseits bin ich doch wohl schon zu verliebt und nach ihren zustimmenden Erklärungen zu erpicht darauf, mit ihr zusammenzukommen. Wollte sie blos erst abreisen! Die 30 Mk, die ich ihr vorgestern gab, hat sie offenbar für andre Dinge ausgegeben, vielleicht hat sie auch der Mann genommen, und sie schämt sich womöglich, mir das zu berichten. – Momentan habe ich wieder Geld, da ich gestern auf dem Dreimasken-Verlag Sobotka sprechen konnte. Nach langem Hin und Her einigten wir uns dahin, daß ich für „Cherchez la femme“ ein Schwank-Szenarium möglichst bald vorlegen soll. Dafür bekam ich als Vorschuß 75 Mk. Wird ein Auftrag perfekt, so folgt weiterer Vorschuß, der mich für die Zeit der Arbeit über Wasser halten kann. Also, wenn Mariechen will, – für unsern Unterhalt wäre leidlich gesorgt. Nur die Schulden! Was ich gestern aufschrieb, langt ja noch garnicht. Schmitz muß unbedingt seine 10 Mk kriegen, und eines Tages wird sich wohl auch Führmann mit der Garantie-Forderung einfinden. Es wäre wohl hoch an der Zeit, daß ich endlich in geordnete Verhältnisse hineinkäme. Aber es scheint, ich soll doch wohl eher kaput gehn, als die Natur bei meinem Vater ihres Amtes walten wird.
Abends ging ich ins Torggelhaus. Da bei Führmann gestern das Fliederfest stattfand, und ich fortwährend denken mußte, vielleicht könnte Mariechen dort sein, hielts mich nicht lange. Ich ging um 11 Uhr fort: zuerst noch ins Odeon-Café, wo ich Heinrich Mann traf. Wir blieben bis Mitternacht beieinander, dann fuhr ich zu Führmann. Es war ganz nett, wurde sehr viel getrunken und viel geküßt. Für mich fiel in dieser Beziehung leider fast nichts ab. Mariechen war nicht da, und die Frauen, die teilweise sehr reizend waren, hatten alle schon Versorgung. Ein paar Münder freilich konnte ich auch schmecken, aber nur raubweise im Vorbeigehen. – Nun sitze ich da und warte. Ich bat Führmann, mir, im Falle Mariechen heut abend in die Pension kommt, telefonischen Bescheid zu geben. Bis ½ 10 Uhr kann dieser Bescheid noch kommen. Ich glaube nicht dran, aber bin doch so nervös, daß ich nichts beginnen kann inzwischen. Ich will ihr noch einmal mit dem Reisegeld aushelfen, ihr es aber nicht mehr persönlich in die Hand geben, sondern ihr einfach am Bahnhof das Billet kaufen und sie selbst in den Zug setzen. 20 Mark erhielt ich gestern noch von Albu in der Torggelstube. Er bot sie mir neulich an, als ich klagte, daß ich meine Bibliothekskarte abgeben müßte, hatte sie aber damals nicht bei sich. Gestern rückte er sie, ohne daß ich ihn erinnerte, heraus. Sehr anständig, hätte ich nicht das Gefühl dabei, daß er wohl seinen Nutzen dabei berechnet haben wird. Nur hat er bestimmt falsch gerechnet. Mein Urteil über seine Lyrik bleibt unverändert, und schreiben werde ich bestimmt nicht darüber.
München, Montag, d. 13. Mai 1912.
Meine Nerven sind fürchterlich kaput. Mariechens Verhalten regt mich entsetzlich auf. Ich sitze jeden Moment in Erwartung des Telefonanrufs und weiß doch fast sicher, daß er nicht erfolgen wird. Daß ich doch mein ganzes Leben zu schlechter Behandlung verurteilt sein muß. Die einzige Erklärung, die ich mir denken kann, ist die, daß sie wohl sexuell wieder intakt ist und nun von dem Manne, der sie unglücklich macht und prügelt, nicht loskann. Wollte sie mir blos ein Wort schreiben, daß ich Gewißheit habe! Wie konnte ich mich nur wieder so in dieses Erlebnis verlieren! Ich bin jetzt ganz unfähig zu arbeiten und zu allem. Fortwährend bin ich benommen von den Gedanken an sie. – Gestern abend, nachdem ich wieder lange vergeblich zuhause auf Nachricht gewartet hatte, ging ich in die Torggelstube. Dort traf ich zu meiner Überraschung nebst Scharf und Schwaiger Wedekind, der eben von seinem erfolgreichen Gastspiel am Stuttgarter Hoftheater zurück ist. Er bleibt nur wenige Tage hier, da er gleich wieder in Nürnberg am Intimen und in Berlin am Deutschen Theater gastieren soll. Nachdem Scharf fort war, unterhielten wir uns lange über Rößler und seinen Erfolg mit den Frankfurtern. Wedekind bestritt, daß Rößler noch literarische Prätentionen habe, die ich behauptete. Nachher Gespräche über Industrialismus und Einzelarbeit. Ich war vor 3 im Bett.
München, Dienstag, d. 14. Mai 1912.
Die Mariechen-Geschichte gebe ich auf. Gestern machte ich noch einen Versuch, sie zu treffen. Ich hatte von Führmanns Fest aus einen falschen Stock mitgenommen, und unter dem Vorwand, ihn umtauschen zu wollen, ging ich zur Pension hinunter. Sie war nicht dort gewesen. Nachmittag erzählte mir Morax, in welcher Weise sie über mich spreche. Daß ich mir so die Hacken nach ihr ablaufe, soll mich teuer zu stehn kommen etc. Nun, ich habe keine Liebe bei ihr vermutet, aber doch Respekt und Aufrichtigkeit. Ich denke ja auch jetzt noch, daß sie manche guten Gefühle hinter Schnoddrigkeiten verbirgt, da sie sich aber überhaupt nicht mehr meldet, werde ich weitere Bemühungen um sie auch aufgeben. Nur mein Handtäschchen und eine Reihe Bücher, die ich ihr geliehen habe, werde ich zu retten suchen, vor allem Wedekinds „Franziska“ mit der Widmung an mich. Es wäre sehr schmerzlich für mich, wenn das Ehepaar das Buch schon zu Geld gemacht hätte. Gestern schickte ich ihr noch einen Brief in die Schubertstrasse, in dem ich sie zu heute in die Torggelstube zum Mittagessen einlud und aufforderte, mich jedenfalls wissen zu lassen, was los ist und warum sie sich nicht mehr meldet. Kein Wort, kein Mariechen. Auch das also vorbei. Ich bin sehr traurig und furchtbar kaput von der ganzen Affaire. Hoffentlich hab ichs bald verwunden. Hoffentlich finde ich auch bald wirklich ein Weib, mit dem es mir besser ergeht. Wenn ich freilich meinen Bekanntenkreis absuche, so wüßte ich nur eine, mit der ich leben möchte. Und ob die zu mir die mindeste Neigung hat, dafür habe ich keinerlei Beweise: Martha Neves.
Gestern abend sah ich sie im Ratskeller bei der Krokodil-Sitzung. Sie schaute aber nur hinein, ob Frank und Tilly Wedekind da wären, die sie dann im Hoftheaterrestaurant aufsuchen wollte. Leider kam sie von dort nicht zurück. Wedekind erschien allein. Ich konnte ihr bedauerlicherweise auch meine Begleitung nicht anbieten, da Dr. Streit sie schon beritterte. – Der Abend war sehr nett. Meine neue „Kain“-Nummer kursierte und Max Halbe freute sich, weil ich Thomas Mann wegen seines Eintritts in den Zensurbeirat gerüffelt habe. Später noch Torggelstube, wo mir Kutscher, Jacobi, Schmitz, Weisgerber und merkwürdigerweise auch Wedekind mein unpatriotisches Fühlen widerlegen wollten. Wir gingen erst spät auseinander. Schmitz begleitete mich bis vor die Haustür. Wir versuchten noch, im Serenissimus etwas zu trinken zu kriegen, leider vergebens.
Heut mußte ich schon früh aus dem Bett, da um 10¼ Uhr in der Au Termin angesetzt war wegen der Bahnhofsgeschichte am 29. Februar. Ich hörte vorher eine Reihe von Fällen mit an, und der Amtsrichter tat mir leid, der sich mit all den Dreckereien, Fenstereinschlagen, Betteln, Ruhestörung und dergl. Tag für Tag abzuplagen hat. Gegen ½ 12 Uhr kam unser Fall an die Reihe. Gillardoni, Lorenzen, Tarrasch und ich waren persönlich da und Rechtsanwalt Strauß als mein und der Frau Gillardoni Vertreter, die wie ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, Frl. Koretzky heißt. Der Amtsrichter war ein ganz netter Kerl, der uns anscheinend ganz gern freigesprochen hätte. Es ging aber nicht. Wir wurden zu 3 Mk verknallt: das sind immerhin 5 Mk Ersparnis gegen das ursprüngliche Urteil. Ich fuhr mit Strauß in die Torggelstube zum Essen. Meine Hoffnung, Mariechen werde dorthin kommen, trog schon wieder, und ich ging mißgestimmt erst ins Café Orlando, dann in den Garten, wo sich der Lotte-Uli-Tisch wieder zusammengefunden hat und schließlich ins Stefanie, wo ich bis jetzt mit Roda Schach spielte.
Zum Arbeiten schwinge ich mich garnicht mehr auf. Dabei habe ich wahrlich genug zu tun. Ich will von morgen ab jeden Tag für Arbeiten und Correspondenz 2 Vormittagsstunden ansetzen. Ob ichs durchführen werde? Zu diesen Tagebuch-Aufzeichnungen bleibt abends immer noch Zeit übrig. – Eben erhalte ich einen Brief von der Redaktion des „Pan“, Dr. Paul Körner, der mich zur Mitarbeit auffordert. Wieder Geldaussichten. Ferner kam eine sehr komische Karte aus Charlottenburg. Auf der Vorderseite ein englisches Gebet, auf der Rückseite dieser Text: „Umstehendes Gebet erhielt ich zur Abschrift. Die Kette darf nicht unterbrochen werden. Jeder, der es bekommt, soll es 9x abschreiben und 9 Tage lang je ein Exemplar an einen Bekannten senden ohne Namensunterschrift. Es ist die Abschrift eines alten Gebets, von dem schon in Jerusalem gesagt wurde, daß der, der es nicht abschreibt, kein Glück habe, der es aber tut, am 9. Tage eine große Freude erlebt und befreit sein soll von allen Schmerzen.“ Das Gebet selbst lautet so: „Lord Jesus, I implore Thee, bless all mankind, help us from evil and take us all two dwell with Thee in eternity.“ Gebet und Begleittext sind in gut leserlicher aber ein wenig ungeübter Schrift geschrieben. Es ist doch rührend, die Gläubigkeit solcher Menschen, und der Gedanke hat für mich etwas Ergreifendes, daß so ein frommer Spruch jetzt doch von hunderten zu hunderten weitergeht. Keiner weiß, von wem er kommt, jeder sendet ihn an 9 andre weiter, bis einmal bei einem kritischen kalten Kerl wie mir aus der Kette ein Glied herausspringt. Ich möchte wohl wissen, wer mich bedacht hat mit der Karte. Womöglich ein Anarchist! Die Handschrift sieht mir ganz danach aus und meine Psychologie spricht nicht dagegen. Wer wäre denn wirklich ein Menschenkenner?
München, Mittwoch, d. 15. Mai 1912.
Von Mariechen nichts neues. Aber in Kopf und Herzen wird sie mir noch lange zusetzen. Endlich einmal die Aussicht auf eine Art Ehe – und wieder nichts, nichts, nichts. Ob ich gar so reizlos bin? Kürzlich fielen mir die Zeitungsausschnitte wieder in die Hände aus der Zeit des Prozesses. Ich wurde überall schamlos beschimpft, überall war auch mein „groteskes Äußeres“ hervorgehoben. Und doch haben mich ja manche Frauen – und wahrlich nicht die schlechtesten – schon gern, sehr gern gehabt. Ein Mensch, den Frieda geliebt hat, kann doch unmöglich garso häßlich sein!
Gestern abend gings in der Torggelstube dramatisch zu. Ich hatte auf dem Wege dorthin Steinrück und Dr. Goldschmidt getroffen. Als wir eintraten, sahen wir an einem Tisch allein Herrn Leonor Goldschmied sitzen, der den neuen „Kain“ las. Am Haupttisch waren Herr Grimm, der Ingenieur Lutz und noch einige um Jenny Vallière versammelt. Wir zogen daher vor, uns gesondert zu setzen. Nach einer Weile ging Dr. Brecher zu Goldschmied hinüber, und der begann jetzt mörderlich auf mich zu schimpfen, da er offenbar eben meine Notiz „der rührige Zensor“ gelesen hatte, in der ich Wedekind, Thoma u. s. w. angreife, weil sie seine Selbstanpreisung unterschrieben hatten, um gegen das Verbot der öffentlichen Verlesung seiner „Tragödie der Gewalt“ „die Entweihung der Erde“ zu protestieren. „Ich kenne diesen Menschen durch und durch“, tobte er so laut, daß ich jedes Wort hören mußte. „Wenn ich wollte, könnte ich ihn überall unmöglich machen und blamieren.“ Und dann: „Er ist nichts wie gelber Neid und Impotenz“. Ich reagierte natürlich mit keiner Bewegung. Der arme Kerl mit seiner krankhaften Aufdringlichkeit tat mir leid. Es ist am Ende ja doch rührend: seit 20 Jahren schreibt er, müht sich um literarisches Ansehen mit allem, selbst den unmöglichsten Mitteln, und nie ein Erfolg, nie auch nur eine Spur von Anerkennung seiner Person, an der ewig das Odium eines Spitzels hängt. Nein, nein – auf den armen Teufel habe ich keinen Neid. Als Steinrück und Goldschmidt fort waren – Leonor hatte seine Shakespeare-Maske schon vorher hinausgetragen – setzte ich mich an einen Ecktisch, wo Strauß und Muhr Écarté spielten. Strauß verlor ununterbrochen. Es war scheußlich. Über 700 Mark waren schon hin, und nur durch Muhrs Entgegenkommen hatte er Gelegenheit noch etwa 400 davon zu retten. Doch war mir Muhrs Art peinlich, der seine Anständigkeit fortwährend bestätigt hören wollte. – Während des Spiels erschien in der Tür die abgeschabte Gestalt des jungen van Hoddis, trotz der Hitze in einem dicken uralten Überzieher gehüllt. Kaum war er eingetreten, als vom Stammtisch her gerufen wurde: „Raus! Raus!“ und als der junge Mensch etwas erwiderte: „Raus! Hier wird nicht gebettelt!“ – Ich fuhr dazwischen und verbat diese Rohheiten, gab van Hoddis die Hand und bat ihn an unsern Tisch. Er zog es aber vor zu gehn, nachdem er mir gedankt hatte. Als später Grimm an unsern Tisch kam, der neben Lutz der Schreier gewesen war, verweigerte ich ihm die Hand und erklärte ihm, daß zwischen uns keine Beziehungen mehr sein können. Als er heute nachmittag mich im Hofgarten nochmal deswegen stellte, wiederholte ich ihm, daß ich mit Leuten nichts zu tun haben will, die sich derartig abgeschmackter Rohheiten schuldig machen. Dem Stammtisch wird es jetzt obliegen, sich für Herrn Grimm oder für mich zu entscheiden. Ich denke, man wird nicht lange wählen. Die Gegenwart dieses anschmeißerischen Sektreisenden ist schon lange den meisten widerlich gewesen.
Heut nachmittag spielte ich am Majors-Tisch Schach. Professor v. Stieler brachte den Geheimrat v. Thiersch an den Tisch; den berühmten Architekten. Ein sehr sympathischer alter Herr mit einem feinen klugen Kopf.
Strindberg ist tot – der letzte der ganz Großen. Nach Ibsen und Tolstoj nun auch Strindberg! Es ist noch kaum zu fassen, so sehr man in den letzten Wochen darauf gefaßt sein mußte. Wie ich ihn einschätze, dieses ungeheure Genie mit dem unsagbar häßlichen Weltbild, das will ich in der nächsten Nummer des „Kain“ hinzulegen versuchen.
In Paris haben sie nun auch die letzten der „Automobil-Apachen“ zur Strecke gebracht: Garnier und Vallet. Die Männer haben sich wie Löwen gewehrt und sind ebenso wie Bonnot erst durch großes Militäraufgebot und unter Anwendung von Bomben klein gekriegt worden. Wundervolle Kerle! Kein einziger von ihnen hat sich ergeben. Alle haben bis zum Tode gekämpft – und haben von ihren Feinden genügend mit hinübergenommen. Auch die Aufgabe, diese Prachtmenschen meinen Lesern als Idealisten hinzustellen, reizt mich. Die guten Spießer werden sich doch allmählich daran gewöhnen müssen, daß man ihnen ihre Moral mal von der Kehrseite her vorzeigt. Ich glaube, da schon jetzt ganz nützlich gewirkt zu haben.
München, Donnerstag, d. 16. Mai 1912.
Oh, ich Narr! ich Kind! ich Phantast! – Da nehme ich nun die Feder in die Hand, die vor Freuden zittert, und wie ich schreiben will, frage ich mich, ob ich mich denn so ausbündig freuen darf. Was ist denn geschehen, das mir diesen Tag wie den Geburtstag meines Glücks scheinen läßt? Nichts, als daß ich Mariechen wiedersah, und daß sie zu mir war wie immer und die Versprechen erneuerte, die sie schon halb gebrochen hatte. Weiß ich, wie lange ihr Entschluß vorhält? Aber ja! er wird vorhalten. So, wie sie heute zu mir sprach, so lügt man nicht. Ich kam vom Hofgarten aus ins Stefanie. Da saß sie mit ihrem Mann, Morax, Ida, Nitschke u. s. w. Sie begrüßte mich freundlich lachend, und sah in einem rosa Sommerkleid so süß aus, daß ich, selbst wäre ich böse gewesen, ihr nicht hätte zürnen können. Und dann sprachen wir viel und eingehend. Ihr Verhalten in diesen Tagen schob sie auf große Müdigkeit und Apathie. Auf meine Frage, ob sie an unseren Abmachungen festhalte, antwortete sie sehr lebhaft: ja! – Sie will blos erst – recht bald – nach Breslau, und wenn sie von dort zurückkommt, dann will sie dauernd bei mir sein. Ich sagte ihr, daß ich mich keiner Illusion hingebe, und voraussetze, daß sie mich nicht liebe. Sie sagte: „Was heißt lieben? Das ist so vorbei bei mir! Wenn ich nur jemand hab, mit dem ich mich verstehe und vertrage!“ – Wir verabredeten uns für heute abend bei Führmann und für morgen vormittag um 11 Uhr bei mir. Dann wollen wir Einkäufe machen. Ich ging nachher vom Schachspielen aus mit Roda und wollte zur Pension Führmann. Als ich durch die Herzogstrasse kam und beim Pünterplatz war, sah ich dahinter die Wiesen, von der Silhouette des Schwabinger Krankenhauses wundervoll eingerahmt, und bog über den Platz zur Clemensstrasse ab: Vor einem Hause am Pünterplatz hielt mich plötzlich der Ehemann Jung an. Er habe eben in der Pension einen Zettel für mich deponiert, daß Mariechen mich morgen um 11 Uhr im Stefanie treffen wolle. Sie habe sich zu Bett gelegt. Er erzählte, daß sie jetzt Pünterplatz 8 wohnen und forderte mich auf, noch etwas hinaufzukommen. Mariechen lag im Bett und sah ganz entzückend aus. Leider ließ uns der Mann fast garnicht allein. Nur einmal konnte ich ihr verstohlen einen Kuß auf die Backe geben. – Nun bin ich ganz glücklich heimgegangen, und mein Herz ist ganz voll von der lieben lieben Frau. Ach, ich weiß, daß wir glücklich miteinander auskommen werden. Sie hat viel gelitten, viel zu viel für ihre jungen Jahre. Da giebt es manches zu glätten und zu beruhigen, und das ist eine gute Aufgabe für mich. – Mariechen! Daß sie nur morgen wirklich kommt! Aber diesmal glaube ichs doch! Zumal ich ihr eine neue Kopfbedeckung versprochen habe.
Gestern gabs nicht mehr viel Erlebnisse. Nur ein Gespräch mit Halbe war mir interessant. Nach dem Kegeln waren wir im „Simpl.“ (wo ich nach Jahren den Pulvermann aus der Beutler-Zeit wiedersah. Er ist, wie er berichtete, jetzt in Berlin Advokat). Das Gespräch mit Halbe kam irgendwie auf Ewigkeitsfragen, und Halbe und ich fanden uns in der gleichen Lebensanschauung, der die Irrealität der Zeit Voraussetzung aller Empfindung ist. Nur daß Halbe meinte, alle Sympathie und Antipathie beruhe auf verborgenen Erinnerungen an frühere Lebensepochen, wies ich als Spekulation zurück. Ich freute mich jedenfalls des Ernstes, mit dem Halbe solche Dinge durchdenkt. Denn unsere übrigen „Geistigen“ sind über ihre Spezialbeschäftigungen hinaus meistens entsetzlich oberflächlich.
Jetzt ists ¼ nach 9 Uhr – und ich gehe ins Torggelhaus Abendbrot essen. Heute, hoffe ich, wirds mir schmecken.
München, Sonntag, d. 19. Mai 1912.
Es ist wieder genug zu notieren von den zwei unausgefüllten Tagen. Zunächst zum Kapitel Margot Jung. Am Freitag rief sie vormittags an, sie erwarte mich im Stefanie. Sie war dort mit ihrem Mann. Dem gab ich 3 Mk, damit er dafür Mariechens Mantel aus dem Leihhaus hole, denn es war kalt und regnete. Als er zurückkam, ging ich mit ihr fort, einen Hut kaufen. Wir fanden einen so billigen, daß sie gleich zwei von der Sorte erstehen wollte. Davon brachte ich sie aber ab, und wie recht ich hatte, merkte ich nachher auf der Straße, als sie plötzlich zu jammern anfing, dieser Hut gefalle ihr garnicht. Sie wolle einen andern haben. Also richtig wurde in einem andern Geschäft noch ein Hut für 10 Mk gekauft, den sie gleich aufsetzte, und über den sie sich anscheinend freute. Aber die arme Frau muß schon sehr unglücklich sein, da sie fortwährend neue Sachen wünscht und sich nie richtig freuen kann, wenn sie sie hat. Wir kauften noch Strümpfe für sie und verabredeten uns für den Nachmittag im Café. Dort war sie auch, nahm mir aber übel, daß ich anfing, mit Morax Schach zu spielen und ging mit dem Versprechen, in einer Viertelstunde wiederzukommen. Natürlich kam sie nicht und blieb auch gestern unsichtbar. Heut war sie wieder im Café. Es war wunderschönes Wetter. Ich forderte sie auf, mit mir in den Hofgarten zu kommen. Sie wollte nicht. Ich ärgerte mich und ging allein. Als es mir, sehr bald, leid tat und ich zurückkam, war sie fort.
Freitag abend abonnierten zwei Herrn auf den „Kain“, die mir das Geld gleich gaben. Leider verspielte ich das ganze abends in der Torggelstube im Écarté, sodaß ich fast nichts übrig behielt.
Gestern kam mittags ein junges Mädchen zu mir, eine hübsche Jüdin, namens Jenny Brünn aus Königsberg. Sie interessiert sich für den Sozialistischen Bund und ich begleitete sie nachher in die Barerstrasse. Sie soll, da wir demnächst wieder eine Zusammenkunft veranstalten wollen, eingeladen werden. – Nachmittags war ich im Marionettentheater von Papa Schmidt wo in einer Sondervorstellung für Studenten Simrocks „Johann Faust“ gespielt wurde. Es war entzückend. Unendlich naiv und heiter. Wenn man so etwas sieht, merkt man erst, wie unkultiviert die Menschen in unserer Kino-Zeit geworden sind. Morgen soll ich das Marionettentheater von Paul Brann in der Ausstellung (die gestern eröffnet wurde) sehn – eine Veranstaltung des Neuen Vereins. – Abends fuhr ich mit Walter Meyer nach Pullach zur Habenschaden-Feier. Es war großer Betrieb – sehr viele Bekannte, sehr viel schöne Mädchen. Ich war erst in der Gesellschaft Roda Roda, Weisgerber, Arnold etc., nachher mit dem Ehepaar Götz und etlichen Damen. Frau Fanny versichert mich nach wie vor ihrer Liebe und scheint zu beabsichtigen, mich mal wieder zu besuchen. – Um 10 Uhr zurück. Später Torggelstube, schließlich mit Steiner eine Billardpartie im Café Orlando di Lasso.
Sehr bewegt bin ich durch einen allarmierenden Brief aus Lübeck, der mich die Revolution meines Daseins in greifbare Nähe gerückt scheinen läßt. Julius berichtet, daß Papa in den allerletzten Tagen wieder so mit seinem Herzen zu tun hat, daß die günstige Prognose, die er bei Papas starker Natur stellen zu können glaubte, sehr getrübt wird. Herzbeklemmungen, Atemnot und darauf folgenden schweren Erschöpfungszuständen, kurz: das Bild einer bedenklich vorgeschrittenen Arteriosklerose. Papa ist mit Grethe in Eutin, und will dann nach Mölln, da er weitere Reisen offenbar nicht mehr unternehmen kann. – Heut traf ich im Hofgarten Vetter Walter Mühsam. Er erzählte, daß Charlotte in der Hoffnung sei und für Mitte Juni ihre Niederkunft erwartet werde. Auch seine Frau sei schwanger. Ich soll sie im Juni kennen lernen.
Donnerstag lesen Steinrück und B. v. Jacobi in den Vier Jahreszeiten für den Neuen Verein aus Werken Münchner Autoren. Auch ich stehe unter den 12 Namen derer, die zu Wort kommen sollen. Ich traf heute Jacobi, der mich bat, ihm noch ungedruckte Gedichte zu schicken. Ich will jetzt an die Arbeit, ihm welche abzuschreiben. Man soll doch nichts versäumen, was vorwärts helfen könnte.
Die Kassenverhältnisse sind weiter ganz traurig. Ich mußte heute schon wieder den Kellner Julius um 5 Mk anpumpen. Morgen hoffe ich Sobotka mein Szenarium für die zum Schwank umzuwandelnde Operette „Cherchez la femme“ vorlegen zu können und womöglich gleich Geld zu kriegen. Lange wird dieses Elend nun wohl nicht mehr dauern. – Und dann: Mariechen! Dann geht eine Ehetragödie an, die ich ebenso herbeisehne wie mir davor graust.
München, Dienstag, d. 21. Mai 1912
Über der Versäumnis, hier einzuschreiben, vergaß ich eine Tatsache zu vermerken, deren Registrierung meine Pedanterie durchaus erfordert: einen Koitus. Am Freitag nachmittag fragte mich im Café die kleine Maxi, ob sie mich nicht wieder einmal besuchen dürfe. Ich lud sie natürlich gleich zum Abendbrot ein, an das sich dann das übliche reizvolle Dessert im Bett anschloß. Sie ist ein reizender kleiner Teufel.
Nach dieser Pflichterfüllung weiter im Text, der Mariechen heißt. Momentan erwarte ich sie zum Mittagessen bei mir und bin ungeheuer gespannt, ob sie kommen wird. Versprochen hat sie es ganz fest. Gestern war ich den ganzen Nachmittag mit ihr beisammen. Verliebt bin ich nachgrade genug, und dabei sehe ich mit ungeheurer Deutlichkeit, wie greulich mir diese Liebesgeschichte zusetzt, wie ich hauptsächlich materiell immer mehr dadurch in Teufels Küche gerate. Hätte ich nur erst das Billet nach Breslau für sie! –
Ich war – um chronologisch zu berichten – Sonntag abend in der Torggelstube. Steinrück saß da mit Willy Lang, und mir fiel ein, daß Steinrück am 20ten seinen 40ten Geburtstag hätte. Ich ging also punkt 12 mit meinem Glas zu seinem Tisch hinüber und wir waren nachher sehr lustig zusammen und tranken auf Kosten des Jubilars eine Menge amerikanischen Sekt. Gestern vormittag saß ich, da ich um ¾ 1 bei Sobotka im Verlage sein sollte im Stefanie mit Götz zusammen. Plötzlich sah ich auf der Straße Hermann Bahr vorbeigehn, stürzte ihm nach und holte ihn ins Café. Nachher gingen wir beide miteinander fort unter sehr guten Gesprächen. Ich hatte Bahr seit Jahren nicht mehr gesprochen und freute mich herzlich des Wiedersehns. Was er sagt, ist nie von bedeutender Tiefe, aber immer von erlesenem Geschmack und niemals kommt eine Dummheit über seine Lippen. – Alsdann: Dreimasken-Verlag. Ich legte Sobotka mein Szenarium vor. Morgen soll ich wieder anrufen. Zunächst erhielt ich 20 Mk. – Ich aß im Torggelhaus Mittag, trank im Hofgarten Café und traf dann Mariechen im Stefanie. Ich ließ merken, daß ich etwas Geld hatte und sie jammerte nach Schuhen. Wir liefen lange herum, ohne zu finden, was sie suchte. Nachher bettelte sie mir einen erheblichen Teil des Geldes in bar ab, ich brachte sie zum Stefanie zurück und fuhr zur neu eröffneten Ausstellung hinunter, wo ich zuerst mit Dr. Wenter und Queri vor dem Theatercafé saß – nachdem ich flüchtig durch die Ausstellungsräume gegangen war, und dann der Vorstellung von Branns Marionettentheater beiwohnte, die für den Neuen Verein veranstaltet wurde. Zuerst gab es zur Feier von Schnitzlers 50tem Geburtstag dessen Stück „Der tapfere Cassian“, sehr nett, aber nicht aufregend gut. Dann aber Adams „Die Nürnberger Puppe“, eine entzückende Arbeit mit wundervoller graziöser Musik. Ich unterhielt mich ausgezeichnet. – Einen Vergleich mit Papa Schmidts Marionettentheater hält Branns Bühne nicht aus. Seine Arbeit ist zu raffiniert, zu gekonnt und etwas zu kunstgewerblich. Die große Naivetät, die zu solchen Unternehmen gehört und Papa Schmidts Theater den Charme gibt, fehlt da draußen. – Übrigens erfuhr ich nachträglich, daß der 92jährige Papa Schmidt am Sonnabend noch selbst den Kasperle gesprochen hat, und zwar zum letzten Male in seinem Leben. Umso mehr freue ich mich, zum ersten Mal grade an diesem Tage dort gewesen zu sein. Ich fuhr dann mit Strauß und dem Ehepaar Albu ins Torggelhaus und ging von dort zum Ratskeller ins Krokodil, wo ich sehr ausgelassen war. Als wir dort aufbrachen, um noch zum Bunten Vogel zu gehn, pumpte ich unterwegs Jodocus Schmitz um 20 Mk an. Ich habe aber jetzt einiges in Sicherheit gebracht, damit mir Mariechen nicht gleich wieder alles abnimmt.
Sie scheint mich wieder zu versetzen. Um 1 Uhr wollte sie hier sein. Jetzt ist es schon ¼ nach 1. Kommt sie nicht mehr, so mache ich ihr doch mal Krach. Allzu chikanös will ich doch nicht mit mir verfahren lassen.
Einen sehr überraschenden Brief fand ich heute nacht, als ich heimkam, vor: von Dr. Kilian, dem Oberregisseur des Hoftheaters. Er fordert mich auf, ihm mein Stück, auf das ihn sein Vetter Haas vom Deutschen Theater in Cöln aufmerksam gemacht hat, einzureichen, „da es meine Absicht ist, alle modernen Münchner Autoren von Bedeutung unserem Residenztheater allmählich zuzuführen und es mir von besonderem Wert wäre, auf Keyserling, Wedekind, Ruederer auch Ihren Namen gelegentlich folgen zu lassen.“ – Selbstverständlich soll er die „Freivermählten“ haben. Ob aber das Münchner Hoftheater das Stück spielen wird, darin will ich mich keinen Illusionen hingeben. Auch die „Hochstapler“ will ich für alle Fälle mit einreichen lassen. Jedenfalls freue ich mich aufrichtig über den Brief. – Von Johannes kam ein Brief. Er legt die Bilder von Bonnot, Garnier und Vallet bei, und beschwert sich über meine Säumigkeit. Ich bin allerdings sträflich schreibfaul. Selbst der armen Margrit habe ich auf ihren lieben Brief aus dem Gefängnis noch nicht geantwortet.
München, Mittwoch, d. 22. Mai 1912.
Mariechen kam gestern mittag nicht mehr. Als ich sie nachher im Café traf, lachte sie mich freundlich an und erzählte, sie habe über den ganzen Mittag geschlafen. Ihr geht’s mit den Nerven so böse, daß ich ihr um keiner Rücksichtslosigkeit willen zürnen kann. Ihr Kind, ein einjähriger Bube, ist krank. Sie erfuhr erst in diesen Tagen, daß das arme Wurm die englische Krankheit hat und noch nicht einmal sitzen kann. Sie war sehr traurig darüber. Dabei brutalisiert sie der Mann immer noch, und ihre ganze Sehnsucht ist, endlich wirklich nach Breslau abfahren zu können, sich mit ihren Schwiegereltern auseinanderzusetzen und das Kind zu sich zu nehmen. Ich habe ihr angeboten, daß ihr Kind bei uns sein könne, sobald wir vereint sind. Wir gingen wieder Einkäufe machen. Da ich aber nur einen Teil meiner Barmittel eingestand, ging es billig ab. – Zum Abendbrot kam der junge Tarrasch mit einer neuen Freundin zu mir, die auf den Namen Mary hört: ein reizendes Geschöpfchen, sehr schlank, zierlich, lebhaft und durchaus nicht prüde. Sie ließ sich von mir reichlich abküssen und überall anfassen. Doch beichtete sie, daß sie einen Tripper hat, sodaß sexuell zur Zeit nichts mit ihr anzufangen ist. Das arme Tier: wird aber vorgemerkt.
Heut war ich nun wieder bei Sobotka auf dem Verlag. Zuerst sprach ich dort mit Lodygowsky und Schaumberger. Die sagten mir schon, daß mein Szenarium für „Cherchez la femme“ doch nicht gefalle. Man wünschte eine völlige Neubearbeitung statt der von mir gedachten Zubereitung der alten Vorlage für die Bühne. Mit Sobotka hatte ich dann eine ausführliche Auseinandersetzung über meinen Dalles. Ich erklärte ihm, daß mir ein gelegentliches 20 Mark-Stück nicht viel weiterhülfe und wollte sofort einen größeren Arbeitsauftrag. Auch bot ich an, für die Vorschußsumme, die man mir geben werde, einen Schuldschein auszustellen, was aber alles vorläufig abgelehnt wurde. Die Unterredung regte mich sehr auf. Einmal waren mir die Tränen nahe. Es ist schon ungeheuerlich von meinem Vater, daß er sich damals jenen Verzicht auf den Häuseranteil zu seinen Gunsten ausstellen ließ, und darauf gestützt mich so demütigen Situationen aussetzt. Überlege ich mir manchmal diese ganzen Zusammenhänge, und daß ich seit 13 Jahren ein vermögender Mann bin, ohne je wirklich finanzielle Ungebundenheit kennen gelernt zu haben, dann packt mich doch eine Riesenwut an und mein Wunsch, der Vater möchte abtreten, um meiner Entwicklung Platz zu machen, scheint mir von jeder Häßlichkeit, Undankbarkeit und Gemütlosigkeit gereinigt.
München, Donnerstag, d. 23. Mai 1912.
Meine Situation beginnt allmählich, mich sehr zu ängstigen. Die Aussicht, regelmäßig vom Dreimasken-Verlag als Lektor beschäftigt zu werden, ist wieder ziemlich dahin. Nachdem mir bis jetzt bei jeder Mahnung, mir Stücke zum Lesen zu schicken, gesagt war, man werde mir welche schicken, hörte ich heute von Schaumberger, es sei alles aufgearbeitet, und der Einlauf sehr gering. Sobotka, den ich heut wieder aufsuchen sollte, war nicht da, und, wenn ich heut nachmittag wiederkomme, wird er wohl auch nicht der Retter in der Not sein. Roda Roda ist für 14 Tage verreist, sodaß der Plan, mit ihm ein Stück zu schreiben, mindestens hinausgeschoben werden muß, und so wird mir wohl nichts übrig bleiben, als wieder allerlei Kleinigkeiten für den „Pan“, der Beiträge von mir will, für den „Simpl.“, der mich schon monatelang auf den Abdruck des einen Gedichts warten läßt und sonstige Blätter, die ich noch nicht beglückt habe, zu schreiben. Das „Scheinwerfer“-Buch muß bis zum 15. Juni abgeliefert werden. Das Geld dafür kann mir also vorerst auch noch nichts nützen. Ich sehe somit der Woche bis zum Monatsersten und dem Tage besonders, an dem ich Johannes seine 50 Franken und der Pension etwa 160 Mk von den 175 Mk zahlen soll, die dann kommen werden, mit rechter Sorge entgegen. Und Mariechen ist immer noch in München. 50 Mk brauchts, um sie in die Bahn zu setzen, und dann soll ich sie ganz in meine Obhut nehmen – mit Kind – und weiß doch noch nicht einmal, wie ich mir selbst weiter helfe. Wie ich den Tag der Erlösung herbeisehne! Endlich ohne Angst um das tägliche Leben arbeiten dürfen, was meine Künstlerschaft verlangt! Endlich Dichter sein dürfen statt literarischer Strichgänger. Aber ich weiß: lange werd ich jetzt nicht mehr zu warten brauchen. Das neue Leben ist so vorbereitet, daß nur noch die Tore aufzuwerfen sind. Ein neuer Mühsam, ein besserer und schönerer, wird es empfangen.
München, Freitag, d. 24. Mai 1912.
Von Sobotka erhielt ich gestern abend 50 Mark Vorschuß aus der Privatschatulle. Ich soll nun „Positives“ für den Verlag tun. Was? weiß ich noch nicht. Vielleicht gehe ich mal wieder an den Entwurf der Kriminaloperette, der seit einem Jahr fast ruht. Wenigstens markieren will ich, um dort etwas herauszuschinden und zu versuchen, mit Anstand aus den bodenlosen Schwierigkeiten herauszukommen, in die mich die Freundschaft mit Mariechen gebracht hat. Schon mahnt der Schuster mit 24 Mk 40 „nur der Ordnung wegen“ heißt es höflich auf der Rechnung. Ja, erst muß mal Mariechen in Breslau sein, vorher kann ich an Schuldenzahlen nicht denken. Sobotka machte mir den Vorschlag, in dem „Kain“ einen Artikel über die „Circe“-Aufführung im Künstler-Theater zu schreiben, der sich zu Propaganda-Zwecken eignet. Der Verlag werde dann die ganze Auflage aufkaufen und sich nobel zeigen. Ich hatte gottseidank Festigkeit genug, diesen Vorschlag sofort zurückzuweisen. Mein „Kain“ soll denn doch die Zuflucht meines besseren Teils bleiben. Da sei mir alles fern, was nach Korruption riecht. – Am Abend war der Münchner Autoren-Abend. Steinrück und v. Jacobi rezitierten Gedichte von Henckell, Gumppenberg, Schanderl (St.), Halbe, eine Novelle von Heinrich Mann, Mühsam, Brandenburg, Weigand (J.), Wedekind, Owlglas, Thoma (St.). Steinrück gab noch ein Gedicht von Tim Klein und zwei von Wilhelm Schulz zu. Steinrücks Vortragskunst ist außerordentlich wirksam (ich hörte ihn zum ersten Male rezitieren.) Man kann im Zweifel sein, ob seine Art die richtige ist: er ist ganz Schauspieler, der mit ganz starken stimmlichen Modulationen arbeitet. Bei einem Gedicht von Gumppenberg „Liselotte“, das die Beweinung einer Gestorbenen ist, hatte er wirkliche Tränen und Töne der wildesten Verzweiflung. Vielleicht soll man bei Rezitationen nur sprechen. Aber mir gefällt sein Vortrag, weil er so erschütternd und mitreißend ist. Jacobi ist viel eher Vortragskünstler. Er verzichtet auf ganz starke Effekte und erzielt seine guten Wirkungen durch deutliche Hervorhebungen in der Betonung der Worte. Bei Heinrich Manns herrlicher Novelle „Ein Gang vors Tor“ (die zur Rezitation sehr ungeschickt ausgesucht war) versagte er leider, weil er die Akustik des Saales falsch taxierte und schneller sprach als die Resonnanz des Raumes erlaubte. Von mir trug er das Gedicht „Golgatha“ aus dem Kain-Kalender vor, ohne mich sonderlich zu entzücken. Vor der Zeile „Ein Jude zog aus von Nazareth“ schob er ein Possartsches höhnisches Hah! ein, das mir ganz unmotiviert schien. Ich hätte grade die Schlußzeilen ganz resigniert und fast tonlos gesprochen. Es soll doch darin nur gesagt sein: so wie dem Manne, der da zu den Allerärmsten geht und verhaftet wird, ist es dem Juden von Nazareth auch ergangen und wird es jedem ergehn, der es unternimmt, Erlöser spielen zu wollen. Als zweites brachte er mein allerneuestes Gedicht „Nein, ich will nicht eher zu Grabe“, dem ich die Überschrift „Testament“ gegeben habe. Das trug er ausgezeichnet vor und erzielte eine große Wirkung auf die Zuhörer. Mir war merkwürdig zu Mute dabei, denn ich kannte das Gedicht selbst noch nicht recht, dazu ist es zu jung, und merkte da plötzlich, daß es wirklich schön ist. Ich bin recht zufrieden, denn der Beifall, den Jacobi mit meinen Gedichten hatte und der neben den von Steinrück gebrachten Wedekindschen Humoristicis der stärkste des ganzen Abends war, bedeutet für mich einen starken moralischen Erfolg. – Nachher war alles in der Torggelstube, und es war seit langem dort wieder mal ein schöner Abend, der an vergangene gute Zeiten erinnerte. Gustel Waldau war da und Ludwig Thoma und noch viele. Wir sangen die Lammer-Lammerstrat und sonstige Lieder wie dunnemals und Steinrück und Gustel brachten das bewährte „Herbsteln tut’s“. – Erst um 3 Uhr trennten wir uns. Ich ging mit Dr. Frisch heim, der mir in einem heftigen Disput mit Steinrück über die Pariser Automobil-Apachen sekundiert hatte. Besonders freute mich da die Haltung der kleinen englischen Königsschülerin, die mir vis-à-vis saß und ihr Urteil über Bonnot und Garnier in die Worte zusammenfaßte: „Das sind doch Menschen“. – Meine Leser sollen sich wundern.
Thoma hatte mich ermutigt, den „Simpl“ heute wegen eines Vorschusses zu besuchen. Ich schrieb deshalb in der Frühe das Gedicht „Margot“ auf und eine Anekdote (die wahre Geschichte mit dem Pastor im Bethanien-Krankenhaus, die ich vor Jahren schon mal im „Ulk“ hatte) und brachte sie hin. Der Besuch trug 30 Mark und eine Auseinandersetzung mit Dr. Geheeb, der mich anfangs nicht sehr liebenswürdig behandelte, zu verstehen gab, daß er mir nur „aus Gefälligkeit“ Beiträge abnehme, und dann, als ich ihm deutlich sagte, ich sei nicht der Erstbeste und fände, daß meine Beiträge dem „Simpl“ heut so wenig schaden könnten, wie damals, sehr freundlich wurde, sodaß ich nun doch wohl öfter etwas von dort werde kriegen können. Ich schlug vor, man solle mir Zeichnungen zum Textieren geben.
Mit Mariechen hatte ich gestern verabredet, daß ich ihr schreiben solle, wenn Geld da sei. Sie werde dann zu Tisch zu mir kommen. Jetzt ist’s 1 Uhr. Ich habe ihr geschrieben, aber vorläufig ist sie nicht da. Kommt sie, so kann sie morgen früh abreisen. Kommt sie nicht, so werde ich mir noch sehr überlegen, ob ich die ganzen 80 Mark wieder für sie ausgeben soll. Daß sie mir niemals die Möglichkeit giebt, mit ihr allein zu sein, ärgert mich nachgrade. Wenn sie doch entschlossen ist, sich mir mit ihrer ganzen Person anzuvertrauen, dann brauchte sie sich am Ende auch jetzt schon nicht vor Zärtlichkeiten zu fürchten. Versetzt sie mich heute wieder, so werde ich doch wohl endlich die Energie finden, die Beziehung, bei der ich so absolut schlechte Geschäfte mache, auf andre Grundlagen zu stellen. Heute werde ich ihr sagen, daß ich nicht länger mit mir spielen lasse.
München, Sonnabend, d. 25. Mai 1912.
Mariechen hat meinen Brief nicht erhalten, und so konnte ich ihr auch keinen Krach machen und sitze wieder da und warte, ob sie kommt. Es ist kurz nach 1 Uhr und sie versprach, sie werde zwischen 1 und 2 Uhr „einlaufen“. Aber ausgerechnet heute wäre es mir garnicht so unlieb, wenn sie nicht käme. Denn gestern kam zu meinem Erstaunen ein Brief von Jane, die mir mitteilt, ihr „loup garou“ sei heute mittag eingeladen und sie werde tout de suite après diner zu mir kommen „Une petite visite tout simplement sans rien d’autre ...“ Die baisers, mit denen sie früher ihre Briefe zu schließen pflegte, sind durch „Bien des choses“ ersetzt. Selbstverständlich werden die beiden Mädels jetzt kollidieren und ich werde von keiner etwas haben. Aber natürlich: Mariechen ist in langen Wochen nicht zu bewegen, bei mir einmal zu speisen und sagt endlich für einen Tag zu, an dem nach langen Monaten sich Zaza entschließt, mal wieder bei mir vorzusprechen. Ob es wohl einen verpechteren Menschen auf der Welt giebt als mich? – – Mariechen kam gestern erst am späten Nachmittag ins Café und war sehr beglückt, als sie erfuhr, daß ich das Reisegeld für sie habe. Wir fuhren sofort zur Bahn hinunter und kauften das Billet. Jetzt muß sie binnen 3 Tagen abfahren, wenn nicht das Billet die Gültigkeit verlieren soll. Ich habe allerdings trotzdem starke Zweifel, ob sie fahren wird. Entweder verliert sie noch rechtzeitig das Billet, oder es stellen sich zwingende Gründe ein, es verfallen zu lassen und meine 27 Mk sind beim Teufel. – Ein schmerzliches Geständnis legte sie mir ab. Wedekinds „Franziska“ mit der schönen Widmung an mich werde ich nicht wiedersehn. Sie hat das Buch angeblich auf einer Wiese verloren. Ich ließ sie nicht merken, wie unglücklich ich war. – Nachher mußte ich dem Leihhaus 10 Mk 80 bezahlen, wofür sie eine Reisedecke und ihren Paletot auslöste. Dann begleitete ich sie heim. Nun bin ich neugierig, ob sie kommt.
Abends war die Gruppe Tat mal wieder in den Gambrinus gerufen worden. Leider waren im ganzen nur 8 Leute da, und wir beschlossen, nächste Woche noch einmal zu versuchen, mehr Leute herbeizurufen. München ist kein Boden für eine revolutionäre Bewegung. Ich habe nicht mehr viel Vertrauen zu einer Neubelebung der Gruppe. Morax ist auch nicht mehr der Alte. Aus dem rebellischen Charakter ist ein zärtlicher Artist geworden. Schade.
Abends Torggelstube. Gumppenberg dozierte. Es war ziemlich öde. Nachher verlor ich gegen Weigert im Orlando di Lasso 3 Mk im Écarté.
Mit dem Autoren-Abend habe ich einen starken persönlichen Erfolg gehabt. Die Zeitungen müssen konstatieren, daß ich die stärkste Wirkung von allen ausgeübt habe. Ich glaube, das kann recht nützlich sein.
München, Sonntag, d. 26. Mai 1912.
Pfingstsonntag. Aber mir ist garnicht pfingsttäglich zu Mute. Ich lebe in Angst und Aufregung. Zwar habe ich noch 20 Mk, die ich vor Mariechens spähenden Blicken verbergen konnte, aber, wie alles jetzt werden soll, ist mir ganz rätselhaft. Von der Zeit bis zum 1. Juni ganz abgesehen – aber dann: Die verfluchten Schulden, und die verfluchte Aussichtslosigkeit, außer von Waidmannslust noch Geld zu kriegen. Ich muß mal wieder ganz resigniert abwarten und alles an mich herankommen lassen. Vielleicht ist ja die Hilfe, die mir aus allem Ungemach helfen kann, ganz nahe. Freilich habe ich in den letzten Tagen aus Lübeck keinerlei Nachricht, und das bedeutet gewöhnlich, daß kein Grund zum Schreiben sei. Jedenfalls werde ich mal wieder bei Julius anfragen, wie es steht.
Gestern mittag kam Mariechen natürlich nicht mehr. Aber Jane kam. Sie war vergnügt, munter, hübsch, doch aber nicht mehr ganz so zierlich-entzückend wie früher. Ich fürchte, sie wird in ihrer monogamischen Ehe mit dem argentinischen Béguin allmählich etwas behäbig-bürgerlich werden. Aber sie war sehr nett, erzählte viel, flatterte umher, setzte sich mir auf den Schoß und ließ sich zum Abschied sogar wieder den Mund küssen, nachdem sie vorher nur Hals und Backen dazu hingehalten hatte. Über Mariechen war ich recht böse, obwohl es mir recht war, daß sie nicht in Janes Besuch hineingeplatzt war. Ich suchte sie im Café, wo ich von einer dicken Dame angesprochen wurde, der Mutter des verhafteten Tanzlehrers Hieber. Ich mußte mir die ganze Leidensgeschichte der armen Frau anhören, ohne sie viel trösten zu können. Wenn die Dinge wirklich so arglos liegen, wie sie sie darstellt, so wird dem Sohn (der mir übrigens reichlich unsympathisch ist) wohl nicht viel passieren. Er soll seine kleinen Tanzschülerinnen bei ihren Nackttänzen angefaßt haben. Dann hielt das Puma mich fest. Ich möchte sie ein paar Schritt begleiten. Sie kaufte Pralinés ein. Sie erzählte mir kleine Erotica. Mariechen kam erst am Spätnachmittag ins Café. Sie habe Rhizinusöl gebraucht und deshalb nicht zu mir kommen können. Ich habe ihr angedeutet, daß ich bei Fortsetzung ihres rücksichtslosen Benehmens eines Tages Schluß in unserer Beziehung machen werde. Aber sie lacht mich jedesmal wenn ich ärgerlich werde, so lustig an, daß ich nicht viel mehr sagen kann. Sie wollte zur Bahn, ihr Billet prolongieren lassen, da der Mann hofft, ihr am 1. Juni 30 Mk geben zu können. Prolongation gab es nicht und so bekam sie das Geld für das Billet 26 Mk 10 Pf heraus. Ich bat sie, das Geld mir zu geben, dann werde sie ihr Billet kaufen können, wenn sie es brauche. Sie ließ sich aber auf nichts ein und hat jetzt das Geld. Ich versicherte ihr, daß sie von mir kein Geld für ein neues Billet zu erwarten habe. – Ich hatte mir nachmittags vom Dreimasken-Verlag zwei Billets für das Künstlertheater geholt. Mariechen wollte nicht mit, zumal sie nicht entsprechend angezogen war, so nahm ich Mary mit, die ich dort ohnehin für den Chor empfehlen wollte. Ich fuhr im Auto mit ihr hinaus, was viele hübsche Küsse eintrug. Von der Aufführung war ich nicht sehr entzückt. Die Regie nicht gekonnter Reinhardt. Die Kostüme aus allen Zeiten der Weltgeschichte zusammengestopft. Das Stück selbst tötlich langweilig (Calderons „Circe“), und erfreulich nur die Durieux als starke Circe und Pallenberg als melancholischer Clown Clarin. Stägemann als Ulysses ein lyrischer Tenor, alles andre mäßiger Durchschnitt. Und darüber sollte ich in den „Kain“ einen Reklame-Artikel schreiben! – Im Foyer traf ich Paul Cassirer mit Franz Blei. Nachher, nachdem ich Mary abgesetzt hatte, Torggelstube, wo es ganz nett war. Bemerkenswert neben den Damen Wickelsworth, v. Jacobi und Maya eine entzückende junge Person, ein Fräulein Auspitzer, Tochter eines Generalkonsuls, sehr schön, sehr reizvoll, mit einer Sprache wie die Gräfin und herrlich tiefen blauen Augen. Ich war ganz begeistert von der jungen Dame, die leider in Begleitung ihres Bruders war. – Zugänglich wäre sie für mich wohl auch sonst nicht gewesen.
München, Montag, d. 27. Mai 1912.
Gestern sah ich Mariechen nur von weitem. Sie ging ins Café hinein, als ich grad mit dem Puma in eine Droschke stieg, um sie zum Dachauer Zug zu begleiten. Auch sonst passierte nichts aufregendes. Erfreuliches brachte erst die späte Nacht, als ich Weigert in Écarté 5 Mk abgewann.
Heut liegt der größte Teil des Tages hinter mir. Ich erwarte mein Abendbrot. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich in Gesellschaft des Ehepaares Jung in der Ausstellung. Vorher hatte ich mit Mariechen im Stefanie eine kurze Aussprache. Sie versicherte mir von neuem, sie sei mit dem Manne völlig einig, daß sie sich trennen werden, und vertrage sich jetzt ganz gut mit ihm, da es ja keinen Sinn mehr hat, sich zu zanken. Es bleibe also auch, wenn ich wolle, bei unserer Verabredung. Ich sagte ihr, daß ich ihr keineswegs alles glaube, was sie mir erzähle und schenkte ihr 3 Mk. Inzwischen meldete sich ein junger Mann bei mir, der mir einen Brief von Przybyszewski überreichte. Przybyszewski empfiehlt ihn mir darin als sehr begabten Dichter, namens Teofil Lenart. Ich möchte ihm, während er (Prz.) verreist ist, das ist einen Monat hindurch, mit meinem Rat beistehen. Der junge Mann selbst machte mir einen guten Eindruck. Ein offenes kluges Gesicht mit viel Wärme und Güte. Er hat ein Stück geschrieben, das der Erdgeist-Verlag edieren will, falls er die Kosten durch Subskriptionslisten garantieren kann. Ich versprach, ein Exemplar zu 1 Mk 20 zu subskribieren und, falls ich das Stück gelesen habe, und es gut finde, im „Kain“ Subskribenten zu werben. Auch forderte ich ihn auf, mich zu besuchen.
Dann also mit den Jungs in die Ausstellung. Mariechen war ganz wild auf die Tombola-Lotterie und wir mußten 3 Lose kaufen à 1 Mk – natürlich lauter Nieten. Mit dem Gatten war sie so vertraut, daß ich an ihrer Behauptung, daß ihr Zustand ihr noch keinen sexuellen Verkehr erlaube, und daß ihr Zusammensein mit Jung von jeder sexuellen Gemeinschaft ausgeschlossen sei, starke Zweifel spürte. Ich bin sehr neugierig, wie lange das schöne Weib noch mit Glück auf meine Dummheit spekulieren wird und wie diese Freundschaft ausgehen wird. Vorläufig ist mir die ganze Geschichte doch viel zu interessant, als daß ich einfach meiner Wege gehn möchte. Wäre sie blos nicht so unerhört kostspielig!
München, Mittwoch, d. 29. Mai 1912.
Mit Mariechen nichts neues. Wir waren gestern nachmittag zusammen in der Stadt, Stiefel für den Ehegatten einkaufen. Sie erzählte, sie hätten schon wieder Krach gehabt, und er werde, sobald sie nach Breslau fort sei, nach Leipzig oder Berlin gehn. Als ich neue Zweifel aussprach, ob sie wirklich mit mir leben wolle, antwortete sie – und mir gefiel die Offenheit, mit der sie alle Gefühlsmomente ausschaltete, „Wo soll ich denn sonst bleiben? Ich bin ja froh, daß du da bist.“ Leider scheinen die Folgen der Geburt noch nicht ganz überstanden zu sein. Sie klagt viel über Magenschmerzen und erzählt, daß sie sich gestern und vorgestern nacht furchtbar erbrochen habe. – Wie sich die Geldverwirrungen entwickeln werden, sehe ich garnicht ab. Der Dreimasken-Verlag schickt mir trotz aller Mahnungen keine Stücke mehr, wieder zum „Simpl.“ zu gehn, ist mir gräßlich, und sonst habe ich nirgends etwas zu erwarten. Zwar habe ich dem „Pan“ die erste Szene des zweiten Aktes von „Glaube, Liebe, Hoffnung“ geschickt, die vielleicht 60 Mk bringen kann, aber wer weiß, ob sie genommen wird und wann man sie bringt und zahlt. Inzwischen kassiere ich fortwährend Abonnements für den „Kain“ ein, die ich unterschlage, ich glaube, ich habe schon an 20 Mk abzuliefern. Es ist immer scheußlicher. Und von Lübeck keine Nachrichten, also vermutlich vorläufig keine guten oder schlechten Aussichten. – Gestern abend soupierte ich (nachdem ich mit dem von Italien zurückgekehrten Dr. Gotthelf ein Begrüßungsschach gespielt hatte) bei Roda Roda. Der üble Färber-Färber war auch wieder da, ein peinlicher Esel. Später Torggelstube, wo ich mich stundenlang nur mit der reizenden Hamburgerin Lene Körting unterhielt. Ich bin höllisch scharf auf die Frau, sehe aber ein, daß da garnichts zu machen sein wird. – Vom Gericht bekam ich die Urteilsbegründung wegen der Bahnhofsgeschichte. Sehr lustig. Ich werde sie im „Kain“ entsprechend glossieren. Heut oder morgen fange ich mit der neuen Nummer an, und bis zum 15ten Juni muß ich auch das „Scheinwerfer-Buch“ fertig machen. Dies Tagebuch will ich infolgedessen etwas weniger bemühen, bis ich mehr Muße habe.
München, Freitag, d. 31. Mai 1912.
Nur einige Notizen: Vor einigen Tagen bekam ich von einem Herrn Kurt Kersten Bruchstücke eines Manuskripts zugeschickt: „Sssst-bumm!“ oder „Wozu die Zeitgenossen fähig sind“ von Ernst Berg, Cassel. Eine ausgezeichnete Kriegssatire, die mir für den Kain-Verlag angeboten wurde. Ich schrieb anerkennend zurück und empfahl, das Buch unter Berufung auf mich Bernhard Zack anzubieten. Heute erhielt ich von Herrn Kersten einen begeisterten Dankbrief. Hoffentlich wird was aus der Sache. Gestern besuchte mich Herr Teofil Lenart. Er wollte mir Manuskripte da lassen, was ich ablehnte, weil er keine Abschriften davon besitzt.
Der Dreimasken-Verlag hat mir endlich wieder 5 Stücke zum Lesen geschickt. Ich will sehen, die Sache bis morgen zu erledigen, damit Geld ins Haus kommt.
Diro Meier will von mir eine Bestätigung, daß ich keine Wahnsinnserscheinungen bei ihm wahrgenommen habe. Er ist wegen Verschwendung entmündigt worden. Soll er haben. Ich werde dem „Kometen“ einen neuen Schuldschein über nur 1200 Mk ausstellen dürfen, da die letzte von mir garantierte Nummer nur soviel gekostet hat. Ärgern tut mich das Geld trotzdem genug.
Gestern gabs im großen Hoftheater Premiere von „Jedermann“, ein altes Spiel-Mysterium aus dem Englischen von Hoffmannsthal. Ich war zum Teil entzückt besonders von Steinrücks großartiger Regieleistung und von Lützenkirchens ausgezeichnetem Jedermann. Im Kain werde ich ausführlicher drüber schreiben.
Mariechen macht mir nach wie vor schwere Sorgen. Sie hat natürlich das Reisegeld verausgabt und ich soll neues beschaffen. Wüßte ich nicht, daß sie sehr unglücklich ist, wäre ich längst abgeschnappt. Mache ich aber eine Andeutung, dann schaut sie mich so flehentlich an, daß ich nicht kann. Als wir uns neulich trennten, sah sie mir mit einem so wehen Lächeln ins Auge, daß ich hätte weinen mögen und sagte blos: „Sei lieb!“ Gotthelf will mir, wenn er kann, bis morgen 100 Mk verschaffen, die ich vom „Scheinwerfer“-Honorar zurückgeben muß. Daß doch endlich Ruhe würde mit den materiellen Nöten! Es ist entsetzlich, daß meine künstlerische Arbeit so furchtbar darunter leiden muß.
München, Sonnabend, d. 1. Juni 1912.
Der Geldmangel drückt sehr. Schon schickt die Schusterei Reit mir eine Nachnahme über die verfluchten 24 Mk. Ich habe sie vorläufig zur Post zurückgehn lassen, und habe nun bis Freitag Zeit zu zahlen, andernfalls werde ich wohl verklagt werden. Heut kam nun noch ein Brief aus Berlin von Melanie Spielmann, ich möchte ihr 20–30 Mk schicken. Ich habe dem armen Tier depeschiert, daß es nicht geht. Mit Mariechen beabsichtige ich Schluß zu machen. Es handelt sich nur noch darum, die richtige Methode zu finden, die sie möglichst wenig verletzt. Ich habe gestern plötzlich eingesehn, daß es absolut nicht gehn kann mit uns beiden. Abends war im Gambrinus Gruppensitzung. Jenny Brünn holte mich dazu ab. Zu meinem Schrecken hatte Morax allerlei peinliche Gestalten aus dem Café Stefanie und der Pension Führmann mitgebracht. Fritz Klein mit seinem proletischen Gebaren saß da, ein Student, der in die Gesellschaft da geraten ist und Herr Franz Jung mit Frau Margot. Ich ärgerte mich sehr über Morax. Man muß doch wissen, welche Leute zusammengehören und welche nicht. Ich hüte mich vor philiströser Versumpfung, indem ich mit möglichst vielen verschiednen Kreisen umgehe und indem ich diese Kreise scharf von einander getrennt halte. Da habe ich die Anarchisten, da das Café Stefanie, da die Torggelstube und da den Lotte-Uli-Kreis, lauter ganz verschieden interessierte Menschen, die garnichts miteinander zu schaffen haben. Nun kommen Leute wie Klein und Jung in die Gruppe, innerlich verwahrloste Menschen zu solchen, für die innerliche Festigkeit grade das Lebensbedürfnis ist, das sie zu uns führt. Frl. Brünn machte mich darauf aufmerksam, wie an einem Tisch (Klein) von Leihhaus und Geldbeschaffung gesprochen wurde, am andern, wo nur Arbeiter saßen, von Kropotkin. Ich schämte mich vor ihr. Mariechen saß ganz uninteressiert da und bemühte sich, den Ehemann von allzu reichlichem Biergenuß fernzuhalten. Ich sprach dann und redete mich in Wut hinein, daß bei all unsern Bemühungen so garnichts herauskomme. Die Gäste hatten mir die Laune gründlich verdorben. Nachher wurde Mariechen hysterisch und goß ihrem vis-à-vis ein Glas Wasser über die Hosen. Ich sah sie an – und wußte, daß es aus sein müsse zwischen uns. Gewiß sah sie hübsch aus, aber ich bemerkte einen Zug von Gewöhnlichkeit in ihrem Gesicht, der mir bisher entgangen war, und ich verglich: neben mir saß die feine zarte Jüdin mit sehr schönen Händen und tiefen braunen Idealisten-Augen. Ich bin keineswegs in Jenny Brünn verliebt, aber ich spürte, tiefe nachhaltige Sympathie kann ich nur für differenzierte Frauen hegen. – Aus einer spontanen Eingebung heraus forderte ich Frl. Brünn auf, mich in die Torggelstube zu begleiten. Da wars zuerst sehr fad. Rößler sprach, ohne uns sehr zu beachten auf Dr. Mannheimer ein, Weigert und Muhr unterhielten sich mit Frl. Valetti und Frau Schwab. Wir blieben uns überlassen. Das wurde anders, als Steinrück kam. Die andern gingen an einen besonderen Tisch pokern. Steinrück und Weigert blieben bei uns, und jetzt kam eine sehr angeregte gute Unterhaltung heraus, in deren Verlauf es mir gelang, für Frl. Brünn zu Montag Steinrücks Billet für „Jedermann“ versprochen zu bekommen. Ich begleitete sie dann heim. Eine ausnehmend kluge, gebildete und tief angelegte Person, mit der ich mich gern enger befreunden möchte. Ich sehe sie Montag wieder.
München, Sonntag, d. 2. Juni 1912.
Das Geld von Waidmannslust ist noch nicht da, und der Dreimasken-Verlag hat noch nichts herausgerückt. Ich brachte gestern 3 gelesene Manuskripte zurück (darunter eins, das ich sehr zur Annahme empfohlen habe „die Preußenbraut“ von Franz Fiedler (Reinhold Sommer) – ich hab eine Titeländerung empfohlen, etwa, „die heilige Ordnung“. Es ist, als ob man das große Los zieht, wenn man unter all dem unsäglichen Mist mal etwas gutes findet. Ich werde das Schicksal dieses Stückes sehr interessiert verfolgen). Lodygowsky empfing mich, und verwies mich an Jadassohn. Nach einer viertel Stunde erfuhr ich, daß der schon fort sei. Ich verlangte Lodygowsky noch einmal. Er kam nach einer halben Stunde mit dem Bescheid, er könne nicht über Geld verfügen. Ich machte Skandal, ich wollte mich nicht wie ein Hanswurst behandeln lassen. – Später arbeitete ich an der nächsten „Kain“-Nummer. Währenddem kam Frieda Gutwillig ins Zimmer. Sie hatte sich lange nicht gezeigt. Nun flog sie mir mit gradezu fanatischer Zärtlichkeit um den Hals. Wir küßten uns wie nicht gescheit, immerfort. Ich zog sie aufs Sofa und zog ihr, ohne daß sie viel widerstrebte, die Bluse aus, öffnete vorn das Hemd und holte den vollen weichen Busen heraus, den ich heftig küßte. Leider gelang weiteres nicht. Meinen Versuchen, ihr unter die Röcke zu greifen, widerstand sie mit voller Kraft, daß ich davon abstehn mußte, zumal fortwährend die Befürchtung war, es könnte jemand ins Zimmer kommen, das ich abzuschließen versäumt hatte. Erst während sie sich wieder anzog, schloß ich ab. Es war ein gewagtes Stück, dieses unberührte Mädchen derartig zu überfallen, und ich bin jetzt sehr neugierig, ob sie wiederkommen wird. Ich denke, ja. Denn sie sagte ziemlich spontan, nachher noch: „Ich hab Sie recht gern“ und dann, als ich sie bat, mich mal nachts zu besuchen: „Nein, die 4 Wochen, die ich noch hier bin, will ich noch brav bleiben.“ – Sie hatte noch nicht alles zugeknöpft, da klopfte es und Herr Kaderschafka rief mich ans Telefon, da Frau Jung mich zu sprechen wünsche. Als ich hinunterkam, meldete sich niemand. Ich ging also ins Stefanie. Es ist merkwürdig, wie sehr ich trotz allem Mariechen schon verfallen bin. Ich ging mit ihr auf die Straße und setzte ihr auseinander, daß aus unserer Ehe nichts werden könne, da ich die Sache finanziell unterschätzt habe und zur Zeit garnicht zu dergleichen in der Lage sei. Sie war sehr geknickt. Sie merkte genau, daß innerlich bei mir nicht alles beim alten sei, und suchte vorsichtig mich zu sondieren. Ich gab ihr endlich zu, daß ich das Gefühl habe, sie spiele mit mir. Sie war sehr sehr traurig und tat mir grenzenlos leid. Schließlich tat sie das Allerklügste. Sie kam auf ihren Zustand zu sprechen, und deutete an, daß sie in einer Woche etwa sexuell zur Verfügung stehe. Als wir uns trennten, drückte sie mir lange die Hand, schaute mich tief an und sagte: „Tu was du kannst, Mühsam. Ich wird’s dir vergelten – mit Leib und Seele!“ Ich war sehr ergriffen, und ich sehe schon, so einfach wird es nicht sein, von ihr loszukommen. Wahrscheinlich wird eine kurze Ehe notwendig sein, um zu erweisen, daß unser Zusammenleben unmöglich ist. – Abends war ich in der Torggelstube, wo ich Lulu Strauß um 3 Mk anpumpte. Bei der Zigarrenfrau, Madame Tinius, habe ich auch schon wieder Schulden.
München, Montag, d. 3. Juni 1912.
Ich bin außer mir: Onkel Leopold hat noch immer kein Geld geschickt. Offenbar will er mich dafür strafen, daß ich ihm die Quittungen des vorigen Monats zu spät gesandt habe. Es ist scheußlich. Gottseidank gewann ich gestern nacht Weigert im Écarté 20 Mk ab, von denen er mir leider zunächst blos 5 Mk auszahlte. Immerhin komme ich auf diese Weise über diesen Tag wieder weg. Kommt das Geld bis morgen früh nicht an, so muß ich telegrafieren. Aber Johannes wartet, Mariechen wartet – Gotthelf, der mir 100 Mk bis Sonnabend beschaffen wollte, kann ich nirgends finden. Der Dreimasken-Verlag ist ganz unsicher. Soll ich da wieder stundenlang im Wartezimmer sitzen und mich minderwertig behandeln lassen? – Und der Simplizissimus? Ich scheue mich hinzugehen. Bald halte ich die Schweinerei nicht mehr aus! Immer wieder kommt mir der trostlose Gedanke, daß ich vielleicht doch eher dran glauben muß als der Vater – und dann ist alle meine Arbeit, alle meine Jugend, alle meine Hoffnung und Leidenschaft vertan. Der Gedanke ist entsetzlich.
München, Dienstag, d. 4. Juni 1912.
Das Geld ist immer noch nicht da. Ich habe telegrafiert.
Gestern nach Tisch kam Herr v. Maaßen zu mir, um mir Brentanos Godwi zu bringen, worum ich ihn gebeten hatte. Zugleich dedizierte er mir ein kleines in Privatdruck erschienenes Buch „Erbrochene Siegel. Frl. Anni Pillrich geboten von Ede S. Blehmches“. Unanständige Sächelchen, zu denen er beigesteuert hat. Dieser Maaßen ist ein ausnehmend kluger, feiner Mensch mit viel Witz und sehr viel gebildeter Kultur. Wir gingen zusammen ins Stefanie, wo sich zu uns Herr v. Löwen einfand mit einem jungen Wiener Maler, der – ein sehr hübscher Mensch, mit offenem klugen Gesicht – auf mich einen sehr günstigen Eindruck machte. Auch alles was er sagte – wir sprachen über deutsche und französische Kultur und ich geriet mit Maaßen scharf aneinander, wobei mir der junge Mann lebhaft assistierte – war durchdacht und sympathisch. Mariechen setzte sich an den Nebentisch. Sie erzählte mir, daß sie Geburtstag habe (25 Jahre). Ich forderte sie auf, mich zum Dreimasken-Verlag zu begleiten. Da sie aber erst noch eine Kleinigkeit besorgen wollte und mir zu lange wegblieb, ging ich allein. Oben hatte ich mit Jadassohn eine sehr unerquickliche Auseinandersetzung. Er wollte mir den weiteren Vorschuß verweigern und fand, als ich mich sehr darüber aufregte, daß ich „undankbar“ sei. Demütigungen über Demütigungen, wenn man kein Geld hat. Schließlich erhielt ich wieder 50 Mk Vorschuß, für 5 Stücke, die ich noch nicht bekam, und ging mit dem Gefühl fort, daß auch diese Einnahmequelle jetzt versiegt sein dürfte. Jadassohn stellte das Ansinnen an mich, ich solle in Zukunft das Stück für 5 Mk lesen. Ich lehnte das ohne weiteres ab und ging ins Caféhaus zurück, wo ich hoffte, Mariechen zu treffen, um ihr ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Sie war nicht da, aber der Kellner bestellte, ich möchte sofort Gotthelf anrufen, dessen Telefonnummer er mir sagte. Gotthelf ist mit der kleinen Lotte zusammen in die Prinz-Ludwigstrasse gezogen und bat mich, zu ihm hinaufzukommen. Er eröffnete mir, daß ihm ein Pump bis jetzt nicht gelungen sei, von dem er mir abgeben wollte; er könne mir aber privatim 100 Mk geben, wenn ich verspreche, sie bis zum 1. Juli zurückzugeben. Im Vertrauen auf das „Scheinwerfer“-Honorar versprach ich’s. Ein Grund mehr, energisch an die Arbeit zu gehen. Um 7 Uhr sollte mich Jenny Brünn aus dem Café abholen, damit ich ihr das (mittags vom Hoftheater-Portier abgeholte) Billet für „Jedermann“ gebe. Ich traf im Café zunächst Benno Berneis, der mir Grüße aus Berlin bestellte. Dann versprach ich, als sie kam, Frl. Brünn, sie bis vors Theater zu begleiten. Jetzt erschien aber Mariechen und bedrängte mich, sie müsse noch vor 8 Uhr was einkaufen. Ich mußte mich also bei Frl. Brünn entschuldigen, was mir sehr peinlich war, und mit Mariechen fort. Der Geburtstag kostete mich ein paar Schuhe für 12 Mk 50. 25 Mk hatte ich ihr als Zuschuß für die Reise noch versprochen. Sie wollte mich überreden, mit in der Pension Führmann zu essen, es gelang mir aber, sie zu mir einzuladen, und so kamen wir mal wirklich zu einer soliden Abküsserei. Leider stellten sich nach dem Abendbrot bei ihr heftige Magenkrämpfe ein, an denen sie seit der letzten Geburt viel leidet. Ich brachte sie per Auto heim, bekam noch einen Abschiedskuß auf den Mund und fuhr zum Krokodil. Dort war es sehr nett, und schließlich gingen noch einige (außer mir Roda Roda, Etzels, Roß und noch ein Herr) in die Torggelstube und schließlich ins Odeon-Café. Ich wurde per Auto heimgebracht.
Ob Mariechen ihr Vorhaben, heute abend noch nach Breslau zu fahren, wahrmacht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, daß, wenn sie das Geld wieder für andre Zwecke verbraucht, sie von mir keins mehr bekommen wird. Ich sandte heute an Johannes 40 Mk, die 50 Mk vom Dreimasken-Verlag gingen für Mariechen nahezu ganz drauf, und von den 60 Mk, die jetzt übrig sind, muß ich gegen 25 für den Schuster hergeben, 20 an Steinebach abliefern für ankassierte Abonnements, und mindestens den Kellner im Stefanie bezahlen. Wallner und Schmitz werden wohl wieder warten müssen. Es wird kein angenehmer Monat werden. Ich sehe immer klarer: die einzige Hilfe kann nur noch vom Himmel selbst kommen.
München, Mittwoch, d. 5. Juni 1912
Heut kam endlich das Geld, nachdem gestern Onkel L. telegrafiert hatte, daß es Sonnabend abgeschickt sei. Der Sekretär hatte vergessen gehabt, München auf die Anweisung zu schreiben, und so war sie noch einmal zurückgegangen. Das meiste ist schon weg, da ich die 25 Mk für den Schuster zahlte und 21 an Steinebach.
Mariechen scheint abgereist zu sein. Sie kam gestern ins Café, nahm mir weitere 3 Mk ab für ein Seidenhemd, das sie mir bringen wollte, und bat mich, sie abends an die Bahn zu begleiten. Da ich ins Theater wollte, lehnte ich das ab. Sie wollte noch etwas besorgen und dann noch einmal hineinschauen. Ich konnte aber nicht warten und ging ins Schauspielhaus, wo Friedrich Kayssler und Helene Fehdmer mit eignem Ensemble in Tolstojs „Und das Licht scheinet in der Finsternis“ gastierten. Es war herrlich. Ein so reines tiefes persönliches Bekenntnis, wie ich kaum ein zweites kenne. Tolstojs Familienleben, der Widerspruch zwischen seinen Lehren und seiner Umgebung. So wie Kayssler, dieser wundervolle unendlich wahrhaftige Mann, den Nikolai Iwanowitsch spielte, so, genau so stelle ich mir Leo Tolstoj vor: als harten, unerbittlichen, gegen sich noch strengeren Menschen als gegen die andern. Tolstojs Gattin dagegen habe ich mir ganz anders gedacht, und Helene Fehdmer hat in herrlichem echtem ausgeglichenem Spiel mir diese Frau menschlich nahe gebracht, die mir immer als Scheusal und giftige Natter erschienen war. Nachher in der Torggelstube hörte ich Urteile über das Stück: bedeutend und interessant. Es ist weder das eine noch das andre. Aber es ist schön, ganz einfach schön, weil es ungeheuer wahr und ehrlich ist. Ich wurde noch selten von einer Theateraufführung so erschüttert. Tolstoj war mir wieder ganz nahe. Ich sage zu jedem Wort, das er ausspricht: Ja. Die Leute aber im Theater, das mußte ich denken, die dem so begeistert zustimmen, das sind dieselben, die, wenn ich ausspreche, was sie da von der Bühne hörten, völlig die Rollen der rechtgläubigen Philister spielen.
In der Torggelstube war mal wieder Consuela Nicoletti. Sie gefiel mir ausnehmend gut. Sie will mich demnächst anrufen und zu sich einladen.
Heut mittag war Jenny Brünn bei mir zu Tisch. Wir unterhielten uns so gut, daß sie den ganzen Nachmittag da blieb, und ich sie erst nach 7 Uhr zum Schauspielhause begleitete. Ein prächtiges Geschöpf, sehr klug, sehr gebildet, sehr tief im Fühlen und Empfinden – und Anarchistin. Dabei noch hübsch. Sie erzählte mir von ihrer Jugend und ihrem Elternhaus. Ihr Vater ist ein reicher jüdischer Bankier in Eydtkuhnen. Als sie berichtete, sie habe Verdruß, weil ihre Eltern sie an irgendeinen gleichgiltigen Juden verheiraten wollen, schlug ich ihr ganz spontan vor, mich zu heiraten. Wir lachten beide. Aber ich stelle mir vor, daß das für uns beide nicht schlecht wäre. Mein Vater wäre begeistert, brächte ich ihm eine reiche jüdische Schwiegertochter, und wir beide behielten unsere Freiheit. Wenn sie wollte, mir wärs lieb. Sie gefällt mir so gut, wie (außer Ella Barth) noch keine Jüdin. Ich küßte ihr oft die Hände und ein paarmal das sehr schöne kastanienbraune Haar. Gute Freunde sind wir heute mindestens geworden.
München, Freitag, d. 7. Juni 1912.
Nun kann ich mich von Mariechen ausruhen. Es wird nötig sein. Der Dalles ist schon wieder, trotz der Gotthelfschen 100 Mark peinlichst bemerkbar. Ich weiß nicht, was werden soll. Johannes schreibt mir einen trostlosen Brief. Ich kann nicht mehr helfen. Von Lübeck keine Nachricht. – Jeden Tag empfinde ich die Lage drückender und demütiger. Wenn ich an die Unterhaltung mit Jadassohn neulich denke, steigt mir die Galle hoch. Er rechnete mir vor, daß ich im vorigen Monat 150 Mk vom Dreimasken-Verlag bekommen habe (von den Sobotkaschen Privatvorschüssen wußte er Gottseidank nichts) und meinte, dann müsse ich doch ganz gut haben leben können. Er verdient, nachdem ihm sein Harmonie-Verlag, eine Anstalt zur Exploitierung kultureller Persönlichkeiten, verkracht und freundlich in den Dreimasken-Verlag aufgenommen ist, mindestens 500 Mk monatlich. Dann fragte er, ob mir denn der „Kain“ nichts abwerfe, und als ich das verneinte, erklärte er, das sei dann ein Sport für reiche Leute, wenn ich mich mit solchem Sport abgebe, könne er mir nicht helfen. Das verstehe er nicht. Ich sagte: „Ich brauche wohl darüber keine Rechenschaft abzugeben.“ – Nachher fand er mich undankbar, weil ich unzufrieden war, daß er mir weitere Vorschüsse sperren wollte. Das Hübscheste ist doch, daß er sich auf den Standpunkt stellt: jemand, der irgendeine Arbeit tut, die nichts einbringt, verdient nicht, daß man ihm Arbeiten aufträgt, von denen er leben kann. Dabei giebt es gewiß noch ärgere Philister als diesen Jadassohn. Typisch für sie alle ist, daß sie sich in Hinblick auf ihre überlegenen Geldmittel völlig im Recht glauben, wenn sie einen ihnen geistig hundertfach überlegenen Menschen, der in der Purée ist, à la Schuhputzer behandeln.
Wesentliche Ereignisse sind nicht zu registrieren. Mit Jenny Brünn hoffe ich, werde ich mich bald näher anfreunden. So ein kluges, feines, freies Mädel! – Frieda Gutwillig war vor einer Stunde hier und holte sich ihre Küsse. Mariechen hat noch nichts von sich hören lassen. Es wird behauptet, sie sei mit ihrem Gatten abgereist. Wundern sollte mich das nicht, und es wäre mir insofern ganz recht, als ich dann einen Vorwand hätte, endgiltig Schluß zu machen. Jenny Brünns Beine werden schwerlich so schön sein wie Mariechens, aber ihre Augen sind tiefer, ihre Hände beseelter, ihr Empfinden reiner. Nie habe ich mir mit großer Ruhe und Sachlichkeit gesagt: das wäre eine Frau für mich.
Eine Menge Korrespondenz kam an. Darunter ein Brief von Kilian. Er sagt mir Schmeicheleien wegen der „Freivermählten“ – und der „Hochstapler“, die er den Instanzenweg schicken will. Natürlich macht er mir keine Hoffnungen, daß eins der Stücke angenommen werden könnte. Es ist ja alles Schmuserei. Steinrück war wütend, als ich ihm den ersten Brief von Kilian zeigte. Er meinte, der Mann möchte blos bessere Kritiken haben als ich sie sonst über ihn schreibe. Mit Feuchtwanger hat er ganz ähnliche Sachen gemacht. À propos Feuchtwanger. Der hat sich verlobt und will wahrscheinlich für längere Zeit München verlassen. Er wird mich Jacobsohn als Nachfolger für die „Schaubühne“ vorschlagen. Das wird ja nicht viel bringen, doch aber etwas und meinem Renommee als Theaterkritiker jedenfalls sehr nützen.
Es muß alles abgewartet werden. Vielleicht kommen doch noch gute Zeiten.
München, Sonnabend, d. 8. Juni 1912.
Meine Kasse ist durch 10 Mk, die ich gestern nachmittag im Stefanie von Rößler bekam, wieder etwas betriebsfähiger geworden. Aber es sieht für die nächsten Wochen schlimm aus. – An Tatsächlichem vermerke ich: Gestern abend war die Gruppe Tat wieder im Gambrinus versammelt. Ich hatte Jenny Brünn vorher zu mir zum Abendessen abgeholt, und sie ließ einen Schweizer Herrn, der mit ihr hinwollte, zu mir nachkommen. Gespräche über Monogamie und Eifersucht. Sie ist sehr klug und frei. Die Syndikalisten, denen ich einen Vortrag halten sollte, waren nicht erschienen, da sie selbst eine Aussprache hatten. Dagegen war Emmy da, die eben von Berlin zurück ist. Wir küßten uns herzlich und ich freute mich sehr, sie äußerst frisch, wohl und gesund zu sehn. – Ich sprach zu den Dutzend Personen von den Voraussetzungen zur Zugehörigkeit zum S. B., vor allem darüber, daß alles dabei auf das Innerliche im Menschen ankommt und alles praktische Tun keinen Sinn habe, wenn es nicht aus begeistertem Herzen komme. – Nachher ging ich mit Jenny Brünn in die Torggelstube. Sie lernte Roda Roda und Ludwig Thoma kennen. Auch Feuchtwanger war da und Körting mit seinem bezaubernden Weibe. – Wir fuhren alle zusammen im Auto heim, und ich ging noch ins Stefanie.
Heut vormittag, als ich noch im Bette lag, ließ sich ein Fräulein König anmelden. Es war das frühere Stubenmädel mit den häßlichen Zähnen. Sie ist immer noch sehr verliebt, erzählte mir, daß sie verlobt war, das Verhältnis aber gelöst habe und kam dann zu mir ins Bett. Ich habe für das Mädel trotz ihrer Häßlichkeit viel Sympathie. Sie ist ein anständiger Charakter und liebt mich wirklich sehr.
Ach ja: Gestern ließ ich mir von Dr. John Andreas einen Zahn ziehn. Er war lose geworden, da er zwischen meinen beiden einzigen Zahnlücken einsam im Raume schwebte. Jetzt fehlen mir im ganzen drei Zähne, lästigerweise aber alle nebeneinander, die drei letzten in der oberen Zahnreihe links.
München, Sonntag, d. 9. Juni 1912.
Gestern abend gab das Krokodil ein Fest in Gern. Ich hatte mich mit Max Halbe verabredet, daß er mich aus dem Stefanie abholen sollte. Das Ehepaar Roda Roda schloß sich uns an. Das Fest fand in der Kegelbahn des Gerner Bads statt, die ganz mit roten Lampions erleuchtet war. Es nahmen etwa 30 Personen teil, darunter eine Menge Kutscher-Schüler und -Schülerinnen. Die rote Beleuchtung störte mich. Die erotische Stimmung, die damit wahrscheinlich hervorgebracht werden sollte, wurde grad dadurch gehindert. Ein heller Raum, und daneben der dunkle große Garten, hätte viel besser gewirkt. Von den Frauen gefiel mir bei weitem am besten Frau Lene Körting, die ich die ganze Zeit inbrünstig hofierte. Ich küßte ihr unzählige Male die Hände und sagte ihr in aller Offenheit, daß sie mich entzücke. Sie sah bezaubernd aus und sie ist ein lieber feiner Mensch. Allerdings sagt man, daß sie frigid sei und nicht einmal von der Liebe ihres Mannes Freude habe. Ich glaube nicht recht an frigide Frauen. Eine richtige Verliebtheit hilft meist darüber hinweg. Gegen 3 Uhr nachts ging noch ein großer Teil der Gesellschaft zu Wilm, der in Gern wohnt. Dort wurde auf die Unmasse Bowle und deutschen Sekt, die vorher vertilgt war, noch reichlich Schnaps und Wein gegossen. Ich fuhr mit Körtings und einem Herrn heim und kam um ½ 5 Uhr ins Bett.
Die Herren Major v. Hofmann und Nonnenbruch hatten mich vor einigen Tagen interessiert nach Mary (Pfefferle) gefragt. Sie beide wollten sie als Modell engagieren, und zwar Nonnenbruch für sich selbst, v. Hofmann für die Fürstin Thurn und Taxis in Regensburg. Ich vermittelte. Heute war die Kleine nun bei mir zu Tisch. Wir küßten uns gehörig ab, das kann sie prächtig mit ihren 17½ Jahren. Sie hatte ein Hemd geschenkt gekriegt, das sie bei mir anzog. Sie hat einen entzückenden grazilen Körper (ähnlich wie Jane), und während ich ihre Brüste abküßte war ich sehr traurig, daß sie sexuell noch nicht gebrauchsfähig ist. Sie hofft aber, in etwa 14 Tagen den Tripper los zu sein. Ich ging dann mit ihr zu Nonnenbruch, der in der Mandlstrasse ein reizendes Haus hat. Seine Frau, eine sehr feine ältere, leider taube Dame, empfing uns auf das Liebenswürdigste und sagte mir viele Schmeicheleien über den „Kain“. Nonnenbruch nahm von Mary mehrere photographische Aufnahmen. Er war entzückt von ihrem Körper und gab ihr 20 Mk. Dann führte er uns im Hause herum. Er hat wunderschöne Bilder. Besonders ein Samberger machte auf mich einen großen Eindruck. – Nachher begleitete ich Mary noch zum Major bis vor die Tür. Morgen früh soll sie nun nach Regensburg abfahren. Sie erhielt auch da noch 10 Mk und ist heute über ihren Reichtum vollkommen glücklich.
Speidel sendet mir „die Freivermählten“ und „die Hochstapler“ zurück, da das Hoftheater die Stücke nicht annehmen könne. Nicht überraschend.
München, Montag, d. 10. Juni 1912.
Die Geldkatastrophe bricht jetzt prasselnd herein. Ich weiß nicht mehr weiter. Heut kam die Rechnung für das Gerner Fest. Ich soll die Kleinigkeit von 10 Mk 50 bezahlen. Woher nehmen? Ich habe keine Ahnung. Es müssen sich schon plötzlich ganz ungeahnte Quellen auftun, sonst weiß ich wirklich nicht, wie ich in diesem Monat leben soll. – Zunächst muß ich arbeiten, und zwar am Scheinwerfer-Buch. Ich will heut nachmittag in die Staatsbibliothek und versuchen, die Nummer des Fischerschen „Funken“ vom Jahre 1905 zu kriegen, in der mein Artikel „Wider die Aestheten“ stand. Ich möchte in dem Buch ungern auf die Arbeit verzichten. Ferner muß ich noch ein Vorwort und eine lange Einleitung (über das Recht auf Einseitigkeit) schreiben, und am 15ten soll ich das ganze Buch druckfertig abliefern. Vielleicht zahlen sie das Honorar bald aus. Wichtig wärs schon. Aber ich rechne kaum vor Ende des Monats darauf. Und bis dahin sieht alles sehr trübe und belämmert aus. Wallner hat seine 10 Mk noch immer nicht zurück, Jodocus Schmitz seine 20 nicht. Allerdings wird der jetzt warten können. Wir haben neulich nacht bei Wilm Schmollis getrunken. Gotthelf muß unbedingt die 100 Mk vor dem 1. Juli zurückkriegen, der Zahnarzt, der noch die Wurzel des neulich beseitigten Zahnes herausholen muß, wird eine anmutige Rechnung machen, und eigentlich brauchte ich mehr als nötig Wäsche und Kleidung. Auch die Stiefel müssen wieder zum Schuster. Der Neue Verein ist in diesem Monat noch nicht gezahlt (5 Mk) und bei der Marie im Torggelhause bin ich schon wieder 6 Mk schuldig. – Ich will abbrechen, da sich eben Frl. Gutwillig bei mir ansagen läßt. So komme ich doch wieder zu Küssen.
München, Dienstag, d. 11. Juni 1912.
Frieda Gutwilligs Besuch verlief ziemlich dramatisch. Wir küßten uns wie besessen, und ich holte ihr wieder die Brüste heraus. Sie ließ es ohne Widerstand geschehn. Selbst ihre Beine und Schenkel ließ sie sich abtasten, und wurde erst rebellisch, als ich mit der Hand dahinkam, wo ich ihr in sehr naher Zeit von der Virginität loshelfen will. Sie tat sehr empört, es amüsierte mich dann aber schon, als sie, ehe sie protestierend das Zimmer verließ, mir noch einmal um den Hals fiel und mich abküßte. – Nachher ging ich zum Zahnarzt. Der holte mir die drei zusammengewachsenen Zahnwurzeln aus dem unempfindlich gemachten Backenkiefer. Es ist ja fabelhaft, daß man diese scheußliche Operation völlig schmerzfrei bewerkstelligen kann, aber ekelhaft genug bleibt das ganze immer noch. Ich hatte gestern abend noch heftige Schmerzen, nahm 1½ Gramm Aspirin dagegen, und bekam davon Kopfweh und einen verdorbenen Magen, sodaß ich heute früh kreuzelend erwachte. – Abends Krokodil. Kutscher erzählte Langes und Breites über Schwierigkeiten mit seiner vorgesetzten Behörde. Man hat ihm verboten, über Wedekind zu lesen, und jetzt hat eine Kontroverse zwischen Studenten seines Seminars im Anschluß an das Erler Passionsspiel, wobei sich Juden und Christen in ihrem religiösen Empfinden gegenseitig verletzten und dann verprügelten, zu seiner Vorladung vor den Rektor geführt. Kutscher fürchtet im Ernst für seinen Lehrstuhl. Er war sehr aufgeregt. – Ich ging dann noch allein in die Torggelstube, von dort aus mit Muhr und Gotthelf ins Orlando, nachdem ich Weigert 3 Mk von seinen Spielschulden abgenommen hatte. 12 bekomme ich noch. Ich setzte im Écarté auf Gotthelf und gewann weitere 2 Mk. – Über die Gerner Festkosten hoffe ich auf sonderbare Weise wegzukommen. Ich wettete bei diesem Fest mit Herrn Wenter um eine Flasche Heidsieck, daß die Roland nie die Frau in Strindbergs „Vater“ gespielt habe, was er behauptete. Diese Wette habe ich gewonnen und will jetzt Wenter bitten, statt des Sekts die Rechnung des Festes für mich zu bezahlen. Er spart dabei 5–6 Mk und ich komme um die Fatalität des Schuldigbleibens herum. Da ich von Körting noch 4 Mk ausgelegtes Auto-Geld bekomme, ist für morgen und übermorgen Ernstes nicht mehr zu fürchten, und Freitag soll ich laut Verabredung mit Thoma zur Redaktion des „Simplizissimus“ kommen.
München, Mittwoch, d. 12. Juni 1912.
Die Dinge werden immer grauenvoller. Gestern, als ich ins Café kam, wurde ich damit überrascht, daß mir das freundliche Gesicht Mariechens entgegenlachte. Ich bin verzweifelt. Natürlich ist sie völlig ohne Geld, ohne irgendwelche Möglichkeit zu leben. Zunächst müsse sie 30 Mk an ihre Mutter schicken, die ihr das Geld für die Reise vorgesteckt hat. Ich bin entschlossen, mich energisch von ihr zurückzuziehn. Nur muß ich ihr natürlich zunächst zu essen geben. Am liebsten möchte ich sie verkuppeln. Schön ist sie ja, und vielleicht findet sich ein reicher Mann für sie. Einem armen kann ich sie nicht geben, den saugt sie aus wie ein Vampyr, in einem Egoismus, für den es keine Nebenmenschen giebt. Ich für meinen Teil habe genug davon. Nur möchte ich sie nicht direkt im äußersten Elend sitzen lassen. Heut früh kam sie bei mir an, holte mich um 10 Uhr aus dem Bett, ich müsse ihr Geld verschaffen. Ich schrieb in meiner Verlegenheit an Maaßen, er möchte ihr helfen und gab ihr den Brief mit. Ich hatte (und habe) die schauderhaftesten Zahnschmerzen, begleitete sie aber, ehe ich zu Dr. Andreas ging, bis vor Maaßens Haustür. Sie hat dort leider bis jetzt nichts ausgerichtet. Was fange ich nur an? Jetzt wird sie gleich zum Essen erscheinen. Heut nahm sie die kleine Remontoire-Stahluhr mit, die offen auf dem Schreibtisch lag, und die sie zu verkaufen hofft. Ich muß sehr aufpassen, daß nichts offen liegen bleibt. Diskretion kennt sie nicht und was ihr irgend begehrenswert scheint, nimmt sie ungeniert mit. Bis jetzt habe ich noch nicht das mindeste wiedergesehn, was ich ihr geliehen habe. Ich betrauere, außer dem kostbaren Wedekind-Buch, ein Hemd, etliche Taschentücher, und das kleine Handtäschchen, das mich auf jede Reise begleitet. Die Liste wird sich wohl bald sehr vergrößert haben, wenn nicht schleunigst Rat geschaffen wird.
Am schlimmsten ist, daß ich sehr fürchte, unter dieser Beziehung wird die neue Freundschaft mit Jenny Brünn sehr leiden. Dieses feine stille Mädchen tut mir unendlich wohl. Trifft sie mich fortwährend in Gesellschaft der doch im Grunde recht ordinären Margot Jung, so hat sie Recht, wenn sie sich zurückzieht. Gestern war ich mit ihr (Jenny) im Künstlertheater und sah „Kismet“, ein Traumspiel aus 1001 Nacht nach dem Englischen von E. Knoblauch. Eine Frechheit. Hier giebt es nur noch Ausstattung, die von Ernst Stern sehr schön und sehr kostspielig bewirkt ist. Das ganze verlohnt keines Wortes sonst. Ein Nichts, herumgebaut um ein paar Tänze, die ins Variété gehören. Später Torggelstube, wo ich mich bis zum letzten Groschen ausgab. Ich begleitete Jenny heim, ging ins Torggelhaus zurück und nahm Weigert weitere 3 Mk ab, während ich Muhr, der im Poker kolossal gewonnen hatte, um 20 Mk kränkte. Daß nur Mariechen von meinem Reichtum nichts merkt!
München, Freitag, d. 14. Juni 1912.
Mir geht es sehr schlecht. Seit Tagen und Tagen fast ununterbrochen die rasendsten Schmerzen. Das Loch, das durch die Extraktion der Zahnwurzel entstanden ist, scheint einen Kanal zur Nase hin geschaffen zu haben. Der Zahnarzt glaubte zuerst nicht dran, als ich die Vermutung aussprach: er meinte, es komme in 10000 Fällen nur einmal vor, daß der zweite Zahn das bewirke. Jedenfalls gab er mir die Adresse eines Nasenspezialisten Wassermann, den ich heute besuchen soll. Es ist schon toll: In solchem Falle bin ich der Zehntausendste, den dieser fürchterliche schmerzhafte Zufall trifft, das große Los werde ich aber im ganzen Leben nicht gewinnen. Hoffentlich werden keine langwierigen oder gar gefährlichen Prozeduren nötig bei der Behandlung. Ich habe vor dem Sterben eine scheußliche Angst, solange ich mit den Arbeiten nicht beginnen konnte, die frei sein werden vom Zwang der Tagesnot. Es wäre eine grauenvolle Groteske, wenn ich stürbe, ehe ich die Sicherheit erlebe, auf die ich die ganzen Jahre warte und mein Arbeitsprogramm erfüllen kann. Außer der Möglichkeit, je zum Genuß des Lebens zu kommen, wäre mir dann auch noch die Frucht alles meines Ehrgeizes genommen und die höchste Befriedigung im künstlerischen Schaffen. Aber das kann und darf nicht sein, es wäre zu albern!
Mit Mariechen will ich jetzt endgiltig brechen. Sie kam vorgestern nicht zu Tisch und ich habe sie seitdem nicht gesehn. Maaßen hat ihr, wie er mir abends auf der Kegelbahn berichtete, abends noch 20 Mk verschafft. Ich nehme jetzt an, daß sie garnicht in Breslau war, sondern mit Ehemann irgendwo in der Umgebung, und daß sie blos hier war, Geld zu beschaffen, und jetzt wieder bei ihm ist. Jedenfalls mache ich Schluß und werde jetzt meine ganze Aufmerksamkeit auf Jenny Brünn verwenden. Es ist seltsam: das ist das einzige Mädchen, vor dem ich schüchtern bin. Ich legte ihr schon die Hand um die Hüfte, drückte sogar schon meinen Kopf an ihren, was sie sich ohne Widerstand gefallen ließ, aber ich habe einfach noch nicht gewagt, sie zu küssen, obwohl ich drauf brenne.
Gestern war sie bei mir, begleitete mich dann zur Druckerei (Steinebach führte uns in der Offizin herum) und war dann mit mir bei Roda Roda zum Thee, wo auch das Ehepaar v. Falkenhausen (er spielt in „Kismet“ den Khalifen, und war früher österreichischer Offizier) war. Jetzt will ich zum „Simpl.“, dann zum Arzt, um 1 Uhr soll ich Jenny im Stefanie treffen, und nachmittags Jaffé anrufen, da das Goldene Friedele in München ist und mich sehn will. Ob ich heut abend den Syndikalisten den angekündigten Vortrag werde halten können, steht bei den großen Schmerzen, von denen ich geplagt bin, sehr dahin.
München, Sonntag, d. 16. Juni 1912.
Ich werde unausgesetzt von Schmerzen gepeinigt. Vorgestern – nachdem ich vom „Simpl.“ 10 Mk für die uralte Anekdote von den Unannehmlichkeiten bekommen hatte – ging ich zum Nasenspezialisten Dr. Wassermann. Von ½ 12 bis ½ 4 Uhr war ich dort und wurde gräßlich geschunden. Er spritzte mir ätzendes Zeug durch den Mund, durch die Nase und sogar von außen durch die Backe in die Haimons-Höhle, elektrisierte mich und tat mir grauenhaft weh. Zweimal wurde ich bei der Prozedur so schwach, daß ich auf den Divan gelegt werden mußte. Ich imponierte mir aber selbst, als ich – halb ohnmächtig daliegend – das nette Lächeln der Assistentin sah und ihr ohne Zögern an den Hintern faßte. – Der Arzt hat mir den ganzen Oberkiefer anaesthesiert und meinte, jetzt werde ich keine Schmerzen mehr haben. Leider bin ich aber immer noch, und zwar ununterbrochen, von großen Qualen verfolgt. Gestern wurde ich wieder elektrisiert und geätzt, und morgen geht die Plagerei weiter. Inzwischen fresse ich massenhaft Phenacetin, was immerhin beruhigt. Ich fürchte, die Sache wird noch lange nicht in Ordnung kommen. – Natürlich leiden meine Arbeiten sehr unter der Sache. Ich habe an den Dreimasken-Verlag einen Vertröstungsbrief geschrieben. An meinen Bruder Hans schrieb ich einen Krankheitsbericht, bereitete auf hohe Arztrechnungen vor und bat um Geld. Ich bin sehr neugierig, ob er was schicken wird. Am Freitag abend hatte ich noch Glück. In der Torggelstube wurde gepokert. Ich half Gotthelf, der Silber brauchte, mit 5 Mk aus, wofür er mir versprach, den ersten Jack-Pot, den er ziehe, mit mir zu teilen. Nach vielen Pots, die ihm verloren gingen, kam endlich ein hoher, der mir 34 Mk brachte – auf 5 Mk 29 Mk Gewinn: das lohnte.
Gestern war wieder Jenny Brünn bei mir, deren Gegenwart mich beruhigt und stärkt. Meine Liebe zu ihr ist garkeine wild zugreifende Verliebtheit, aber eine ganz tiefe Ergriffenheit und Sympathie. Und ich glaube, sie erwidert diese ruhige Zuneigung. Sie läßt ihre Hand stundenlang in meiner, und ich küsse ihre Hand, die rein und schlank ist. Gestern bot ich ihr an, wir wollten uns Du sagen. Sie lehnte es aber ab, und das gefiel mir, daß sie dazu den Mut und den freundlichen Ton fand. Ich glaube jetzt ganz zuversichtlich, daß Jenny und ich viel gemeinsame Zukunft haben.
Von Papa und Grethe kam eine Ansichtskarte aus Mölln, „wo ich (schreibt Papa) gern wenigstens einen Teil meiner verlorenen Kräfte wiedergewinnen möchte“. Die Handschrift ist auffallend zittrig.
Ein Toter: Der Kunstmaler Rudolf Böhm ist irgendwo in Skandinavien abgestürzt. Er nannte sich „Anarchist“ und vertrat einen völlig wirren Stirner-Mackayschen Individualismus. Sein Revolutionarismus hinderte ihn nicht, sein Bild als das eines Doppelgängers des Königs Ludwig II. in Münchner Winkelblättchen reproduzieren zu lassen. Im übrigen ein guter, dummer Kerl. Er hat von mir die komische Radierung gemacht mit dem Gänsekiel hinterm Ohr, dem Wort Ex libris, und unten das allegorische Triptychon: ein gefesseltes Mädchen, daneben dasselbe, das bei aufgehender Sonne die Fessel in die Luft schmeißt und dann die Harfenjule. Daß der arme Teufel so traurig kaput gehn mußte!
München, Montag, d. 17. Juni 1912
Körperliche Schmerzen sind etwas Entsetzliches, und ich werde scheint’s garnicht mehr davon frei. Gestern wars so bös, daß ich in der Torggelstube Dr. Benedikt aufsuchte und ihn bat, mir Morfiumpulver zu verordnen. Das nützte dann auch. Heut war ich tagsüber ziemlich wenig gequält. Mittags kam Jenny Brünn ins Stefanie und dann zu mir Mittag essen. Was ist das für ein liebes Mädchen! Ich saß stundenlang neben ihr, meine Hand in ihrer, die ich oft küßte und hörte ihr zu. Sie ließ es auch zu, daß ich ihr Stirn und Hals küßte. Ich weiß jetzt, daß ich sie lieb habe. Vielleicht ist sie es, die mir endlich Ruhe, Zuversicht, Halt und Ausdauer geben wird. Wenn sie es doch wäre! – Von Hans ein Brief, in dem er erfreulicherweise mitteilt, daß er 100 Mk an mich abgesandt habe. Er will wissen, warum ich elektrisiert und warum mir von außen in die Backe eingespritzt sei. Nachher rechnete er mir vor, daß ich mit 150 Mk monatlich glänzend auskommen müsse, da die Pension ja nur 130 Mk koste. Seine Vermutung, daß es sich um eine Oberkieferhöhlenvereiterung handle, stimmt, wie mir Dr. Wassermann heut erklärte, nicht. Es sei nur eine Neuralgie „im Bezirk der dritten Gehirnsphäre“, wenn ich ihn recht verstanden habe. Es schund mich heut wieder mörderlich, indem er elektrisierte und an mehreren Stellen im Gaumen einspritzte. Nachher hatte ich teuflische Schmerzen. Ein Phenazetin-Pulver hat mich wieder einigermaßen beruhigt, doch fühle ich plötzlich Hals und Schluckbeschwerden. Ich glaube, ich werde die Behandlung jetzt selbst in die Hand nehmen. Nachdem ich beim Arzt war, ists jedesmal viel ärger als vorher.
Von Martin Drescher ein neuer Brief. Er äußert Liebenswürdiges über den „Kain“, fragt nach dem Schicksal seiner Gedichte (die ich endlich zu Langen bringen will) und kündigt den Besuch einer Genossin Dr. Emma Clausen mit Töchtern an, die ich im Sommer in München herumführen soll. Ich habe mich Jennys Unterstützung schon versichert. – Hierbei fällt mir ein, was ich hier wohl infolge der Schmerzen einzutragen vergaß. Vor etlichen Tagen schrieb mir ein Herr Rieder einen langen Brief. Er wolle eine Robert Reitzel-Monographie herausgeben und mich als einen der wenigen, die schon öffentlich Interesse für Reitzel bekundet haben, darüber sprechen. Nachher waren wir dann ein paar Stunden zusammen und ich gab ihm, da ich selbst kein Material besitze und er mit den meisten, die etwas haben, schon in Verbindung steht, die Adressen von Drescher, Nettlau und Weidner. Es wäre sehr schön, wenn etwas Gutes aus der Arbeit würde.
München, Dienstag, d. 18. Juni 1912.
Immer noch Schmerzen. Es ist widerlich, fortwährend an sein bischen Körperliches erinnert zu werden. – An Arbeiten ist garnicht zu denken. Ich kann keinen vernünftigen Gedanken fassen, nicht mal lesen kann ich. – Gestern ging ich um 10 Uhr abends schlafen, zum ersten Mal seit unvordenklichen Zeiten. Ein Gramm Phenazetin verhalf mir zur Ruhe. Heut früh war ich beim Simplizissimus, wo ich lange mit Olaf Gulbransson sprach. Nachher wurde Thoma sichtbar und dann Geheeb, der mir Zeichnungen zum Textieren heraussuchte, darunter ein prachtvolles Revolutionsbild von Th. Th. Heine. Ich bin neugierig, wie man mir meine Arbeit bezahlen wird. Von Hans sind die angekündigten 100 Mk noch nicht eingetroffen, dagegen von Onkel Leopold eine Karte mit der Mitteilung, daß ich die Ärzterechnungen an ihn schicken darf. – Ferner kam ein sehr merkwürdiger Brief. Frieda König, die mich seit zwei Jahren fortwährend ihrer glühenden Liebe versichert, tobt in kindlichen Versen gegen mich los. „An Erich Mühsam! Geschrieben von dir vernichteten Mädchen.“ In ganz unausgeschriebenen Lettern und in sehr dürftiger Orthographie und Grammatik macht sie ganz wilde leidenschaftliche und haßerfüllte, nicht immer ganz rhytmische Verse gegen mich. Erst beschreibt sie, wie sie mich als unerfahrenes Mädchen zuerst sah: „Du warst ein häßlich Geselle –“ folgt meine Beschreibung frei nach dem Dichter Rigo in meiner Novelle „Carmen“. Wie ich sie dann verführte. „Hier kan ich meine Wohllust stiellen.“ Und dann wütende Ausfälle gegen mich, der ich ihr „das Teuerste mit List geraubt“. „Erich, elender Jude“, „Erich, Scheußsal könnt ich dich erwürgen –“ –, „Erich du elender Wicht“ – und das Gedicht schließt mit dem freundlichen Wunsch: „Erich diese Zeilen sollen dich quällen Tag und Nacht. Vielleicht kann ich mich doch noch rächen“. Ich war, als ich das gelesen hatte, zuerst ganz konsterniert. Habe ich dem Mädchen wirklich so unrecht getan? Vor ganz kurzer Zeit war sie noch bei mir und versicherte mich ihrer leidenschaftlichen Liebe. Seit ich ihr die Virginität nahm, hat sie soundsoviele Verhältnisse gehabt und dabei, wie sie behauptete, immer nur mich geliebt. Und jetzt plötzlich dieser Abfall! „Ich war verstock und begegnet dir nur mit Falschheit“ behauptet sie plötzlich. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Ich beruhige mich an der Zeile: „Du hast mir das Teuerste mit List geraubt“. Daß einem Mädel die Jungfernschaft noch zwei Jahre nach ihrem Verlust „das Teuerste“ erscheinen sollte, ist einfach nicht wahr, ist Phrase und anerzogene Moralität. Damit habe ich nichts zu schaffen. Ich mag sehr roh sein, aber ich weiß wahrlich andre Dinge die mich „Tag und Nacht quällen“, als dieser Erguß. Schwamm drüber. Der Brief fliegt in den Papierkorb. Das Mädel wird nicht mehr empfangen.
Während dieser Eintragung unterbrach mich der Briefträger. Er brachte den Postscheck von Hans über 100 Mk, eine Postkarte aus Pyrmont von Kätchen und einen sehr schmerzlichen Brief von Ihringer, der mir mitteilt, daß der Dreililienverlag pleite ist. Mein Buch kann also nicht erscheinen und mit den 250 Mk ist es Essig. Ich bin sehr sehr unglücklich. Klebt denn an allem, was ich in die Hand nehme, der Fluch? Darf mir denn niemals etwas gelingen? Ihringer will Georg Müller dringend empfehlen, den Verlag zu übernehmen. Müller wird nicht – das kenne ich.
München, Mittwoch, d. 19. Juni 1912.
Ich fühle mich ernstlich krank. Zwar hat, seit ich meine geschundenen Nerven der Mißhandlung des Dr. Wassermann entzogen habe, die Vehemenz der Schmerzen nachgelassen. Spürbar sind sie aber fortwährend. Dabei ist der ganze Körper jetzt engagiert. Allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Übelkeit und Benommenheit. Wo soll das hinaus? Nur nicht sterben! Nur jetzt nicht sterben, wo alles unvollendet, alles was ich großes will und so deutlich, so schön im Herzen und Kopf habe, nicht einmal begonnen ist. Garnichts würde übrig bleiben von allem – es wäre schauderhaft! – Heut bin ich noch besonders unglücklich. Eben habe ich Jenny im Café erwartet – bis 2 Uhr. Sie kam nicht. Ich weiß jetzt, daß ich sie liebe. Ich hänge an ihr wie an meinem Schicksal. Ich weiß, diese Begegnung, die so ganz an die Seele greift, ist weit von allem andern. Das ist keine sinnliche Wallung, kein sehnsüchtiges Tasten nach unbekannten Wonnen: das ist gutes Wissen um etwas sehr sehr Schönes und Edles. Außer Friedel hat mir noch keine Frau so stark das Gefühl von Bestimmung gegeben. Sollte ich Jenny einmal so nahe kommen dürfen, wie ich in den paar Wochen meines Glücks Friedel war, dann weiß ich, daß es ein Aufhören dieser Liebe nicht geben wird. Und vielleicht stellt sich dann auch die Leidenschaft ein, die in allen Stunden der Einkehr, immer noch wie nur je bis jetzt allein für Friedel in mir lebt.
Gestern zahlte ich Gotthelf 50 Mk zurück von den 100, die er mir auf das „Scheinwerfer“-Buch hin pumpte. Er war so anständig, mir zu versichern, daß ich mich wegen des Restes von 50 Mk nicht zu grämen brauche. Auch hält er es für möglich, daß er mir in nicht langer Zeit mit einer etwas größeren Summe beispringen kann. Es wäre sehr schön. Ein sehr guter, anständiger Mensch ist dieser Gotthelf, – wenn er nur nicht so entsetzlich poesielos und so respektlos gegen größere Geister wäre.
Wedekind hatte in den letzten Wochen in Berlin am Deutschen Theater einen Aufführungszyklus seiner Dramen, wie er ihn sonst jedes Jahr hier im Schauspielhause veranstaltet hatte. Der Erfolg war enorm, und gestern fand zu seinen Ehren im Berliner Esplanade-Hotel ein Festbankett statt, das von Paul Cassirer, Dehmel, Liebermann, Gerhart Hauptmann, Tuaillon etc. veranstaltet war. Ich rief nachmittags Gustel Waldau telefonisch an, weil mir eingefallen war, daß ein gemeinsames Sympathie-Telegramm seiner Freunde am Platze sei. Ich bekam von ihm und Halbe Vollmacht, und telegrafierte nachts folgendes: „Bankett Frank Wedekind. Berlin. Hotel Esplanade. Wir freuen uns von Herzen der Eroberung Berlins. Fritz Basil. Hertha v. Hagen. Max Halbe. Erich Mühsam. Rechtsanwälte Rosenthal und Strauß. Albert Steinrück. Gustav Waldau.“ – Ich denke, Wedekind wird sich über die Aufmerksamkeit gefreut haben. Morgen wird er wohl wieder im Torggelhaus sein.
Arthur Schnitzler dankt mir auf einer schwarzumränderten Visitenkarte für die Zusendung des letzten „Kain“ mit der Gratulation zu seinem fünfzigsten Geburtstag.
München, Donnerstag, d. 20. Juni 1912.
Es geht anscheinend etwas besser. Wenigstens weiß ich jetzt, was mir eigentlich fehlt, und daß mich Herr Dr. Wassermann offenbar auf Grund einer Fehldiagnose falsch behandelt hat. Da ich mich gestern totkrank fühlte, kam ich auf den gescheiten Gedanken, statt aller neunmalklugen Spezialisten den braven soliden Hausdoktor Hauschild aufzusuchen (der sich heute noch einbildet, er habe mir vor einem Jahre die Gonorrhöe wegkuriert). Nach ganz kurzer und sehr einfacher Untersuchung, wußte er genau, worum es sich handelt, beschrieb mir ganz zuverlässig, wo ich Schmerzen habe und konstatierte eine Drüsenschwellung und Beinhautentzündung. Er verordnete lauwarme Kamillenausspülungen. Beinahe hätte ich Lust, außerdem noch Kamillenumschläge zu machen, mit denen ich vorgestern begonnen hatte. Jenny hatte mir ein Säckchen und ein Tuch dazu genäht (ihre erste Handarbeit für mich). Ich bin froh, bei der Behandlung meiner Krankheit endlich auf einem Punkt angelangt zu sein, von dem aus ich auf schnelle Besserung hoffen kann. Peinlich genug ist mein Zustand immer noch. Ein bohrendes Gefühl spüre ich ununterbrochen, dabei ist mein Hals verschleimt und die Nase läuft gräßlich, wobei mich besonders quält, daß der Ausfluß aus der Nase einen üblen Geruch hat. Das ist entsetzlicher als alles andre, weil es mich fortwährend damit ängstigt, daß andre etwas riechen könnten. Ich würde nicht wagen, eine Frau jetzt zu küssen. Ein Leiden, das einen erotisch unmöglich macht, ist wohl das ausdenkbar fürchterlichste. Unter allen Umständen appetitlich bleiben – das ist das Mindeste, was die Frauen von uns verlangen dürfen.
Die Kegelbahn wurde mir gestern von Hauschild energisch verboten, da ich hohes Fieber hatte. So ging ich abends in die Torggelstube, wo ich mit Steinrück und v. Jacobi den Direktor Bernauer vom Berliner Theater antraf. Die jungen Herren Alten und Nachbauer vom Hoftheater waren ebenfalls da, dann kam noch Feuchtwanger und schließlich die übliche Pokergesellschaft, der sich Bernauer anschloß. Ich setzte mich mit den Pokerasten an einen andern Tisch, um Rosa Valetti zu kibitzen. Ich beteiligte mich auf ihren Vorschlag mit 10% bei ihr, und gewann nach kurzer Zeit 10 Mk. Rößler kam noch, und da ich mich recht elend fühlte, fuhr ich gegen 1 Uhr heim.
Heut mittag aß ich im Stefanie. Freksa und die Beutler kamen vorbei. Ich winkte sie herein. Freksa erzählte allerlei Unglaublichkeiten von Leonor Goldschmied, auf dessen Denunziation hin übrigens der Prozeß Hieber entstanden sein soll, der, obwohl er als geistig minderwertig anerkannt wurde, auf die widersprechenden Aussagen von Kindern hin zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt ist. Die Beutler lud mich zu Sonntag an den Ammersee ein. Als die beiden eben weg waren, kam Jenny. Sie wird mich Sonntag begleiten. Wie wohltuend doch das Mädchen auf mich wirkt. Ich fühle mich fröhlicher, stärker und gesünder, sobald ich sie in der Nähe weiß.
München, Freitag, d. 21. Juni 1912.
Ich bin traurig und fühle mich sehr verlassen. Jenny, scheint mir, war ein schöner Traum, und obwohl ich sie erst gestern mittag sah, ist’s mir, als ob seitdem eine Trennung zwischen uns liegt, die nie mehr aufhören kann. Sie hatte mir versprochen, mich abends zwischen 6 und 8 Uhr aus dem Stefanie abzuholen. Sie kam nicht, schrieb nicht, telefonierte nicht, versetzte mich. Jetzt komme ich (mittags) wieder vom Café. Keine Jenny, kein Zeichen von ihr. Ich komme mir so namenlos mißachtet vor durch diese Behandlung. Bin ich denn wirklich für jeden und jede nur ein Stück Dreck, das man mit dem Fuße in den Rinnstein schleudern darf? Aber was soll mich ein neuer Fall wundern? Friedel hat mich geliebt, daran gibt’s keinen Zweifel, das bestreitet sie selbst nicht. Als ein andrer kam, ging sie über mich hinweg, als ob ich nie gewesen wäre. Und ich bin ihr dankbar, daß sie mir von Anfang ehrlich sagte, wie es war und mich nie belog. Andre spielten mit mir (Lotte) und ich danke ihnen für gute Stunden. Das eine Mädel, das häßlichste, das ich je umarmte, hatte ich gern, weil sie mich so treu, so zärtlich liebte. Jetzt – nach zwei Jahren – bewirft sie mich plötzlich mit stinkendem Kot. Soll ich mich noch wundern und grämen? Jenny war vorgestern bei einem Studentenausflug in Pullach. Sie hat sich, wie sie berichtete, sehr gut amüsiert. Wahrscheinlich hat sie sich verliebt, und wird jetzt ihre Zeit lieber mit Küssen verwenden als mit gescheiten Gesprächen mit einem Mann, der seit 14 Tagen krank und erotisch unmöglich ist. Mit meiner Krankheit scheint es jetzt endlich ein wenig besser zu werden. Aber das Allgemeinbefinden ist noch miserabel. Ich habe Kopfschmerzen und sauren Geschmack in Mund und Nase. Und die psychische Verfassung – passons-la!
München, Sonnabend, d. 22. Juni 1912.
Ich ging, nachdem ich gestern meine üble Stimmung hier abreagiert hatte, mit einem Brief zu Jenny, worin ich ihr kurz und sachlich mitteilte, daß ich sie abends wieder im Stefanie erwarte. Als ich den Brief abgegeben hatte, traf ich sie auf der Straße. Sie erzählte, sie habe sich eben in einem Briefe bei mir zum Abendbrot angemeldet. Ihr Ausbleiben aus dem Kaffeehause vorgestern erklärte sie so harmlos, daß ich glücklich war. Ich ging in den Hofgarten. Dort saß ich lange mit den Herren v. Maaßen, v. Hörschelmann und v. d. Recke, ebenfalls einem Bibliophilen. Ich faßte mit Maaßen den Plan, ein gemeinsames Lustspiel zu schreiben, dessen Held Dr. Armin Kausen sein soll. Ich bin gespannt, ob aus der Sache was wird. Nachher Stefanie und dann kam Jenny zu mir. Wir gingen nach dem Abendbrot zum Gambrinus, wo sehr wenig los war. Morax sprach ein paar herzliche Worte. Aber die paar Leute, die jetzt regelmäßig zu uns kommen, sind schlaff und wollen geleitet werden. Man beschloß, zwei Zimmer zu mieten. Das eine soll Ida Weber bewohnen, das andre als Bibliotheks- und Lese- und Rendez-vous-Raum benutzt werden. Das kommt mir so unwichtig vor, ehe wir nicht wirkliche Menschen haben. Ich war recht deprimiert, fühlte mich zudem auch sehr elend und ging mit Jenny auf Umwegen – an der Isar entlang – dann die Maximilianstrasse hinauf – zur Torggelstube. Gute Gespräche über sozialistische Dinge. – Im Torggelhaus gerieten wir in eine peinliche Gesellschaft: der klebrige Dr. Brecher, der schäbigfeixende Architekt Lutz, der psychopathische Dr. Muhr, und ein paar gleichgültige Weiber blieben übrig, als Rosa Valetti beim Erscheinen der Fritzi Massary zu ihr an den Nebentisch ging. Ich brach gegen Mitternacht mit Jenny auf, und wir gingen noch ins Café Odeon. Dort kamen wir uns sehr nahe. Wir saßen stundenlang Hand in Hand und ich erzählte ihr unendlich viel aus meinem Leben – all die Enttäuschungen in den Anfängen meiner Laufbahn: mit der Neuen Gemeinschaft, die Episode Wetzel, Armer Teufel und was noch alles. Ich fühlte, daß ich sie ungeheuer lieb hatte. Dann begleitete ich sie heim. Vor der Tür bat ich sie, ihr die Backe küssen zu dürfen. Sie wehrte ab. – Ich schlief ein, völlig erfüllt von dem schönen lieben herrlichen Mädchen. Dieses Zusammensein gestern abend hat mich gekräftigt und ermutigt. Ich fühlte auch meine Schmerzen schwinden, und wenn ich auch heute noch eine Reizung in der Backe fühle – das Allgemeinbefinden hat sich sehr gebessert. Heut mittag war ich wieder mit Jenny im Stefanie zusammen, und morgen früh fahre ich bei gutem Wetter mit ihr an den Ammersee, wo wir die Beutler besuchen wollen. Ob sie meine Liebe, von der sie jetzt sichere Beweise hat, je erwidern wird? Ich glaube fast, in Jenny Brünn wird sich einmal mein Schicksal erfüllen – ein gutes Schicksal.
München, Montag, d. 24. Juni 1912.
Das war ein bedeutungsvoller Tag gestern. Die Entscheidung über meine Verbindung mit Jenny Brünn hat er zwar noch nicht gebracht, aber ich habe das Gefühl, die Entscheidung ist jetzt so vorbereitet, daß sie bald fallen muß. Ich bin mir über meine Gefühle zu ihr klar, so klar, daß ich ihr in aller Form von meiner Liebe gesprochen habe. Mein Liebesgeständnis kam einer Frage, ob sie ihr Leben meinem anvertrauen will, ziemlich gleich, aber ihre Antwort, ihre entgiltige Entschließung steht noch aus.
Sie holte mich um ¾ 10 in der Frühe ab, und wir fuhren nach Seefeld-Hechendorf. Von dort gingen wir in großer Sonnenhitze zu Fuß nach Breitbrunn, wo die Beutler ihre Sommerwohnung hat. Wir brauchten gut 1½ Stunden zu dem Spaziergang, und auf dem Wege gingen wir fast immer Hand in Hand, streckenweise auch hielt ich meinen Arm fest um ihre Hüfte. In einem Walde rasteten wir. Ich legte meinen Kopf in ihren Schoß und sie steckte mir Erfrischungsbonbons in den Mund. Auch küßte ich ihr Hände, Hals und Wangen, ohne daß sie viel abwehrte. – Margarete Beutler bewohnt in Breitbrunn das „Müller-Häuschen am See“, das entzückend und ganz verlassen am Wasser liegt. Peter sprang uns, nur mit einer Badehose bekleidet, am Haustor entgegen. Dann begrüßte uns auch Hansi, und noch einige Jungens, die vom Schondorfer Landerziehungsheim, wo Peter Claus lebt, hochgekommen waren. Die Beutlerin war reizend. Aus all der glühenden Leidenschaft, die mich vor 12 Jahren zu ihr zog, aus all den Stürmen der Zwischenzeit und den vielen Jahren, die wir uns doch ziemlich entfremdet waren, hat sich, wie ich gestern erfreut feststellte, eine gute vertrauliche Freundschaft krystallisiert, die wohl niemals mehr umzubringen sein wird. Sie ist frivol und schont sich selbst nicht mit ihrem Zynismus, aber hinter aller Ruppigkeit steht ein tiefes reines und ganz abgeklärtes Gemüt. Auch auf Jenny machte die Frau einen starken Eindruck. – Wir bekamen sehr reichlich zu essen. Später badete ich im See, angetan mit einer Badehose, die Peter gehört, meiner schlanken Taille aber paßte. Ich schwamm ein wenig herum und fühlte mich sehr wohl im kühlen Wasser. Man rief zum Kaffee und ich kam, wie ich war, nur mit einem Frottiermantel umgetan ins Haus. Nachher wurde eine Bootfahrt inszeniert. Die Beutler ruderte. Hans Florian turnte an der Spitze des Kahns umher. Jenny lag am Bug auf einer Matratze und ich neben ihr, angetan mit einem durchstoßenen Panamahut von Freksa, meinen Schuhen und besagter roter Badehose. Wir stiegen ans Land und machten einen Spaziergang am Strand entlang, ich immer in der luftigen Nackttoilette. Das Sonnenbad erfrischte mich ungemein. Wir bekamen dann noch ein Abendbrot und Margarete Beutler begleitete uns eine halbe Stunde Weges nach Herrsching zu. Als sie uns verlassen hatte, wurde ich sehr zärtlich zu Jenny und sprach ihr viel Zärtliches. Am Bahnhof war unheimlicher Andrang, da der letzte Zug von Herrsching nach München unglaublicherweise schon 9’40 abfährt. Im Coupé zweiter Klasse mußten wir uns aber vis-à-vis den ekelhaften Ingenieur Lutz mit seiner Freundin gefallen lassen. Da die beiden aber viel schliefen, konnte ich doch manche Zärtlichkeit anbringen. Vom Münchner Bahnhof aus nahm ich eine Pferdedroschke, mit der ich Jenny heimfuhr. Unterwegs erhielt ich einen Kuß von ihr auf die Wange. Den Mund wollte sie durchaus nicht hergeben, ließ es sich aber gefallen, daß ich sie duzte. – Ich ging dann gleich zu Bett, weil ich nicht noch mit gleichgiltigen Leuten zusammensein mochte. Heut mittag war ich wieder eine halbe Stunde mit ihr im Café Stefanie, und um 6 Uhr soll ich sie dort wiedertreffen, da sich Jaffé mit dem Goldenen Friedele auch einfinden wollen.
Vorgestern abend hatte ich in der Torggelstube den Dr. Rund gesprochen, der jetzt mit Stefan Grossmann zusammen das Neue Schauspielhaus in Wien begründet. Wir sprachen über die Zeit vor 12 Jahren in Berlin und über unseren gemeinsamen toten Freund Curt Siegfried. – Auf dem Heimweg begegnete mir Walter Strich. Er erzählte, daß Lottes Mutter „die alte Pumerin“ im Sterben liege und das Puma ihm aus Berlin recht traurige Briefe schreibe. – Uli schreibt mir einen netten Brief aus Arbi (Dalmatien). Eine gelbe Blume, die sie als Gruß beilegt, habe ich in den Rahmen ihrer Bilder geklemmt.
München, Dienstag, d. 25. Juni 1912.
Das Rendezvous mit Jaffé und dem Friedele verlief recht nett. Jenny war erstaunt, ihren Lehrer Jaffé, den sie bisher nur auf dem Katheder kannte, so unprofessorhaft zu finden. Friedele („Mamsell Tralala“ nennt das Puma sie boshaft, aber recht charakteristisch) hat sich von ihrem Mann und ihren Kindern getrennt und lebt mit einem Engländer, namens Lawrence, den sie ins Stefanie mitgebracht hatte. Nachher gingen wir alle ins Torggelhaus Abendbrot essen. Viele lange Gespräche über die himmlische Zeit vor 5 Jahren. Die Erinnerung an das einzige Glück, das mir im Leben zuteil geworden ist, regte mich durch die Gegenwart der nahen Zeugin sehr auf. Friedele mit ihrem Freund brach bald auf. Wir blieben mit Jaffé noch länger zusammen. Dann brachte ich die sehr angeregte Jenny heim, die sich wieder sträubte, mich zu küssen, und ging dann noch in den Ratskeller zum Krokodil, wo Karl Henckell, der monatelang grollend ferngeblieben war, sich wieder eingefunden hatte. Jodocus Schmitz überreichte mir mit einer lustigen Rede ein Monokel, da ich kürzlich die Bemerkung hatte fallen lassen, daß mein rechtes Auge viel kurzsichtiger sei als das linke, das ohne Glas geschont würde, sodaß ein Einglas für mich die adaequate Brille wäre. – Nachher aufgeregte Gespräche über Sozialismus und Kapitalismus. Ein trauriger Tiefstand der Anschauung, der sich besonders bei Weisgerber und Kutscher bemerkbar machte. Die Brüder Wenter traten bedingt für mich ein. Der eine von ihnen bekam bei dieser Gelegenheit Krach mit Schmitz, der erst mühsam geschlichtet werden konnte, sodaß die Sache ohne Weiterungen abging. Vorher hatte ich über das gleiche Thema mit Jaffé und Jenny disputiert. Meine Ansichten gehen auch von denen Jaffés, der stark an Marx und Rodbertus anschließt, weit auseinander. Aber welche Ruhe und Sachlichkeit war bei dem Gespräch, da jeder das Thema kannte, über das er sprach. Wird in einem Disput eine Meinung von jemand vertreten, der ohne Sachkenntnis aus der momentanen Intuition heraus seine Thesen verteidigt, so giebt es stets Schreierei und Respektlosigkeiten. Man soll mit solchen Leuten nicht über ernste Gegenstände reden. – Heut war Jenny zu Tisch bei mir. Ich war sehr zärtlich zu ihr. Ich habe sie herzlich lieb, und sie kann wohl nicht mehr daran zweifeln. Nachher ging ich in ein Photografisches Atelier am Max Josefplatz, wo Dr. Muhr mich für ein Sammelalbum Münchner Künstler typte. Auch Rössler und Franz Blei waren dort. Nachher ich mit Blei im Stefanie. Er redete kluge Sachen über moderne Lyrik. Schade, daß er solch ein Snob ist. Er hätte das Zeug zu etwas besserem.
Ach ja! gestern tauchte Mariechen wieder im Café auf. Sie wollte Geld von mir. Ich gab ihr den Bescheid, daß sie auf mich nicht mehr rechnen möge. Ich nähme ihr nichts übel, sei mir aber zu schade für die Rolle als Wurzen, die sie mich spielen lasse. Ich bin froh, daß ich ihr das endlich gesagt habe. Sie wird jetzt zwar weidlich gegen mich schimpfen und intrigieren, aber was liegt daran? Ich finde, unser Geschäft ist ausgeglichen. Sie hat mich höllisch zahlen lassen, ohne wesentliches dafür zu leisten. Ich habe manches was mir sehr lieb war, eingebüßt und eine tüchtige Enttäuschung dazu, dafür aber die Erinnerung an ein paar hübsche Küsse, an schöne blonde Haare und ein Paar herrliche lange schlanke Beine. –
Eben kam ein Telegramm von Johannes. „Verzweifelt“. Was soll ich nur tun? Ich bin so fertig mit meinen Möglichkeiten. Auch vom Dreimasken-Verlag ist nichts mehr zu holen. Die Bande nimmt mir meinen Theaterartikel im letzten Kain-Heft übel, wo ich die „Circe“- und „Kismet“-Aufführung heruntergemacht habe. Der Bürgerstandpunkt, dessen Verletzung man an mir ahndet! „Wes Brot ich esse, des Lied ich singe.“
München, Mittwoch, d. 26. Juni 1912.
Auf dem Wege zur Torggelstube ging ich gestern noch ins Café Odeon, wo ich Heinrich Mann und Dr. Brantl traf. Mann sagte mir große Schmeicheleien über die letzte Kain-Nummer, die allgemein sehr gefallen hat, und meinte: „Sie haben jetzt die wertvollste Zeitschrift, die existiert.“ Das aus dem Munde des bedeutendsten Mannes zu hören, der gegenwärtig im geistigen Deutschland wirkt, ist recht angenehm. Er lobte besonders meinen kurzen Strindberg-Nekrolog. Nachher lange Gespräche über Frauenliebe, Eifersucht und Beziehung der Geschlechter zu einander, wobei ich gegen die beiden Herren einen harten Stand hatte. Das Thema schloß an an den Fall Rößler – Consul und meine Beziehung zu den beiden. (Der arme Consul, der sich im Winter beim Rodeln das Bein brach, liegt immer noch gestreckt, da der Bruch schlecht verheilt war und noch einmal operiert werden mußte). Im Torggelhaus: v. Jacobi, Rosa Valetti mit Ehemann, Weigert, Muhr. Man brach bald auf und ich spielte im Stefanie noch mit Tarrasch Schach. Jenny tauchte auf mit einigen Studenten. Sie kam kurz zu mir an den Tisch. Auch heut sah ich sie nur flüchtig im Café, wo sie nur auf einen Sprung hineinkam, um mir guten Tag zu sagen. Ich liebe das Mädchen ehrlich und gut. Merkwürdig: seit ich sie kenne, existieren die andern Mädels garnicht mehr für mich. Ich war selbst erstaunt, wie kühl ich Mariechen den Abschied geben konnte, ganz ohne innerliche Kämpfe oder Überwindungen. Maxi sehe ich oft genug im Café. Sie käme gern, wenn ich sie mal aufforderte, bei mir zu schlafen. Grete Krüger scheint frei zu sein, da Bloch entweder schon abgereist ist oder dieser Tage nach Amerika losfährt. Gewiß: ich würde eine Gelegenheit, sie zu mir zu nehmen, nicht auslassen, aber ich habe nie die Empfindung, als ob ich solche Gelegenheit herstellen müßte. Frieda Gutwillig habe ich lange nicht gesehen. Vielleicht sitzt sie gegenüber in ihrem Zimmerchen und sehnt sich danach, daß ich sie rufen lasse. Friedl Wiegand schrieb mir kürzlich aus Freiburg. Ich hatte ehrliche Sehnsucht nach ihr. Jetzt habe ich tagelang nicht mehr an sie gedacht. Sehr merkwürdig. Das ist etwas ganz Neues in meinem Leben. Denn diese Liebe zu Jenny ist ganz ruhig und garnicht aufgeregt. Ich wünsche sie stets bei mir und bin froh, wenn ich sie sehe. Ist sie fern, so bin ich ganz frei von Angst, Hysterie und der Sucht, sie zu kontrollieren. Aber ich denke an sie und freue mich an etwas Liebes denken zu können. Der Drang, ihr Zärtlichkeiten zu erweisen, entspringt viel mehr ganz menschlicher Hinneigung als brünstiger Aufregung. Meine Gefühle für sie sind fast brüderlich, sowenig ich mich gegen ihre weibliche Anmut und gegen die Reize verschließe, die sie auf mich als Mann ausübt. Könnte ich mich doch mit ihr einigen! – Wäre ich nur erst gesund. In der Zahnlücke rumort es wieder ganz peinlich. Ich glaube, wenn ich von dieser körperlichen Beschwerde frei bin, werde ich auch stärker und schöner sein und also größere Anwartschaft haben, in Jennys klugen Augen zärtlichen Glanz zu wirken.